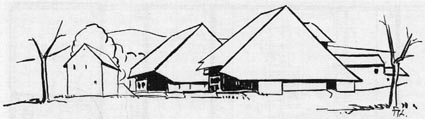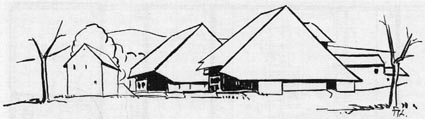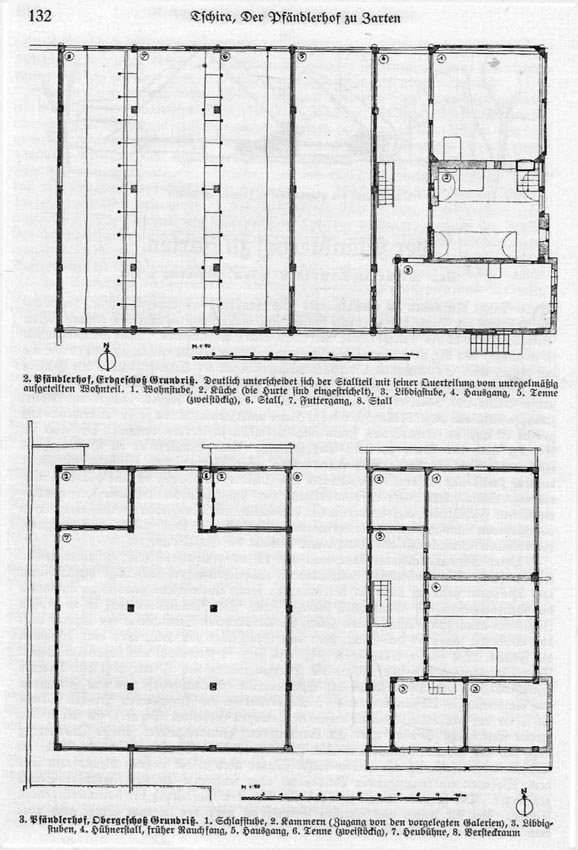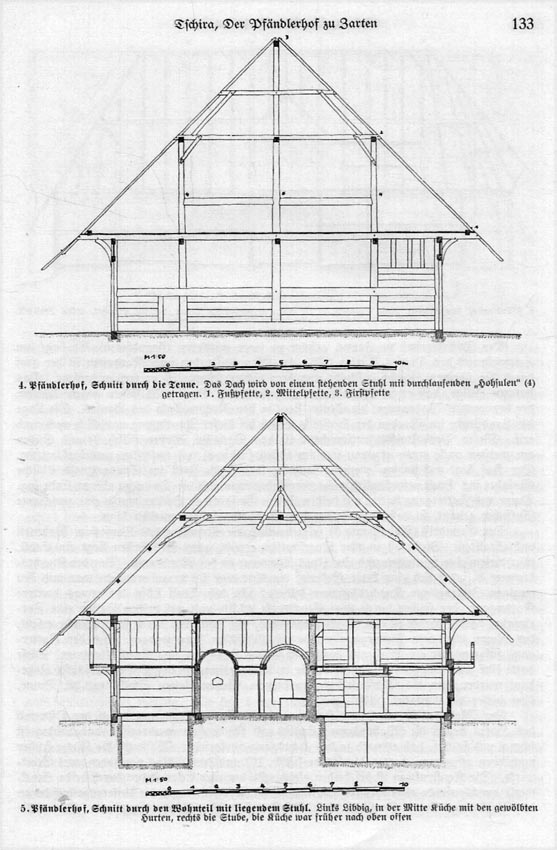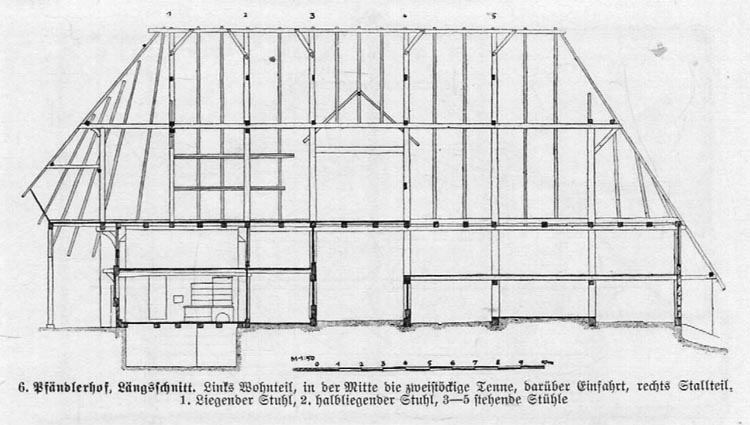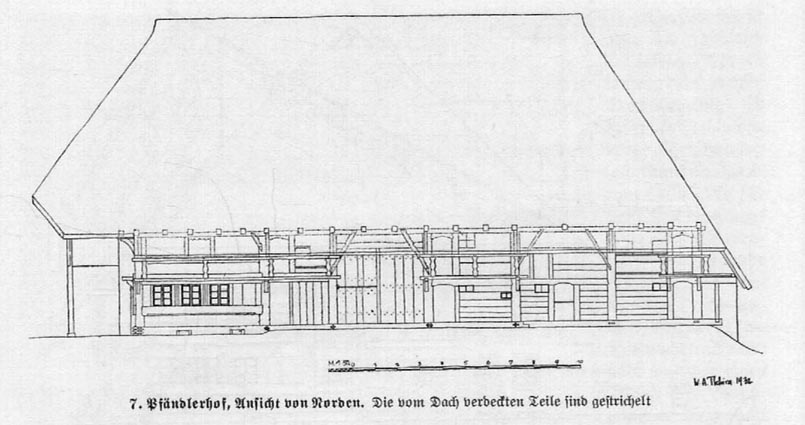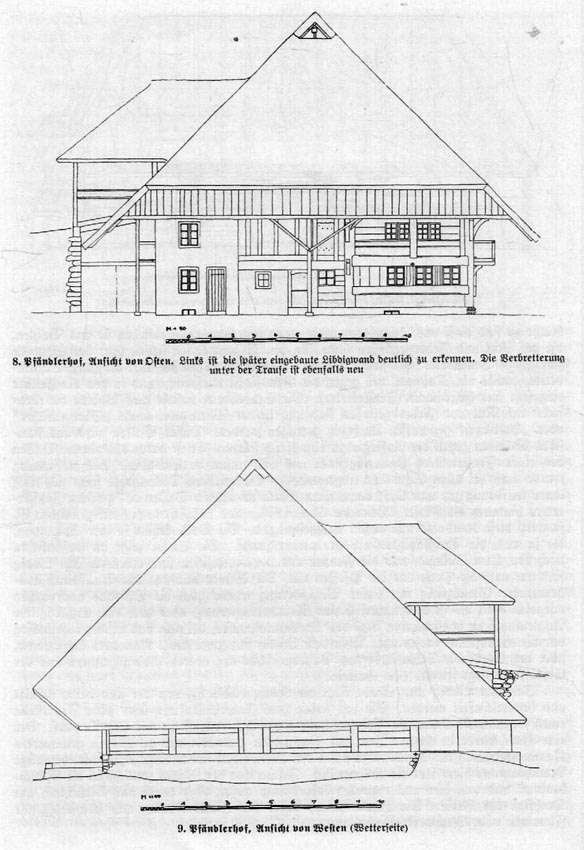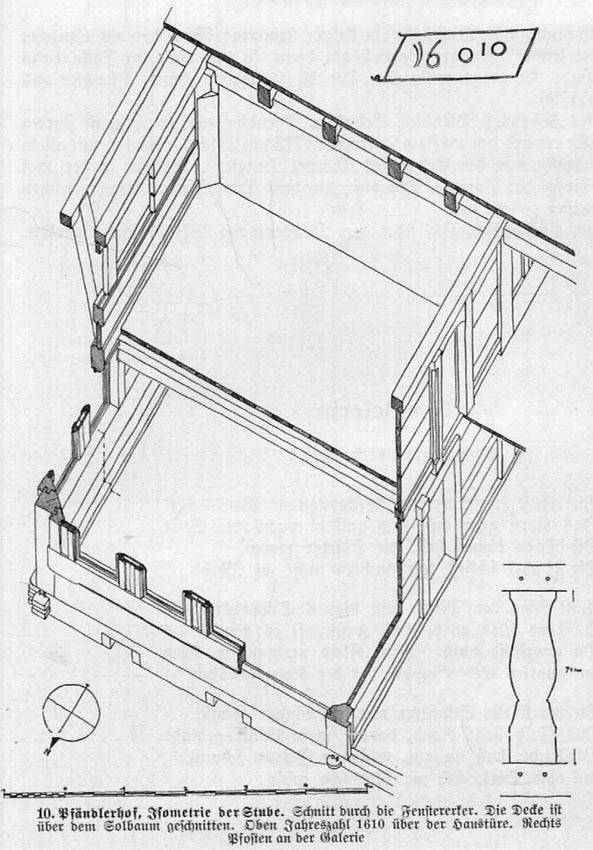zum
Inhaltsverzeichnis
Der Pfändlerhof zu Zarten
Von Wilhelm Arnold Tschira, Freiburg i. Br.
Aus: Mein Heimatland, 19.
Jahrgang, Heft 5/6, 1932, Seiten 131-138
Bild
1 Seppenhof und Pfändlerhof zu Zarten von Westen
Drei Dinge bestimmen die Gestalt eines Bauernhofes, das Bauprogramm,
der Baustoff und der Bauplatz. Bewußt künstlerische Gestaltung vermag
der vorurteilsfreie Betrachter nur in der Durchbildung der Einzelheiten
zu entdecken. Das Bauprogramm ist abhängig von der Lebensweise des
Bauern und diese wieder abhängig von dem Land auf dem er lebt. So
zwingt die Oberflächenbeschaffenheit des Schwarzwaldes den Bauern zur
Viehwirtschaft, er braucht also außer der Wohnung für Familie und
Dienstleute große Ställe und Speicher für das Viehfutter. Das rauhe
Klima, Schnee und Kälte, zwingen dazu alle diese Räume in einem Haus
unterzubringen, da so die Wärmehaltung größer ist und bei Schnee das
Haus nicht verlassen zu werden braucht. Oft fehlt im Gebirge auch der
Platz zu einer Gehöftanlage. Der Baustoff ist im Schwarzwald
selbstverständlich das Holz. Aus diesen beiden ersten Bedingungen,
Einhaus und Holz, entsteht zuerst eine Urform. Die Urform des
Schwarzwaldhauses ist eine zeltartige einräumige Hütte. Aus dieser
Urform entstand mit Anwachsen der Bedürfnisse und handwerklichen
Fähigkeiten eine immer weiter entwickelte und überlieferte Grundform,
die in verschiedenen Landschaften wieder verschieden gestaltet wird.
Durch die dritte Bedingung, die örtlichen Verhältnisse des Bauplatzes,
entsteht die Einzelform.
Beim Schwarzwaldhaus kann man drei Grundformen feststellen; sie
unterscheiden sich durch die Dachkonstruktion voneinander.
Unterscheidungen nach Lage der Einfahrt und ähnlichem halte ich nicht
für berechtigt, da solche Unterschiede gewöhnlich nur durch die
Gegebenheiten des Bauplatzes bedingt sind. Die Raumanordnung ist in
großen Zügen bei allen drei Grundformen gleich, an der vorderen
Schmalseite des Hauses liegt der Wohnteil, dahinter der Stall,
über dem Stall liegt das Heu, über dem Wohnteil die Frucht. Die älteste
Grundform zeigt das reine Pfettendach mit stehendem Stuhl. Fünf
Längsbalken (Pfetten) tragen die Dachsparren, je eine Pfette liegt am
Dachfuß (Fußpfette), je eine Pfette unter der Sparrenmitte
(Mittelpfette), und eine Firstpfette am Dachfirst. In Abständen von 4-5
Meter werden die Pfetten von Pfosten (»Hohsul«), die aus den
Hausschwellen aufstehen, getragen (stehender Binder). Es stehen also
immer fünf solche Pfosten quer zur Hausrichtung hintereinander. Dieser
Querteilung muß sich der Grundriß anpassen. Im Stallteil ist diese
Einteilung sehr praktisch, im Wohnteil erweist sie sich als viel zu
starr. Daher wird in der zweiten Grundform über dem Wohnteil ein
freitragender Dachbinder ohne senkrechte Pfosten (liegender Stuhl)
geschlagen. Der liegende Stuhl gestattet nun eine freie Aufteilung der
darunterliegenden Fläche. Bei der letzten und jüngsten Grundform wird
der liegende Stuhl auch über dem Stallteil angewendet.
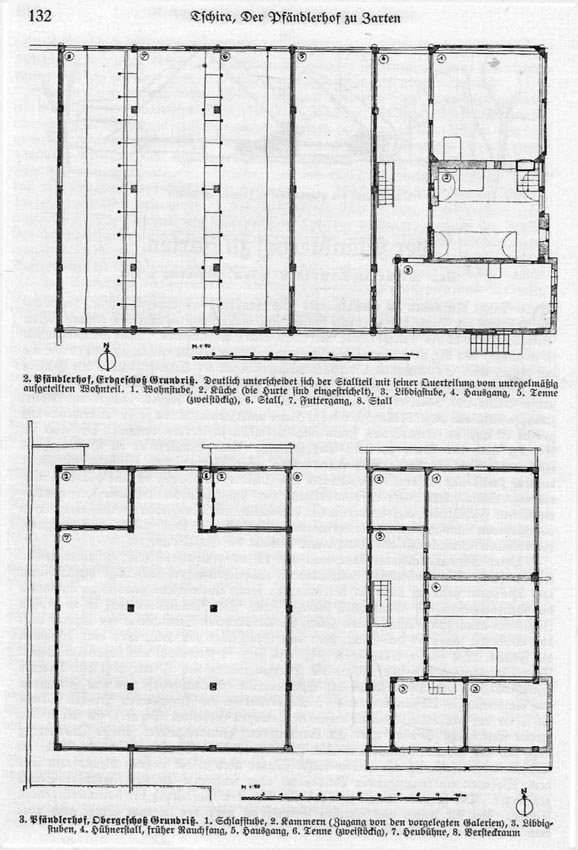
|
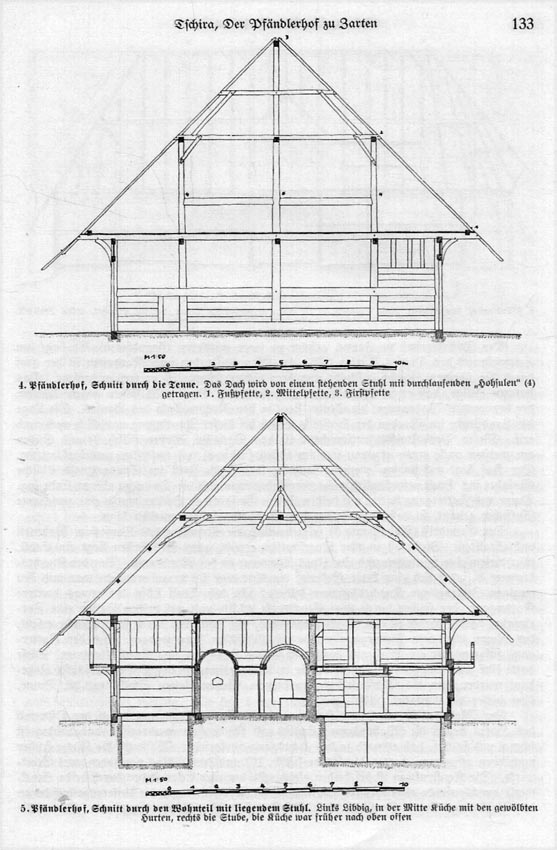
|
Bild 2· Pfändlerhof, Erdgeschoß Grundriß. Deutlich unterscheidet sich
der Stallteil mit seiner Querteilung vom unregelmässig aufgeteilten
Wohnteil. 1. Wohnstube, 2. Küche (die Hurte sind eingestrichelt), 3.
Libdigstube, 4. Hausgang, 5. Tenne (zweistöckig), 6. Stall, 7.
Futtergang, 8. Stall
Bild 3. Pfändlerhof, Oberqeschoß Grundriß. 1. Schlafstube, 2. Kammern
(Zugang von den vorgelegten Galerien) 3. Libdigstuben, 4. Hühnenstall,
früher Rauchfang, 5. Hausgang, 6. Tenne (zweistöckig), 7. Heubühne, 8.
Versteckraum
Bild 4. Pfändlerhof, Schnitt durch die Tenne. Das Dach wird von einem
stehenden Stuhl mit durchlaufenden „Hohsulen“ (4) getragen. 1.
Fußpfette, 2. Mittelpfette, 3.
Firstpfette
Bild 5. Pfändlerhof, Schnitt durch den Wohnteil mit liegendem Stuhl.
Links Libdig, in der Mitte Küche mit den gewölbten Hurten, rechts die
Stube, die Küche war früher nach oben offen
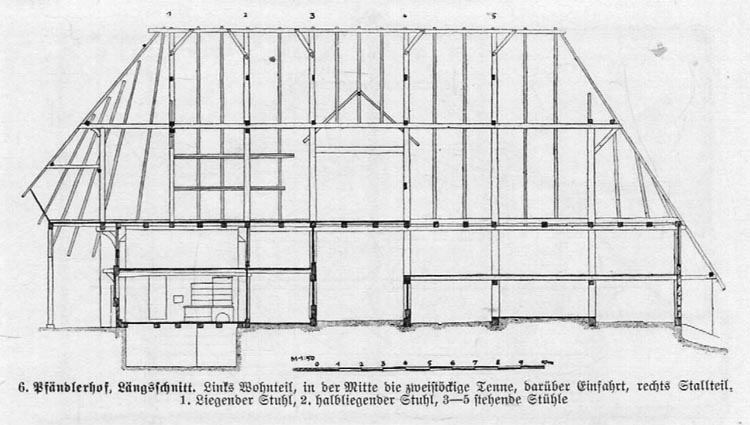
|
Bild 6. Pfändlerhof, Längsschnitt. Links Wohnteil, in der Mitte die
zweistöckige Tenne, darüber Einfahrt, rechts Stallteil. 1. Liegender
Stuhl, 2. halbliegender Stuhl, 3-5 stehende Stühle
Der Pfändlerhof zu Zarten gehört zu jener mittleren Grundform. Er liegt
am Südwestrand des Dorfes Zarten (Abb. 1). Gegen Norden und Nordosten
ist der Hof durch die übrigen Häuser geschützt nur dem Südweststurm ist
er frei ausgesetzt. Das hat zur Folge, daß er in Ostwestrichtung gebaut
ist. Die Ställe liegen gegen Westen, der bevorzugte Wohnraum, die
Stube, liegt in der Nordwestecke des Hauses. Die Lage der Landstraße im
Norden der Hofstelle sprach bei dieser Anordnung natürlich auch noch
mit. Diesen Verhältnissen entsprechend ist das Dach im Westen (Abb. 9)
und Süden am meisten nach unten gezogen und im Osten (Abb. 8) am
weitesten zurückgeschnitten. Der Hof liegt auf nahezu ebenem Gelände,
so daß die sonst im Schwarzwald übliche Einfahrt ins Dach ursprünglich
nicht vorgesehen war und die Tenne zu ebener Erde lag. Tenne und
Futtergang hatten auf beiden Seiten Einfahrten. Später wurde eine
gemauerte Auffahrt gebaut, so daß heute sofort ins Dach eingefahren
werden kann.
Der Grundriß (Abb. 2 und 3) zeigt deutlich die Trennung des Hauses in
Wohnteil und Stallteil. Dieser ist in vier Querstreifen geteilt, ganz
im Westen liegt ein Stall, über diesem eine Heubühne und eine
Knechtskammer an der Nordwand. Vor der Knechtskammer befindet sich eine
kurze Galerie, die über eine Leiter zu erreichen war und den einzigen
Zugang zur Knechtskammer bildete. An den Stall stößt der etwas breitete
Futtergang, der früher durch zwei Stockwerke reichte und auf beiden
Seiten eine Toreinfahrt hatte. Heute ist eine Decke eingezogen, die
Tore sind durch feste Wände ersetzt, der Raum über dem Futtergang wurde
zur Heubühne hinzugezogen. Auf den Futtergang folgt wieder ein Stall
mit darüberliegender Heubühne und Knechtskammer. Diese hatte eine jener
doppelten Wände, die sie in Kriegszeiten oft in die Bauernhäuser
eingebaut wurden, um als Versteckräume zu dienen. Neben diesem Stall
liegt die Tenne, über dieser die Einfahrt (Abb. 4).
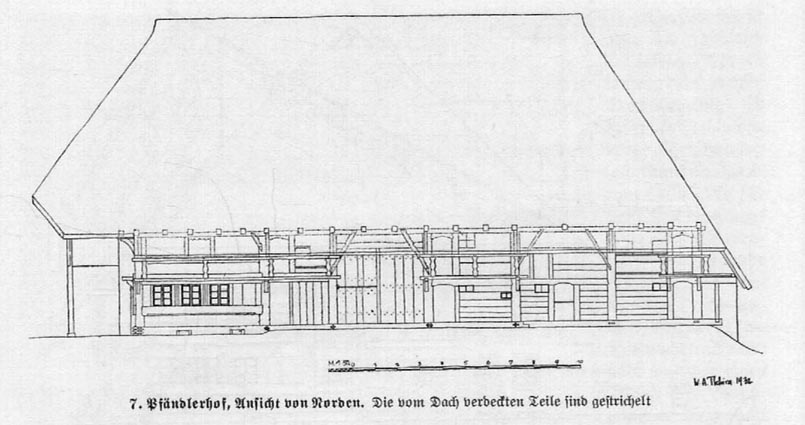
|
Bild
7. Pfändlerhof, Ansicht von Norden. Die vom Dach verdeckten Teile sind
gestrichelt.
Der Wohnteil ist durch den Hausgang vom Stallteil getrennt. Auf der
Ostwand des Hofes liegen die Wohnräume; Stube und Küche sind
quadratisch, das Libdig ist schmal und so tief, daß es noch in den
Hausgang vorspringt. Während die Küche früher noch oben offen war,
hatten die Stube (Abb. 10) und das Libdig von jeher zwei Stockwerke.
Die Konstruktion ist bei beiden gleich. In den vier Ecken stehen durch
beide Stockwerke durchlaufende abgeschrägte Pfosten. Diese Pfosten
tragen die Unterzüge auf denen die Balkenlage liegt. Zwischen diese
Pfosten sind die Wände eingebaut. Gegen die Küche zu sind diese aus
Stein gemauert, gegen den Hausgang bestehen sie aus Bohlen, die auf Nut
und Feder gestoßen sind. An den Außenwänden stehen über der Schwelle
zunächst 50 Zentimeter hohe starke Bohlen. Über ihnen ziehen sich über
die ganze Stubenbreite jeweils ein Rahmen, der gegen die Hausflucht
vorspringt und in den die Fenster eingesetzt sind (sogenannte
Fenstererker). Die Stubendecke besteht aus Bohlen die ebenfalls auf Nut
und Feder gestoßen sind und in der Mitte von einem »Stubenträger« oder
»Solbaum« genannten Unterzug getragen werden. Dieser Balken wird aus
statischen Gründen gegen die Auflager zu allmählich stärker. Er ist
durch den oberen Balken des einen Fenstererkers hindurchgesteckt und
von außen verkeilt (diese Holzverbindung wurde auch bei allen Schwellen
angewendet). Die mittlere Deckenbohle spitzt sich nach innen keilförmig
zu, und läuft durch einen Spalt im oberen Balken des zweiten
Fenstererkers hindurch ins Freie. Wenn die Decke infolge des
Holzschwundes leck geworden ist, so wird diese Keilbohle von außen
nachgeschlagen. Die Decke erhält so ihre Spannung, die ja auch die
Tragfähigkeit erhöht, wieder zurück. Die Stube zeigt im wesentlichen
noch den alten Zustand, nur die Fenster und der Kachelofen sind
erneuert. Am Libdig sind nur noch die Decke und die Pfosten alt. Die
Wände sind jetzt mit Backsteinen ausgemauert. Gleichzeitig mit dieser
Veränderung wurde auch die Ostwand nach außen vorgeschoben. Es ist dies
natürlich eine Raumerweiterung, aber auch eine nachträgliche
Angleichung an den jüngeren Typ des Dreisamtalhauses, bei dem das
Libdig regelmäßig vor die Hauswand vorspringt. Über dem Libdig sind
zwei kleine Kammern angeordnet, über der Stube die Schlafstube des
Bauern. Vor den oberen Libdigkammern und der Schlafstube liegt jeweils
eine Galerie.
Zwischen Libdig und Stube liegt die Küche (Abb. 5), von der aus beide
beheizt und bewirtschaftet werden. Sie hat daher zwei Feuerstellen und
über jeder Feuerstelle einen sogenannten Hurt, ein Tonnengewölbe aus
Weidengeflecht mit Lehmbewurf. Der eine Hurt wurde in neuerer Zeit aus
Backsteinen gemauert und an ihn ein gemauertes Kamin angeschlossen.
Heute ist zwischen den Hurten eine Decke eingezogen, die ehemalige
Rauchkammer dient jetzt als HühnerstalL Früher zog der Rauch zunächst
in die Rauchkammer und von hier aus entweder sofort nach außen oder
durch das Rauchloch am Dachfirst ins Freie. Die Hurte hatten dabei den
Zweck Funken und hochschlagende Flammen vom Dachwerk abzuhalten.
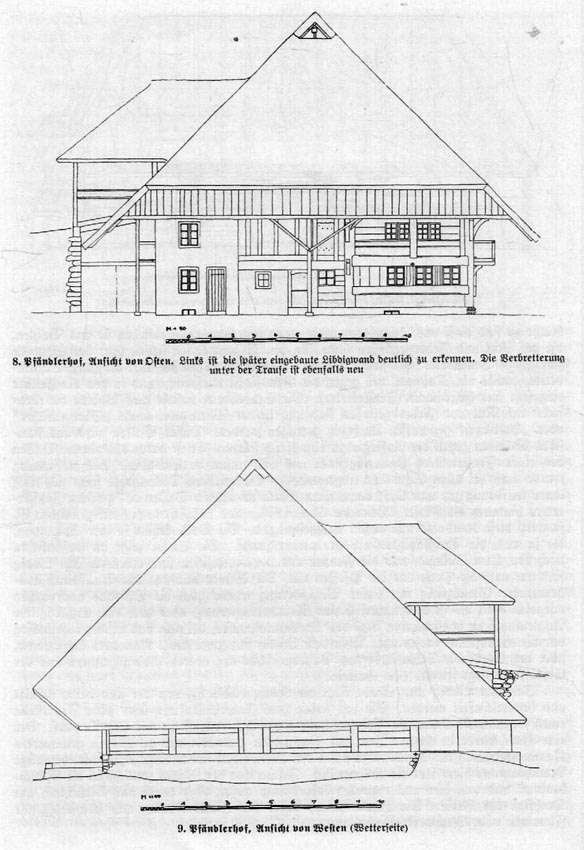
|
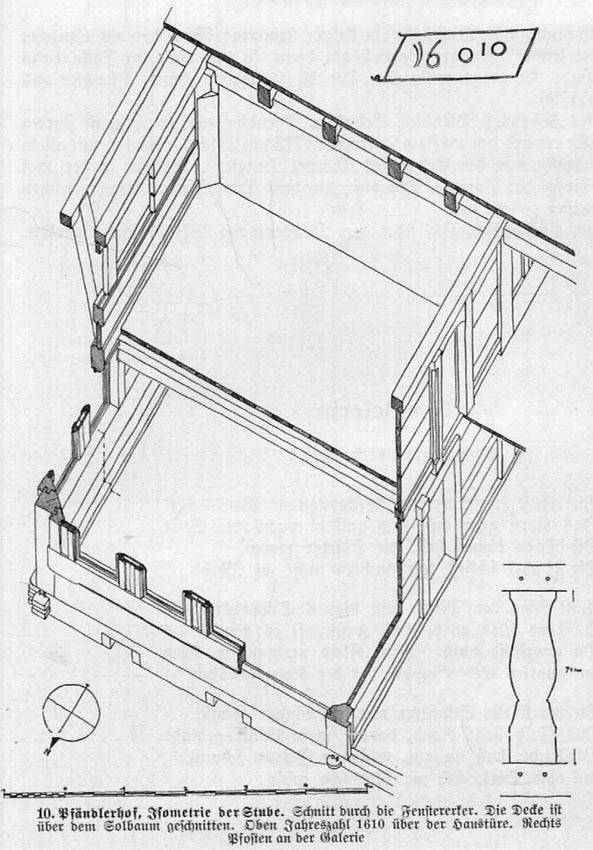
|
Bild 8. Pfändlerhof, Ansicht von Osten. Links ist die später eingebaute
Libdigwand deutlich zu erkennen. Die Verbreiterung unter der Traufe ist
ebenfalls neu
Bild 9. Pfändlerhof, Ansicht von Westen! (Wettetseite)
Bild 10. Pfändlerhof, Isometrie der Stube. Schnitt durch die
Fenstererker. Die Decke ist über dem Solbaum geschnitten. Obern
Jahreszahl 1610 über der haustüre. Rechts Pfosten an der Galerie
Der Giebel ist über die Ostwand vorgetragt (Abb. 6) Unter dem
weiten Dachüberhang ist heute der Dachboden vorgezogen und der so
entstandene Raum zum Heulagern benutzt. Im Dach liegt etwa über
Stubenmitte der liegende Stuhl mit der ansehnlichen Spannweite von über
11m. Der nächste Binder steht über der einen Wand des Hausganges. Er
enthält eine mittlere Hohsul, ist aber im übrigen als liegender Stuhl
ausgebildet. Was an dem ganzen Dachwerk auffällt ist die geringe
Verstrebung in der Längsrichtung. Infolge dieses Fehlers bekamen die
Firstsäulen durch den Winddruck allmählich einen Überhang von nahezu 2
m. Nachträglich wurde durch Einbau von Streben zwischen den Bindern
dieser Übelstand wieder beseitigt. Die Dachdeckung bestand früher aus
Stroh, heute ist das Dach mit dem üblichen Gemisch aus Schindeln,
Falzziegeln und Eternitplatten eingedeckt.
Im einzelnen ist großer Wert auf die Behandlung des Holzes gelegt. Das
ganze Baugefüge ist außerordentlich genau und sachgemäß gezimmert.
Besonders schön sind die sägeförmigen Blätter der Kopfbänder. Die Türen
sind ganz aus Holz gefertigt. Die Angeln laufen in besonders
eingesetzten Angellöchern aus Eichenholz, die Türbretter sind mit
Holznägeln auf den ebenfalls hölzernen Türbändern befestigt. Die
Schnappschlösser sind auch ohne jede Verwendung von Eisen hergestellt.
Außer Stube und Libdigstube, die Glasfenster besaßen, waren alle
Wohnräume nur mit hölzernen Schiebeläden an den Fensterlucken versehen.
Das Holz war früher - wohl durchweg - leicht bemalt. Rote Farbspuren
fand ich noch am Fenstererker. In den Holzfeldern an den Schlafkammern
der Nordseite sind noch sich überkreuzende rote und schwarze
Zickzackbänder deutlich zu sehen.
In einiger Entfernung vom Hof steht ein kleiner steinerner Bau, der als
Speicher für Korn und andere leicht brennbare Gegenstände dient, so daß
diese im Falle eines Brandes geschützt sind. Er trägt neben der Tür die
Inschrift: Hans Pfendler und Magtalena Meltzin 1756.
Der Vater dieses Johannes Pfendler, Sebastian Pfendler war der erste in
Zarten ansässige Pfendler. Er erwarb den Hof am 7. August 1713 um 2115
fl. rheinisch mit allem Feld, Wald und Zubehör von den Erben des Martin
Dengler (Nach Akten des Städt. Archivs Freiburg. Die Aufmessung führte
ich zusammen mit cand. Arch. Prosper Schwörer, Freiburg, durch. Für
frdl. Förderung unserer Arbeit schulde ich Herrn Hauptlehrer Lenz,
Zarten, herzlichsten Dank.) Seither ist der Hof ununterbrochen im
Besitz der Familie Pfendler, die dem Dorf Zarten schon manchen Vogt und
Bürgermeister gestellt hat.
Der Hof ist nach einer Jahreszahl über dem Hauseingang 1610 errichtet
worden.