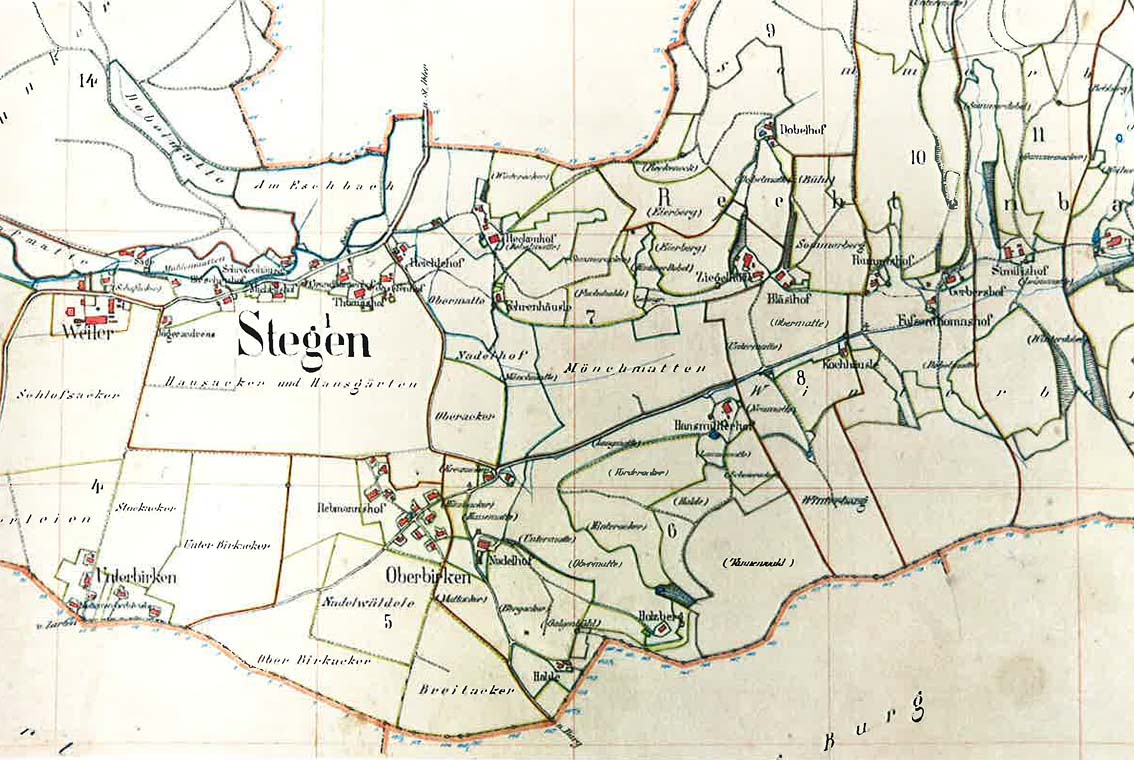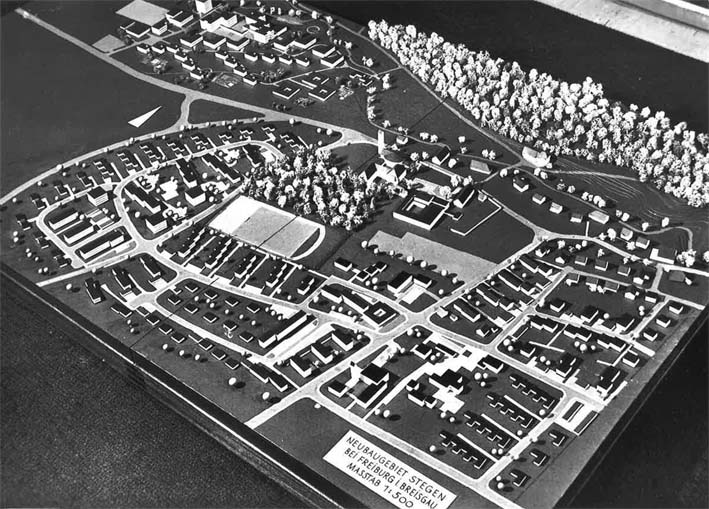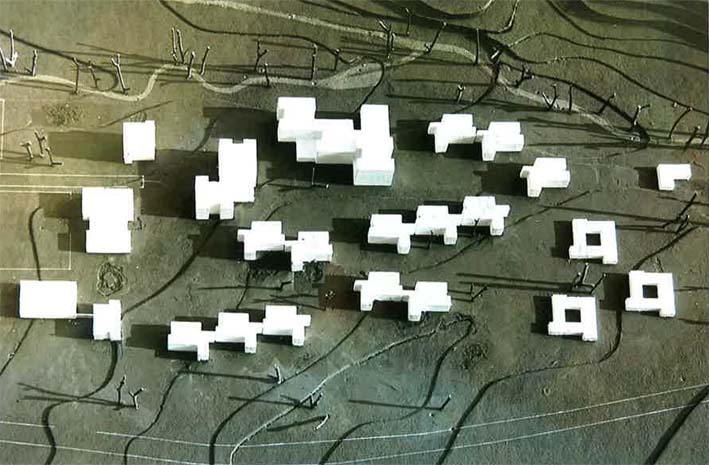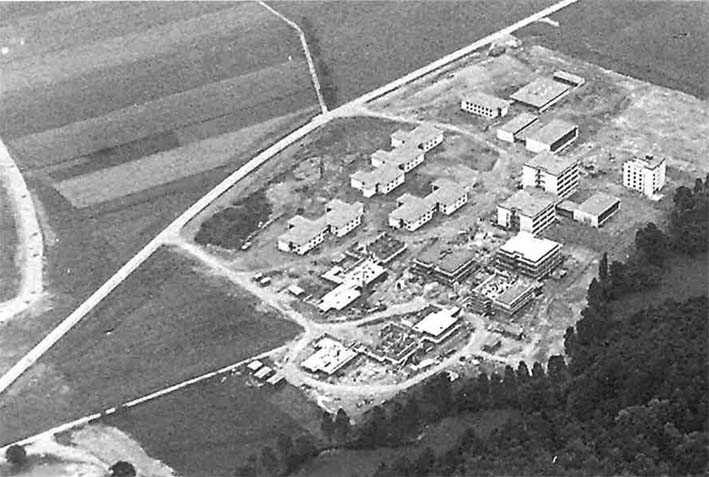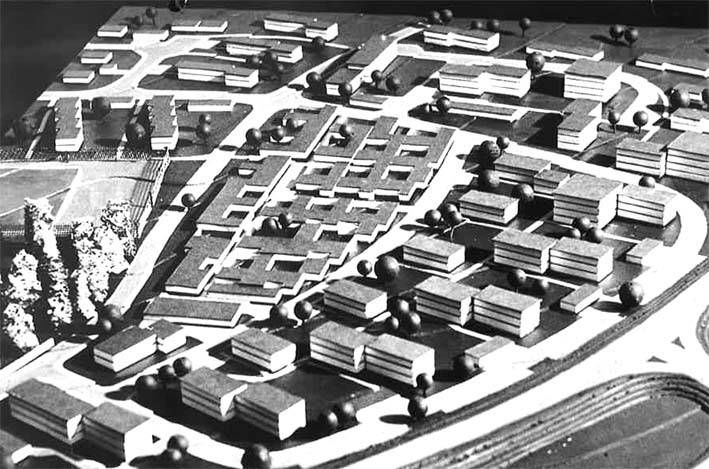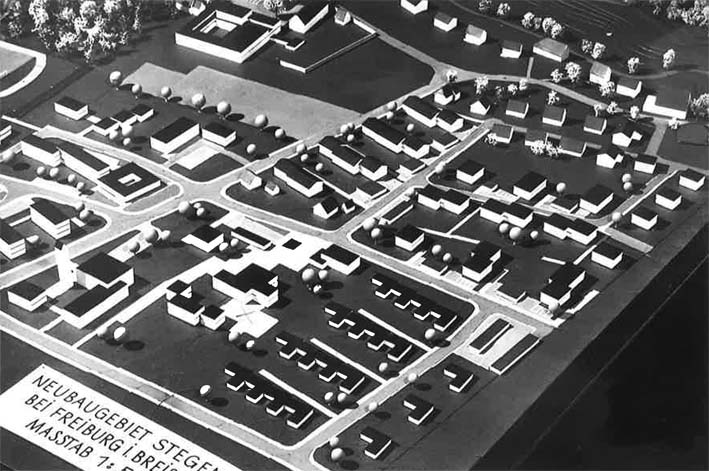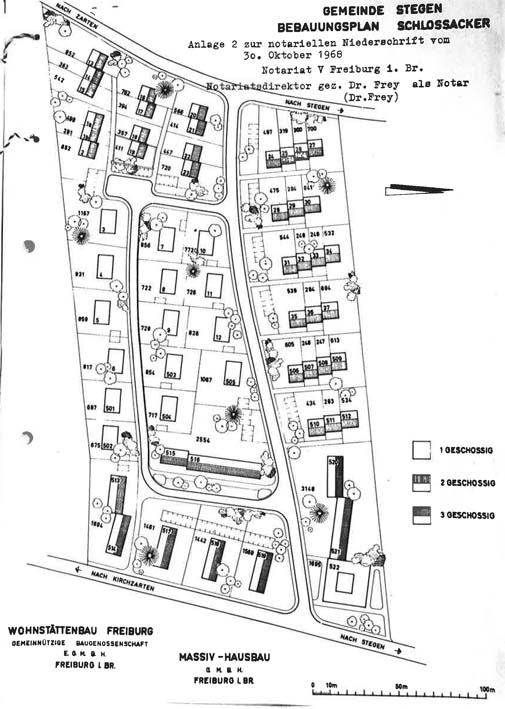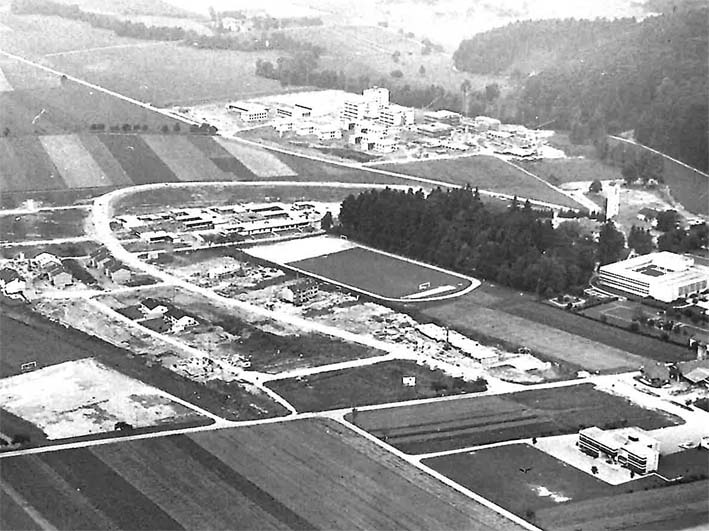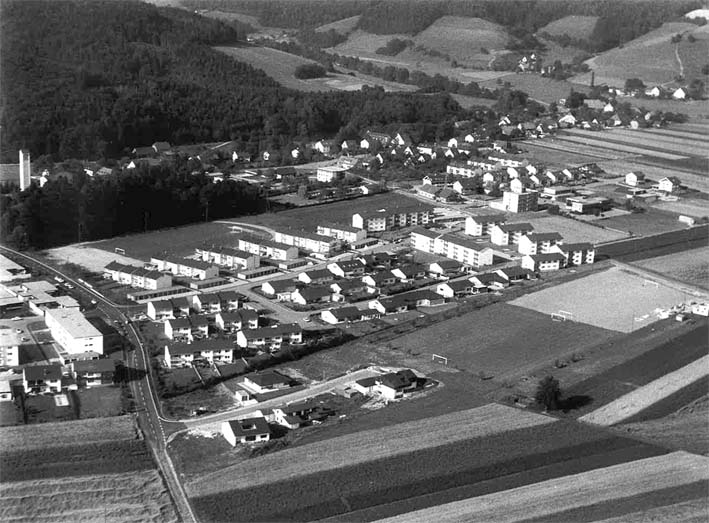zum
Inhaltsverzeichnis

|
| Kernort der früheren Gemeinde Stegen 1974
zum Zeitpunkt der
Gemeindereforrn mit der damit verbundenen Eingliederung von Eschbach
und Wittental |
Aus der Zeit vor dem 19. Jahrhundert
finden sich keine genauen kartografischen Aufzeichnungen von Stegen. Im
Großherzogtum Baden wurden nach 1853 nach und nach alle Gemeinden in
einem sog. Atlas genau vermessen und maßstabgetreue Lagepläne erstellt.
Für die Gemeinde Stegen wurde diese Arbeit 1890 bis 1893 durchgeführt.
Dieser „Atlas der Gemeinde Stegen“
befindet sich heute im Archiv des
Vermessungsamtes in Breisach.
Das Gebiet der Gemarkung der damaligen Gemeinde Stegen ist in 14
Teilplänen erfasst und im Maßstab 1:1500 genau verzeichnet. Auch ein
Register der Gewanne ist aufgezeichnet. Auf den Teilplänen sind die
einzelnen Grundstücke maßstabgetreu mit der zugehörigen Flurstücknummer
eingetragen.
Auf den Lageplänen sind auch die vorhandenen Gebäude eingezeichnet. Der
als Foto kopierte Lageplan von 1890 zeigt auch den damaligen
Gebäudebestand. Durch verschiedene Farben sind Wohngebäude rot,
Ökonomiegebäude gelb gekennzeichnet. Somit ergibt sich eine genaue
Übersicht der damaligen Gebäulichkeiten. Die Zahl der Häuser, entlang
der Dorfstraße zwischen Zarten und Eschbach war noch sehr gering wie
auf dem Foto zu sehen ist.
(Foto Fridolin Hensler im Vermessungsamt Breisach im Januar 2013)
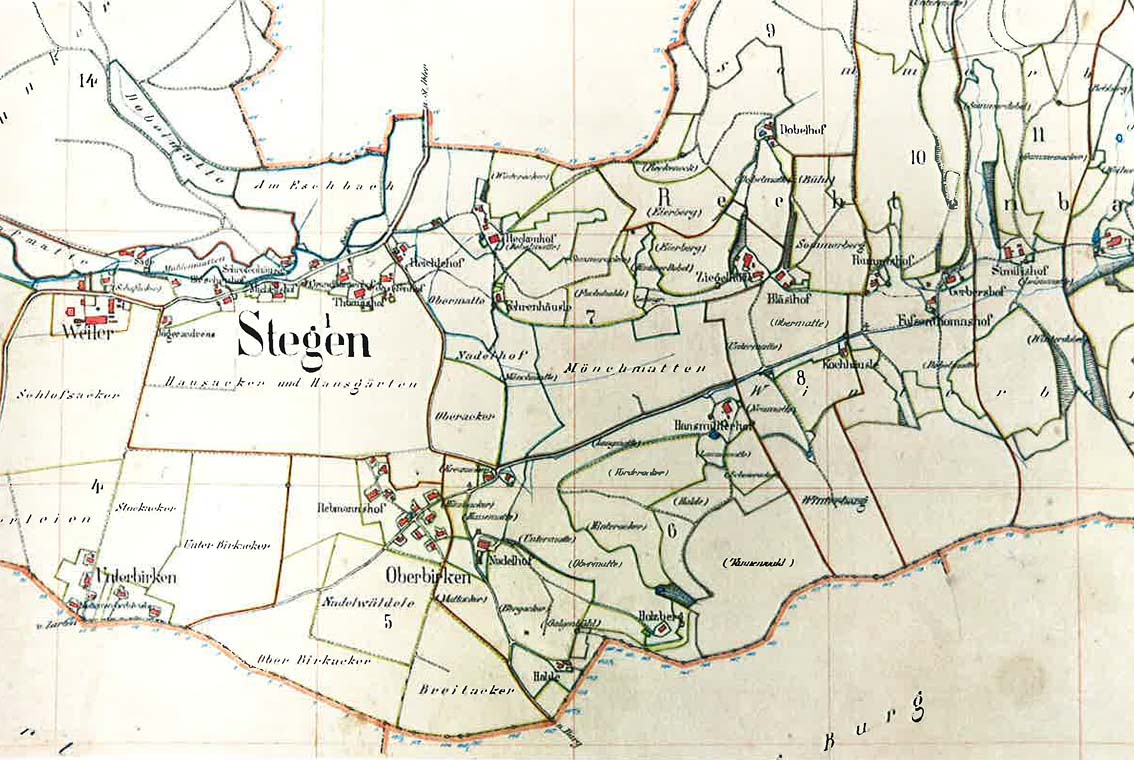
|
| Lageplan Stegen anno 1890 |

|
Die ehemalige Grundherrschaft Weiler
hatte der gräflichen Familie von Kageneck in Stegen umfangreichen
Grundbesitz in die Hand verschafft. Über die Lindenbergkapelle, die
St.Sebastianskapelle in Stegen und die Pfarrkirche in Eschbach war die
Familie traditionell sehr religiös orientiert und kirchenfreundlich
eingestellt. Sie ermöglichte so auch die Einrichtung einer
ursprünglichen Missionsschule, aus der dann das heutige Kolleg
St.Sebastian hervorging.
Durch preisgünstige Übertragung auf die Gemeinde und an mehrere
Bauträger für öffentlichen Wohnbau konnte in kurzer Zeit eine gewaltige
bauliche Entwicklung in Stegen vollendet werden. Gräfin Gertrud von
Kageneck hatte als Witwe des 1957 verunglückten Grafen Heinrich im Jahr
ihren Grundbesitz abgetreten.
|
In Eschbach haben diese
früheren Grundherren und Großgrundbesitzer auf
dem Friedhof mit einem bescheidenen Grabmal an der Umfassungsmauer ein
ehrendes Gedenken gefunden.
Bauland und Erschließung
Der 2. Weltkrieg hatte 1945 durch Zerstörung und durch die nachfolgende
Zuwanderung vieler Heimatvertriebener einen großem Wohnungsbedarf
hinterlassen. Der wirtschaftliche Aufschwung im Anschluß an die
Währungsreform 1948 hatte mit dem sogenannten Wirtschaftswunder deshalb
auch vielerorts zu verstärktem Wohnungsbau geführt.
Im Raum Freiburg ergab sich durch mehrere günstige Umstände, durch
Bereitstellung von Bauland in Stegen die Grundlage für eine stürmische
Wohnbauentwicklung. Die Familie der Grafen von Kageneck hatte aus der
früheren Grundherrschaft Weiler in Stegen ausgedehnten Grundbesitz im
ebenen Gelände zwischen Kirchzarten und Stegen als ideale Voraussetzung
für Bautätigkeit. Dieses Gebiet konnte um 1968 aus einer Hand für eine
Bebauung gewonnen werden, wobei aber nicht die Gemeinde, sondern
verschiedene Bauträger den Bebauungsplan und die Erschließung zu
bewerkstelligen hatten.
Nach dem Tod des Grafen Heinrich von Kageneck 1957 hatte sich die Witwe
Gräfin Gertrud von Kageneck dazu entschlossen, ihre Ländereien
abzutreten. Teile davon kamen geschenkt in Besitz der Gemeinde. Der
größte Teil wurde kostengünstig an folgende Bauträger
abgegeben:
1. Im Gewann Großacker in Stegen
a) „Familienheim“ Freiburg mit 270,06
b) Interessengemeinschaft Teppichbau Freiburg 115,74
c) Land Baden-Württemberg (OFD) 50,14
d) Gräfin von Kageneck, Stegen 84,19
e) Verein bad. Taubstumme e.V. Heidelberg 35,41
2. Im Gewann Schloßacker
a) Wohnstättenbau Freiburg eGmbH 110,09
b) Massiv-Hausbau GmbH, Freiburg 341,14
3. Im Gewann Jägerandreas
a) Hausbau Wüstenrot, Ludwigsburg 131,70
b) die Gemeinde Stegen für die übrigen Bauflächen
4. Im Gebiet der Staatl. Gehörlosenschule
a) das Land Baden-Württemberg für die Staatl. Gehörlosenschule
b) die Gemeinde Stegen für Alt-Stegen und St.Sebastian
Die Erschließung
Die Erschließung der verschiedenen Gewanne als Baugelände wurde von der
Wohnstättenbau Freiburg als Generalunternehmer übernommen.
Dabei handelte es sich um :
a) einen Hauptkanal Stegen/Ebnet
b) Vorflutleitungen außerhalb der Baugebiete
c) Flächenermittlungen
d) Wasserversorgung
e) Gehwegherstellung an festgelegten Straßen
Die Kanalisation im Gewann Großacker wurde vom Ingenieurbüro Hagen
& Gramer durchgeführt mit einem Kostenaufwand von 363.216.- DM
Für den Straßenbau mußten statt dem ursprünglichen Kostenvoranschlag
von 340.000 DM jedoch 400.000 DM aufgebracht werden.
Die Dringlichkeit des Wohnbedarfs und das Drängen auf zügigen Ausbau
der projektierten Wohnanlagen durch die kaufmännisch orientierte
Planung der Baugesellschaften verhinderte eine weitsichtige kommunale
Raumplanung, die dann erst durch die Gemeindereform in
Baden-Württemberg 1974 sinnvoll möglich wurde und mit dem Entstehen der
heutigen Gemeinde im Zusammenschluß mit Wittental und Eschbach eine
endgültige Orientierung erhielt.
Die Wohnbaugesellschaften gestattete den einzelnen Bauherren der
Doppel- und Reihenhäuser mit ihren Standardtypen nur wenig individuelle
Gestaltungsmöglichkeit bei der Raumaufteilung und Bauausführung.
„Sommerberg“ und „Hirzberg“ waren beispielsweise die Namen der
Standardtypen damaliger Doppelhäuser.
Der Gesamteindruck der Gebäude der Wohnstättenbau und Massiv-Hausbau im
Gewann Schloßacker und Ringstraße mit den straßenseitigen Garagenreihen
macht daher eher einen kasernenartigen Eindruck als den einer
freundlichen Wohngegend. Die später unter Mitwirkung der Gemeinde
erstellten Bebauungspläne in Oberleien, Schauinslandstraße und
Stockacker zeigen ein anderes Gesicht.
Die ursprünglichen Bebauungspläne haben sich verschiedentlich geändert,
weil anfänglich auch noch der Bau einer projektierten neuen Straße über
das Steurental nach St.Peter das Gebiet des Großackers berührt hätte.
Fotos vom Modell einer vorausgehenden Planung sind davon noch vorhanden
im Archiv der Gemeinde Stegen (GA-St 2 - 294).

|
 |
Schloß Weiler
Das früher herrschaftliche Schloß Weiler der Grafen von Kageneck in
Stegen von zwei verschiedenen Bildern in ähnlicher Perspektive, Links
das Schloß vor 1959.
(Foto im Gemeindearchiv, Datum unbekannt) Rechts das Schloß Weiler im
Jahr 1974 nach den Neubauten der Pfarrkirche Herz Jesu 1959 und des
Gymnasiums 1965. (Foto Fridolin Hensler, Kirchzarten C - 3 -1974 Nr.
72) |
Das Volumen der Bauvorhaben 1969 bis 1974
Die gesamt großflächige Bauentwicklung in Stegen um 1970 erstreckte
sich auf vier verschiedene Baugebiete:
1. Gewann Großacker ( Weilerstraße u. Ringstraße)
2. Gewann Schloßacker (Am Schlosspark, Im Großacker u. Kageneckstraße)
3. Gewann Jägerandreas (Jägerstraße, Andreasstraße)
4. Gebiet der Staat. Gehörlosenschule (Erwin Kern-Straße)
Im Zusammenhang mit der Erschließung und der damit verbundenen
Kostenverteilung wurde an Hand des Bebauungsplanes das Bauvolumen der
verschiedenen Bauträger (in Form von Wohnungseinheiten) und die dabei
zu erwartende Bewohnerzahl errechnet.
Wohnungseinheiten Personenzahl
1. Wohnstättenbau, Freiburg
38 133
2. Massiv-Hausbau, Freiburg
119 416
3. Familienheim, Freiburg
130 455
4. Hausbau Wüstenrot, Ludwigsburg
28 98
5. OFD Freiburg, für Wohnungsbauten
31 108
6. IG Teppichbau, Freiburg (OFD)
22 77
7. Gräfin v. Kageneck, Stegen
10 35
8. Verein bad. Taubstumme e.V. Heidelberg 22
77
400 1400
Hinzu kommt die Gemeinde Stegen mit Alt-Stegen
einschl. St.Sebastian-Kollegium mit
800
Staatl. Gehörlosenschule (OFD) Vermutlich
700
Geschätzte Zahl der Bewohner bis zum Jahr 1974 3.200
Pers.
Bebauungspläne Stegen im Modellbau um 1968
Über die Zusammenarbeit und Entwicklung der dann maßgeblichen
Bebauungspläne zwischen den verschiedenen Bauträgern und den zeitlichen
Rahmen bin ich nicht informiert. Die Gemeinde Stegen hatte dabei nur
beschränkte Möglichkeit der Mitsprache. Entsprechende Unterlagen sind
nicht in den Gemeindeunterlagen.
Die im Gemeindearchiv vorhandenen Fotos zeigen aber unterschiedliche
vorausgegangene Pläne. Nachfolgend nun einige Modellansichten zur
baulichen Entwicklung in den Gewannen Großmatte mit der
Gehörlosenschule, Großacker, Schloßacker und Jägerandreas.
Untenstehendes Modellfoto (im Besitz von F. Hensler) wurde im
Postkartenformat im Zusammenhang mit Werbeunterlagen der Massiv-Hausbau
1968 verbreitet mit einer völlig anderen Anordnung der niederen
Bungalowbauten und der mehrgeschossigen Häuser.
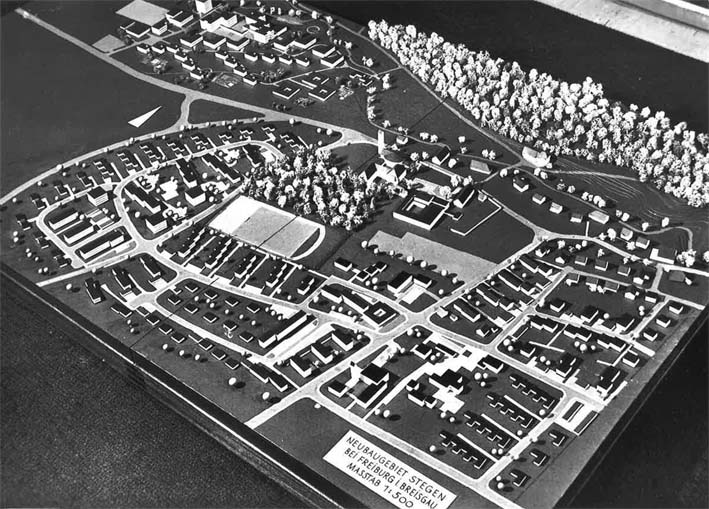
Der Bau der Staatlichen Gehörlosenschule
Oben das Modell der Gehörlosenschule im Bebauungsplan. (GA - ST 2 -
294) .
Unten ein Foto während der Bauzeit im Juli 1970. Der anfängliche
Entwurf scheint sich durchgesetzt zu haben.
Foto Fridolin Hensler VII - 50 - 1970 (O15)
Im Rahmen der Bauplanung standen verschiedene Modelle zur Debatte wie
hier beide Fotos (GA - ST2 - 294) 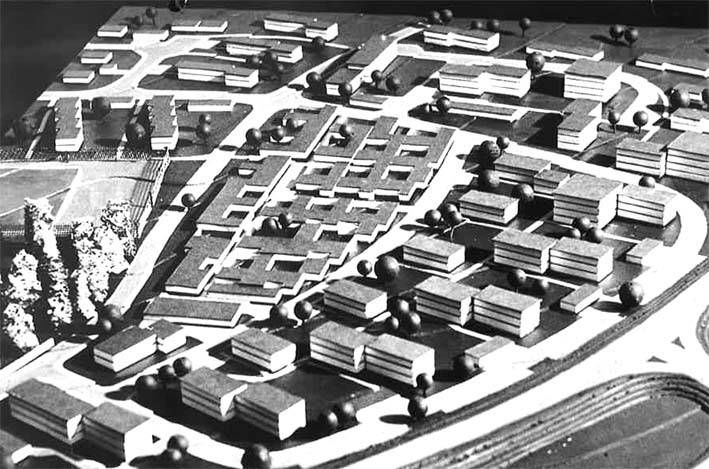
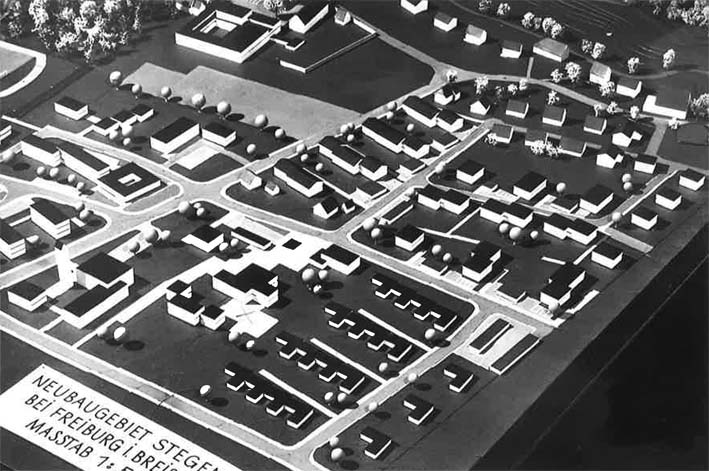
Lageplan der Baugrundstücke Weilerstraße und Ringstraße
Die Bauplätze der Wohnstättenbau und der Massivhausbau sind mit Nummern
der Bauträger bezeichnet. Die Straßennamen und die einzelnen
Hausnummern wurden zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt.
Auf dem unten als Foto des Originals in A 4 vorliegenden Lageplan ist
ein Grundstück mit der Ziffer 19 mit grünem Rahmen gekennzeichnet.
Dieses Baugrundstück ist im Grundbuchamt Stegen als Flurstück Nr.162
eingetragen. Die Grundstückgröße ist ebenfalls im Lageplan mit 411 qm
vermerkt.
Das darauf errichtete Wohngebäude als halbes Doppelhaus wurde im
Oktober 1970 von Familie Fridolin Hensler bezogen und ist heute das
Gebäude Ringstraße 17.
Großbaustelle Gehörlosenschule 1969/70
Der staatlich geförderte Neubau einer Gehörlosenschule hat die
Erschließung von Bauland und die bauliche Entwicklung in Stegen sehr
beschleunigt. Sowohl die traditionsreiche Gehörlosenschule in Waldshut
als auch die 1961 entstandene Schwerhörigenschule in Waldkirch waren
als Provisorien gedacht und in äußerst schwierigen Gebäulichkeiten
untergebracht. Die Zusammenlegung beider Schulen in Stegen war seit
längerer Zeit gefordert und geplant. Die Probleme der langwierigen
Raumplanung für eine moderne Schule mit Internat sollen hier nicht
ausgeführt werden. Als die Bauplatzfrage und die Planung abgeschlossen
war, wurde im Herbst 1968 mit den Erdarbeiten begonnen.

|
Das vorliegende Foto wurde von der Zartener Straße bei Oberleien her,
mit Blick in Richtung Wittental auf das Gelände des heutigen
Bildungszentrums aufgenommen.
Am 30. Oktober 1968.(Foto als Dia F.
Hensler) |
Im folgenden Jahr gingen die Erschließung und die Bauarbeiten zügig
voran. Das Großprojekt war in 3 Bauabschnitten geplant. Mit dem ersten
Bauabschnitt wurde neben zwei Schulgebäuden auch mehrere der
zweigeschossigen Internatshäuser‚ die Verwaltung, die Küche und die
Sporthalle mit Schwimmbad und ein Personalhochhaus fertiggestellt. Zum
Richtfest am 3. Oktober 1969 waren nicht nur die Bauhandwerker mit den
Bauherren vom Kultusministerium und dem Staatl. Hochbauamt, sondern
auch Schüler mit ihren Lehrern aus Waldshut und Waldkirch angereist.
Ein Jahr später konnte am 1. Oktober 1970 der Unterricht in der Staatl.
Schwerhörigen- und Gehörlosenschule in Stegen aufgenommen werden. Für
die Lehrkräfte war seinerzeit in Stegen kein Wohnraum verfügbar. Sie
suchten im Umland eine Wohnung oder entschlossen sich zum Bau eines
Hauses im Angebot der Wohnbaugesellschaften‚ die in Stegen tätig waren
oder in den Nachbarorten wie beispielsweise in Eschbach oder Ibental.
Einige Lehrkräfte blieben in Freiburg oder siedelten sich dort an. Um
1970 war landesweit überall rege Bautätigkeit. Der Bau der
Gehörlosenschule wurde aber staatlicherseits mit höchster Dringlichkeit
vorangetrieben. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts mit der
nötigen Infrastruktur wurde auf 1. Oktober 1970 bestimmt und die
Umzugsvorbereitungen der Gehörlosenschule in Waldshut und der
Schwerhörigenschule in Waldkirch liefen im Sommer 1970 auf vollen
Touren.
Die unten stehende Luftaufnahme wurde im Juli 1970 von Fridolin Hensler
als Dia aufgenommen und befindet sich jetzt im Gemeindearchiv in Stegen.

Die weiteren noch fälligen Bauarbeiten für den 2. Bauabschnitt mit
einem Schulhaus und mehreren Internatsgebäuden und danach der Bau der
drei Bungalows für den Kindergarten nahmen bis zur Fertigstellung 3
Jahre in Anspruch. Erst danach konnten großflächige Außenanlagen
gestaltet werden, die das Gelände des heutigen Bildungs- und
Beratungszentrums als Parkanlage erscheinen lassen.

Das Gewann, während der Bebauung um 1968 als „Schloßacker“ bezeichnet,
ist auf dem obigen Foto des Lageplans der Gemeinde Stegen von 1890 als
„Hausacker und Hausgärten“ eingetragen. Heute ist es das Gebiet der
Weilerstraße und Ringstraße. In diesem Gebiet waren seinerzeit keine
festen Wege vorhanden wie auf obigem Foto des Lageplans zu sehen ist.
(Foto F. Hensler im Vermessungsamt)
Das unten stehende Foto zeigt den Plan für die Erschließung des
Geländes mit Straßen und Fußwegen in den Neubaugebieten‚ auch im Gewann
Großacker und Jägerandreas. Dieser Lageplan um 1969 ist im
Gemeindearchiv Stegen (GA - ST 2 - 294).
Erschließung und Erdarbeiten in der Ringstraße
Im zeitigen Frühjahr 1969 wurden in Stegen umfangreiche Erschließungs-
und Erdarbeiten im Gebiet der Ringstraße durchgeführt. Das Vorliegende
Foto von Fridolin Hensler entstand im Frühjahr 1969 vom Baugrundstück
des Hauses Ringstr. 17 in Richtung Ringstraße und Rechtenbach. Die
Hänge im Rechtenbachtal sind noch schneebedeckt.
Auf dem Rohbau des Hauses Ringstr. 13 ist bereits das Dach gedeckt.
Über dem abgestellten Pkw ist das Gebäude der Volksschule Stegen
erkennbar.
Am linken Bildrand ist ein aus abgehobenem Humus errichteter Wall zu
sehen, der zwischen der Hausreihe Weilerstraße 16 und Ringstraße 17
aufgeschichtet war und später für die Gartenanlagen der umliegenden
Häuser nach der Planierung des Geländes Verwendung fand.
Dieser Erdwall und das umliegende Baugelände wurde dann zum beliebten
Abenteuerspielplatz der Kinder nach dem Einzug der ersten Familien in
der Ringstraße. Dort waren schon 1969 die ersten Bewohner mit Kindern
eingezogen.
Baugebiet Schloßacker 1968
Das Gewann Schloßacker zwischen der heutigen Kirchzartener Straße und
der Zartener Straße ist auf dem Lageplan des Vermessungsamtes im Atlas
der Gemeinde Stegen 1890 mit Lgb. Nr. 40 ein großflächiges Areal, das
nicht parzelliert ist. Es ist als ebenes herrschaftliches Gelände mit
guter Bodenbeschaffenheit für landwirtschaftliche Bewirtschaftung
bestens geeignet und wurde seit langer Zeit als Ackerland genutzt.
Der Grundstückverkauf an die Wohnbaugesellschaften erfolgte am 17. Dez.
1964. Dabei wird als Verkäufer Herr Alfred Graf von Kageneck,
Gutsbesitzer in Munzingen genannt. Die besitzrechtlichen Verhältnisse
der Familie von K. sind mir nicht bekannt. In Stegen wurde Gertrud
Gräfin von K. als Besitzerin betrachtet. Nach diesem Grundstücksverkauf
von (6 ha 23 a 85 qm) der Grafenfamilie an die Wohngesellschaften
Massiv-Hausbau und Wohnstättenbau lag das Gelände einige Zeit brach.
Das Baugelände wurde nun im Grundbuch mit Lgb. Nr. 40/3 bezeichnet.
Auf dem vorliegenden Foto, das am 30. Oktober 1968 entstand mit Blick
von der Kirchzartener Straße auf das Gebiet der Ringstraße haben die
Maurerarbeiten neben einem dort aufgestellten Zementsilo am
Bungalowneubau Haus Ringstr. Nr.13 (Müller) bereits begonnen. Das
übrige Gelände ist noch Brachland.
Der Fortschritt der Bebauung war vom Verkauf der parzellierten
Bauplätze und deren neuen Besitzern abhängig. Das Baugrundstück des
Hauses Ringstraße 17 wurde im Oktober 1968 erworben. Im Oktober 1970
war das Haus verputzt und bezugsfertig. Gehwege, Garagen und Parkplätze
wurden nachträglich fertiggestellt. Die Außenanlagen wurden von den
jeweiligen Eigentümern gestaltet.
 |

|
Neubaugebiet Schloßacker - Großacker im Juli 1970
(Luftbild Fridolin Hensler Dia 60/02 d im Gemeindearchiv) |
Luftaufnahme vom Gebiet Weilerstraße und
Ringstraße 1970
(Dia 60/02 d im Gemeindearchiv)
|
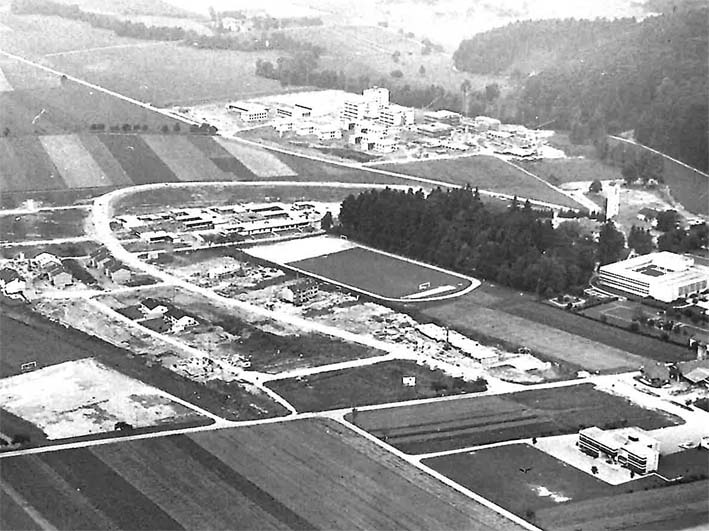
|
| Weilerstraße - Ringstraße 1970 (Luftbild F. Hensler VII - 50 -1970 (016) |
Im Juli 1970 entstand das vorliegende obige Foto. In der Weilerstraße
sind mehrere Gebäude im Rohbau sichtbar. In der Ringstraße sind mehrere
Gebäude bereits bezogen oder bezugsfertig.
In der Gehörlosenschule sind fertige Schulgebäude, Internatsbauten‚ die
Verwaltung mit Küchengebäude, die Turn- und Schwimmhalle und das
Personalhochhaus bezugsbereit. Im Vordergrund das noch unbebaute
Gelände neben der Volksschule, auf dem später das Rathaus, das
Ökonomische Zentrum und die Mehrzweckhalle der Gemeinde zu stehen kam.
Das Gelände der späteren Friedhoferweiterung ist noch
landwirtschaftlich genutzt. Zwei Bungalowbauten in der Ringstraße
zeigen bereits eine fertige Gartenanlage. Auf dem gemeindeeigenen
Sportplatz sind die Torpfosten für Fußballspiel zu erkennen.
Großbaustelle Stegen 1970 aus Richtung Wittental (Foto Fridolin Hensler
VII — 50 — 1970 (018)
Auf dem Luftbild vom Juli 1970 ist das ausgedehnte geplante und bereits
erschlossene Baugebiet in Stegen abgebildet. Am oberen Bildrand sind
die noch unbebauten kleinparzellierten Flurstücke erkennbar, die
weiterhin landwirtschaftlich genutzt werden.
An der Zartener Straße zwischen Stegen und Unterbirken ist der
gemeindeeigene Sportplatz noch ohne vereinseigene Bauten, die in den
folgenden Jahren dazu kamen, dann aber bald einer späteren Bebauung mit
der Schauinslandstraße weichen mußten.
Vom ersten Bauabschnitt der Gehörlosenschule sind die zweigeschossigen
Internatsbauten zu sehen, die bereits fertiggestellt und dann im
Oktober 1970 bezogen wurden. Auch eine größere Zahl von Bungalowbauten
der IG Teppichbau sind schon errichtet. Außer Volksschule mit Turnhalle
gibt es im Gebiet des heutigen Gemeindezentrums noch keine anderen
Bauten.
Baugebiet Stegen 1971
Das Jahr 1971 war vermutlich das Jahr mit der stärksten Bautätigkeit
und zugleich verbunden mit dem Zuzug vieler Neubürger in Stegen. Auf
dem Luftbild vom Sommer 1971 sind bereits bewohnte Häuser in der
Ringstraße mit fertigen Außenanlagen erkennbar. Die beiden
viergeschossigen Hochhäuser im Großacker sind im Rohbau.
Die Doppelhausbauten in der Jägerstraße und die Reihenhäuser in der
Andreasstraße sind im Rohbau fertig und bereits mit Ziegeln gedeckt.
Das Baugelände für das neue Rathaus ist noch völlig unberührt. Der
Gemeindesportplatz mit Hartplatz und Rasenplatz ist in Betrieb
genommen. Die Bungalowbauten der IG Teppichbau sind größtenteils
vollendet.
Im Großacker ist eine große Fläche noch ohne erkennbare Baumaßnahmen.
Auch das Gelände des Vereins für badische Taubstumme ist noch
unberührt.
Luftbild Fridolin Hensler VII — 61 — 1971 (O31) im Gemeindearchiv
Siedlungsbild der Ortsdurchfahrt in Stegen
In den Baugebieten Großacker und Schloßacker ergab die rege
Bautätigkeit in den Jahren 1969 - 1974 ein völlig neues Siedlungsbild
neben den bestehenden bäuerlichen Gehöften entlang der Durchgangsstraße
in früherer Zeit.
Das unten befindliche Luftbild im Sommer 1974 (von F. Hensler C 04 —
1974 (03 6) zeigt den Häuserbestand an der Ortsdurchfahrt in Stegen.
Zwischen Gasthaus Hirschen und Reichlehof sind während der anderweitig
stürmischen Bauentwicklung in der Zeit von 1950 bis 1974 nur wenige
Neubauten als Einfamilienhäuser parallel zur Ortsdurchfahrt entstanden.
In den nachfolgenden Jahren hat sich auch in diesem Bereich die
Bebauung weiter verdichtet und den früheren bäuerlichen Dorfcharakter
Stegens mit dem Bau eines Kreisverkehrs an der Einmündung der
Kirchzartener Straße endgültig verschwinden lassen.

|
 |
| Renault-Werkstatt, altes Schulhaus und Reichlehof Foto F. Hensler C- O6
— 1974 — (O17) |
Durchgangsstraße in Stegen 1974
Josefenhof, Thomashof, Grundhansenhof Foto F. Hensler C — 06 — 1974
(O15) |
Von der Taubstummenanstalt zur Gehörlosenschule
Die Bezeichnung taubstumm ist nicht genau zu definieren. Von Geburt an
taube Menschen, die auf Grund des fehlenden Gehörs die Sprache ihrer
Umgebung nicht sprechen lernten oder Schwerhörige, die nur geringe
Sprachkompetenz aufwiesen wie auch Menschen, die wegen geistiger
Behinderung sich nur ungenügend sprachlich äußern konnten, wurden in
früherer Zeit als „Taubstumme“ bezeichnet. Die sprachliche Behinderung
wurde als Intelligenzmangel angesehen. Taubstumme wurden lange Zeit als
bildungsunfähig betrachtet und blieben gesellschaftlich isoliert.
Die Erkenntnis, daß taube Menschen bildungsfähig sind und über
Gebärden, Bilder und Schrift und spezielle Schulung auch mit speziellem
Unterricht in Verbindung mit Mundablesen zur Lautsprache geführt werden
können, hatte sich an Einzelbeispielen im 18. Jahrhundert erwiesen.
Mit der allgemeinen Schulpflicht wurde auch die schulische Betreuung
taubstummer Kinder in die Wege geleitet. Im Großherzogtum Baden wurde
1826 in Pforzheim in Verbindung mit einem Arbeitshaus ein erste
schulische Einrichtung geschaffen, die dann 1865 nach Meersburg verlegt
wurde und die Bezeichnung „Taubstummenanstalt“ erhielt. Dort konnten
bis 1937 taube und stark hörgeschädigte Kinder als Internatsschüler in
Meersburg eine auf Schrift und Mundablesen aufgebaute Lautsprache und
Schulbildung erhalten, die sie zum Erlernen und Ausübung einfacher
Berufe befähigte.
Schuhmacher, Korbmacher und Schneider waren bei vorhandener Taubheit
für die Buben ein Berufsziel. Mädchen hatten vor allem als Näherinnen
und in der Hauswirtschaft eine Möglichkeit für ihren Lebensunterhalt.
Viele Taubstumme verdienten auch als Knecht oder Magd ihren
Lebensunterhalt in landwirtschaftlichen Familienbetrieben, als die
Landwirtschaft noch die allgemeine Lebensgrundlage bildete.
Die frühere Taubstummenanstalt in Meersburg, aus der viele
lebenstüchtige Menschen hervorgingen, wurde 1937 aus politischen
Gründen der Rassenideologie im Nationalsozialismus geschlossen. In
einem Klostergebäude in Gengenbach konnte 1939 dann eine neue „Anstalt“
für die hörgeschädigten Schüler eröffnet werden, als der 2. Weltkrieg
schon seine Schatten vorauswarf und dann auch kaum mehr Möglichkeit
einer geordneten Schulbildung ließ. Kriegsbedingt erfolgte in
Gengenbach die endgültige Schließung schon im Frühjahr 1944. Nach
Kriegsende 1945 beanspruchte das neue entstandene Land Baden die
Gebäulichkeiten des früheren Klostergebäudes in Gengenbach für die
Ausbildung von Lehrerinnen.
Ehemalige Taubstummenlehrer in Verbindung mit Eltern von
hörgeschädigten Schulkindern in Südbaden drängten auf eine geeignete
Möglichkeit der Schulbildung. In Nordbaden war in Heidelberg die
dortige Taubstummenanstalt nach dem 2. Weltkrieg als „Gehörlosenschule“
geöffnet worden. Für Hörgeschädigte, aber nicht mehrfach Behinderte
wurde 1948 nun statt der ungenauen und negativ belasteten Bezeichnung
„Taubstummenanstalt“ die im Schloß Hohenlupfen in Stühlingen
eingerichtete Schule entsprechend als „Staatliche Gehörlosenschule“
bezeichnet. Die räumlichen Verhältnisse und die Einrichtung des
Schlosses als Internatsschule waren jedoch denkbar bescheiden und
anspruchslos.
Nicht nur das Mobiliar, auch die Verpflegung war zu jener Zeit der
Lebensmittelbewirtschaftung sehr dürftig. Der angrenzende Garten wurde
deshalb für die Schule durch den Hausmeister unter Mithilfe der Schüler
intensiv für Gemüseanbau genutzt. Mit nur wenigen Schülern hatte 1948
in Stühlingen zuerst der Unterricht begonnen. Rasch wuchs die
Schülerzahl. Viele Kinder waren überaltert und konnten als Folge des
Krieges erst im Alter von 10 Jahren oder noch älter eingeschult werden.
Das Schloßgebäude wurde aber bald aus bautechnischer Vorsicht auf 65
Schüler begrenzt. Deshalb mußten zu jener Zeit zahlreiche Schüler aus
Südbaden die Gehörlosenschule in Heidelberg besuchen.
Die Schüler der Gehörlosenschule Stühlingen konnten nur während der
Schulferien zu ihren Familien fahren. Unterrichtszeit war Montag bis
Samstag. Die außerschulische Betreuung im Internat an den Wochenenden
war teilweise auch eine Aufgabe der Lehrer. Eine öffentliche
Verkehrsanbindung gab es nur mit der Eisenbahn mit dem Bahnhof in
Stühlingen, der etwa 2 km entfernt mit einem Höhenunterschied von 100 m
zu erreichen war. Öffentlicher Personenverkehr zum Schloß Hohenlupfen
war nicht vorhanden. Niemand von der Lehrerschaft oder vom Personal
hatte ein Motorfahrzeug. Die Lehrer wohnten im Schloß getrennt von
ihrer Familie, weil es in Stühlingen keine freien Wohnungen gab.
Im Jahr 1951 wurde in der Gehörlosenschule in Stühlingen das 125
jährige Jubiläum der Taubstummenbildung gefeiert und zu diesem Anlaß
eine Festschrift als „Denkschrift“ zusammengestellt. Darin wurde
rückblickend auf die fruchtbare Arbeit der Vergangenheit hingewiesen,
aber auch eine düstere Perspektive für die Zukunft gezeichnet.
Erklärtes Ziel der künftigen schulischen Bildung war der Neubau einer
Schule, nach Möglichkeit zentral gelegen, im Raum Freiburg. Direktor
Wilhelm Eck äußerte sich 1951 in der Festschrift wie folgt:
„Ein geeignetes Gebäude, wie es Herr Staatspräsident und
Unterrichtsminister Wohleb in dankenswerter Weise in Aussicht gestellt
hat, ist eine dringende Notwendigkeit. Das Ziel lag aber noch in weiter
Ferne und nach dem Zusammenschluß der Länder zum neuen Land
„Baden-Württemberg“ 1953 brauchte es viel Zeit, um die schulischen
Bedürfnisse der Hörgeschädigten ins politische Bewußtsein zu bringen.
Die Gehörlosenschule in Stühlingen war als Provisorium gedacht, aber
der Neubau einer Schule war noch 1955 aussichtslos. Eine Verbesserung
bot sich, als die Landespolizeischule von Waldshut nach Freiburg
umziehen konnte und dadurch in Waldshut das verlassene Gebäude, zuerst
als Fabrikgebäude, dann als Polizeikaserne und Wehrbezirkskommando
genutzt, frei geworden war. Das Staatliche Hochbauamt wurde beauftragt
mit dem Umbau zu einem tauglichen Schulgebäude.
Doch Staatliche Finanzmittel waren knapp und die Planung zögerlich.
Durch Lobbyarbeit von Lehrern und Eltern hörgeschädigter Kinder konnte
die Verlegung der Gehörlosenschule von Stühlingen nach Waldshut
schließlich doch bewirkt werden. Im Herbst 1955 war der Umzug der
Gehörlosenschule von Stühlingen nach Waldshut. Das eigentliche Ziel
aber war der Neubau einer Schule im Raum Freiburg.
Die früheren Taubstummenanstalten waren als reine Internatsschulen
bestimmt. Die verkehrsmäßige Anbindung der Gehörlosenschule Waldshut
ermöglichte nun auch den Schulbesuch einiger externer Schüler. Die
räumlichen Verhältnisse waren nun zwar besser, aber doch noch sehr
beschränkt. In der schulischen Arbeit bekam die Entwicklung und
Einführung von Hörgeräten mit der Audiometrie zunehmend mehr an
Bedeutung. In der Gehörlosenschule Stühlingen hatte es noch keine
Hörgeräte gegeben. Im neuen Bundesland Baden-Württemberg wurde im
Bildungswesen nach neuen Wegen gesucht und in vielen Gemeinden
Schulhäuser neu gebaut. In Stegen wurde eine neue Volksschule 1966
fertig gestellt. Auch für das Kolleg St.Sebastian war schon ein
großzügiger Schulbau entstanden bevor der Standort einer neuen
Gehörlosen- und Schwerhörigenschule in Stegen festgelegt war.
Mit dem Beginn der Bauarbeiten 1969 für die Gehörlosenschule in Stegen
wurde das Gebiet zwischen Zarten und Stegen zu einem riesigen Bauhof.
Die Erschließung und Bebauung in kurzer Zeit war nur möglich, weil das
großflächige Gelände aus vormals grundherrschaftlichem Besitz der
Familie von Kageneck in den Besitz von verschiedenen Baugesellschaften
gekommen war. Kommunale Raumplanung blieb dabei allerdings auf der
Strecke. Die nachträgliche Gestaltung des Ortskerns der heutigen
Gemeinde Stegen wurde dadurch wesentlich erschwert.
Von der Gehörlosenschule zum Bildungs- und Beratungszentrum
Schwerhörigen- und Gehörlosenschule in Stegen nach Fertigstellung des
3. Bauabschnitts
mit den Schulkindergärten im Sommer 1974
(Foto
Fridolin Hensler VII — 20 — 1974 Nr. 03)
Als Standort der geplanten
neuen Gehörlosenschule in Stegen war das Gebiet westlich der 1959 neu
erbauten katholischen Pfarrkirche an der früheren Villinger Straße in
Richtung Ebnet durch die Schulbehörde und das Staatliche Hochbauamt
ausgemittelt worden. Die Fertigstellung der Gehörlosen- und
Schwerhörigenschule in Verbindung mit einem Kindergarten für
hörgeschädigte vorschulpflichtige Kinder war in 3 Bauabschnitten
geplant.
Das Richtfest für den ersten Bauabschnitt war am 3. Oktober 1969, zu
dem auch die gehörlosen Schüler aus Waldshut mit Omnibus angereist
waren. Am 1. Oktober 1970 wurde der Unterricht in der Staatlichen
Gehörlosenschule in Stegen aufgenommen. Aus der Schwerhörigenschule in
Waldkirch waren gleichzeitig auch einige Klassen nach Stegen umgezogen.
Die restlichen Klassen der Schwerhörigenschule aus Waldkirch kamen mit
der Vollendung des 2. Bauabschnittes nach Stegen. Die Schulkindergärten
wurden als Bungalows 1973 gebaut. Die Gesamtkosten für den Neubau in
Stegen waren etwa 35 Millionen DM.
Neben den Schulgebäuden waren für die Internatsschüler zweigeschossige
Wohnhäuser mit Gruppenräumen für jeweils bis 16 Schüler gebaut worden.
Neben der Verwaltung war eine Großküche für die Versorgung mit
Mittagessen, das in die Gruppenräume geliefert wurde. Neben einer
Turnhalle und einem Schwimmbad mit Hebeboden darunter. Daneben entstand
auch ein Personalhochhaus‚ an dem sich westwärts der Sportplatz
anschließt.
Die Fortschritte der modernen Medizin unter Verwendung des
Cochlea-Implantats, die Entwicklung der modernen Audiologie und die
Früherfassung und Frühbetreuung hörgeschädigter Kleinkinder hat die
Zahl der früher als „Taubsturnme“ bezeichneten Personen reduziert. Nur
noch mehrfach Behinderte haben dieses Erscheinungsbild.
Die weiter ausgebaute Betreuung hörgeschädigter Schüler führte dann
auch in Stegen zur Einrichtung einer Realschule und einer
Gymnasialabteilung. Die verbesserte Verkehrsanbindung im Großraum
Freiburg führte zu einem zunehmend größeren Anteil externer Schüler.
Der Schulunterricht ist auf die Wochentag Montag bis Freitag verteilt.
Am Freitagnachmittag fahren die meisten Internatsschüler über das
Wochenende nach Hause zu ihren Familien. Entsprechende spezielle
Omnibusverbindungen wurden zu diesem Zweck eingerichtet.
In neuester Zeit werden versuchsweise hörbehinderte Schüler in ihren
Heimatorten in den allgemeinen Schulen unterrichtet mit zusätzlicher
ambulanter Unterstützung von geschulten Lehrkräften. Als Mittelpunkt
dieser neuen Betreuung ist das „Bildungs- und Beratungszentrum für
Hörgeschädigte“ in Stegen heute die Schaltstelle, auch für die
Frühbetreuung und Miteinbeziehung der Elternschaft.
1952 war ich als junger Lehrer an die Staatl. Gehörlosenschule in
Stühlingen gekommen. Nach dem Umzug nach Waldshut 1955 war ich dort bis
zu Verlegung dieser Schule nach Stegen. In Stegen war ich von 1970 bis
1988 als Lehrer in der Abteilung der Gehörlosenschule tätig.
Fridolin Hensler, Kirchzarten
Großacker wird Bauland
Bei der staatlichen Vermessung 1890 war der Großacker mit seiner
gesamten Fläche unter Flurstück Nr. 33 im gräflich Kageneck´schen
Besitz. Ein Teil davon war dann in den Besitz der „Familienheim
Baugenossenschaft“ gekommen, bevor es 1968 um die Aufstellung eines
Bebauungsplanes ging. Um einen Bebauungsplan aufstellen und davon
einzelne Grundstücke als Bauplätze ausweisen zu können, wurde der
Besitz von Frau Gräfin Gertrud von Kageneck und derjenige der
Familienheim Baugenossenschaft zu einer „Gesellschaft des bürgerlichen
Rechts“ vereinigt.
Nach Erstellung des Bebauungsplanes und nach Vermessung der einzelnen
Baugrundstücke, die an die verschiedenen Bauträger gingen, wurde die
zuvor gegründete „Gesellschaft des bürgerlichen Rechts wieder
aufgelöst.
Als Bauträger wurden beim Abschluß dieses Vertragswerkes am 1. Oktober
1968 auf dem Notariat in Freiburg genannt:
1. Frau Getrud Gräfin von Kageneck geb. Lishy, Witwe des Gutsbesitzers
Heinrich Graf von Kageneck in Stegen.
2. Das Land Baden-Württemberg durch das Staatl. Liegenschaftsamt in
Freiburg mit einer Fläche von 55,14 ar
3. Der Verein für badische Taubstumme, vertreten durch Armin Löwe aus
Heidelberg mit einer Fläche von 35, 41 ar
4. Die „Familienheimn gemeinnützige Baugenossenschaft in Freiburg in
Vertretung durch zwei Herren mit einer Fläche von 270, 06 ar
5. Die Interessengemeinschaft Teppichbau vertreten durch Heinz Köllsch
und Arnulf Ochsner mit einer Fläche von 136, 81 ar (Flächenbeitrag
eingeschlossen).
Obiger Vertrag ist im Gemeindearchiv Stegen unter „Grundbuch-Band 2
Heft 10a zu finden.

Stegen am 2. August 2013 Luftbild Fridolin Hensler Nr. 78
IG Teppichbau als Bauträger
In einem Bekanntenkreis von Architekten war um 1965 bei der Suche nach
privaten Bauplätzen im Umland ohne festgelegte Ortsbestimmung gesucht
worden. Dabei ergab sich in Stegen eine günstige Möglichkeit durch die
Gründung einer Interessengemeinschaft als „Gesellschaft des
bürgerlichen Rechts“ für Grundstückserwerb aus dem gräflich
Kageneck'schen Besitz.
Aus diesem Besitz hatte auch das Land Baden-Württemberg bereits
Bauerwartungsland im Gewann Stockacker gekauft für den Neubau einer
Staatlichen Gehörlosen- und Schwerhörigenschule, da die bestehenden
Einrichtungen in ungenügenden Gebäulichkeiten in Waldshut und Waldkirch
untergebracht waren und nach Stegen verlegt werden sollten.
Eine Personengruppe, Ehepaare und Einzelpersonen, vor allem Architekten
unter der Bezeichnung „IG Teppichbau“ war am Kauf von Grundstücken
interessiert, mit erklärter Absicht, eingeschossige Flachdachbauten in
einer unabhängigen, zusammenhängenden Bebauung mit gemeinschaftlicher
Heizfernleitung zu errichten. Auch für die Gehörlosenschule wurde eine
Heizfernleitung geplant, wo durch die weit auseinander liegenden
Gebäude wegen vemachlässigter Isolierung große Energieverluste
auftraten. Als Vertreter bei den juristischen und notariellen
Verhandlungen und Verträgen waren die Herren Heinz Köllsch und Arnulf
Öchsner beteiligt.
Für die Bauten der IG Teppichbau war eine gesonderte Heizfernleitung
mit Ölheizung geplant, die mit Betriebszugehör Gemeinschaftseigentum
war. Zu einem späteren Zeitpunkt wurde diese Heizung dann auf Gas
umgestellt.
Die IG Teppichbau war nach dem ersten Bebauungsmodell im westlichen
Teil des Großackers geplant, wo heute die beiden Hochhäuser der
Baugenossenschaft „Familienheim“ stehen. Eine früher in jenem Bereich
geplante Straßenführung als Ortsumleitung in Richtung St.Peter führte
dann zu einer Verlegung der heute bestehenden Flachbauten zum
Schloßpark.
Die einstöckigen Flachbauten erlaubten eine individuelle
Raumaufteilung, die bei den Bauten der Wohnbaugenossenschaften sehr
eingeschränkt war. Die Bauten der IG Teppichbau wurden zügig in den
Jahren 1970 - 1972 errichtet und trugen in Verbindung mit den Schülern
und dem Personal der Gehörlosenschule zu einer rasch über 1000
steigenden Einwohnerzahl in Stegen bei. Die Bewohner der
Teppichsiedlung hatten aber ihren Arbeitsplatz und die soziale Bindung
fast ausnahmslos in Freiburg.