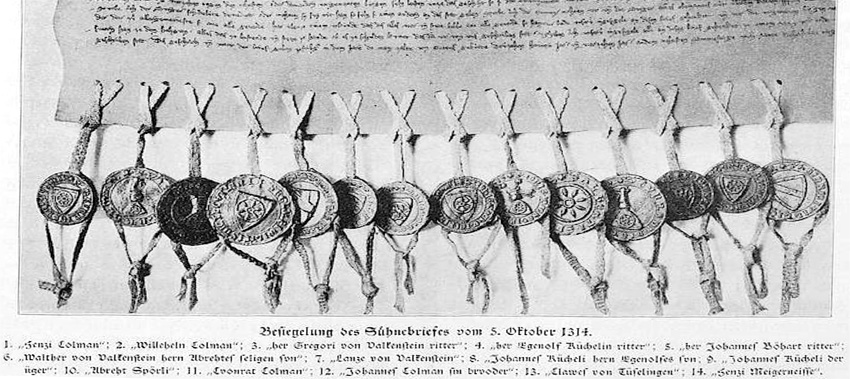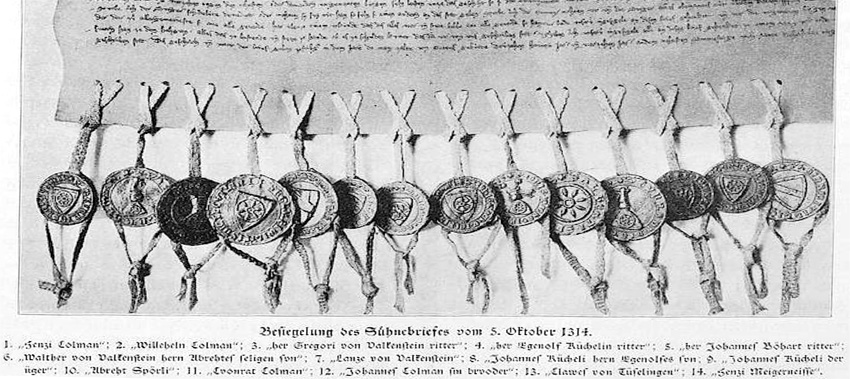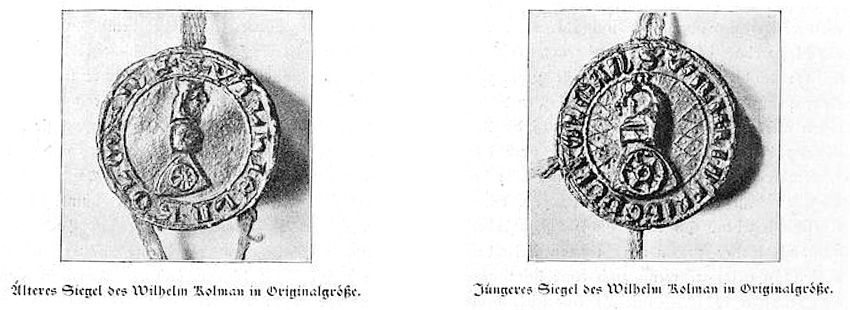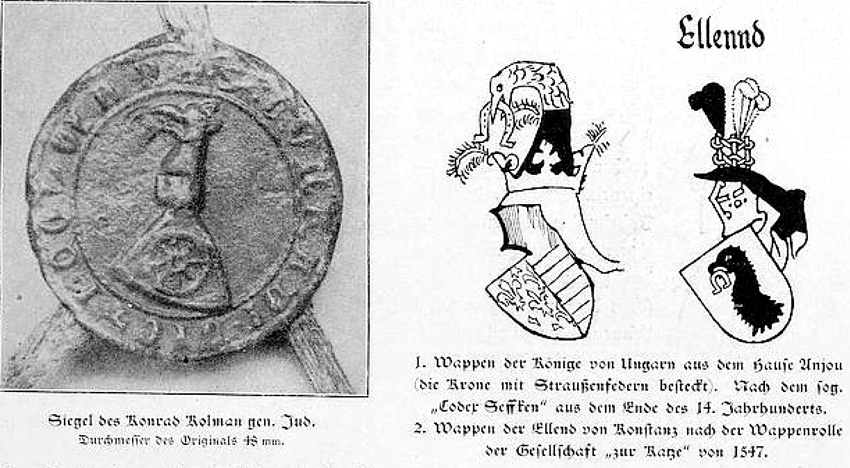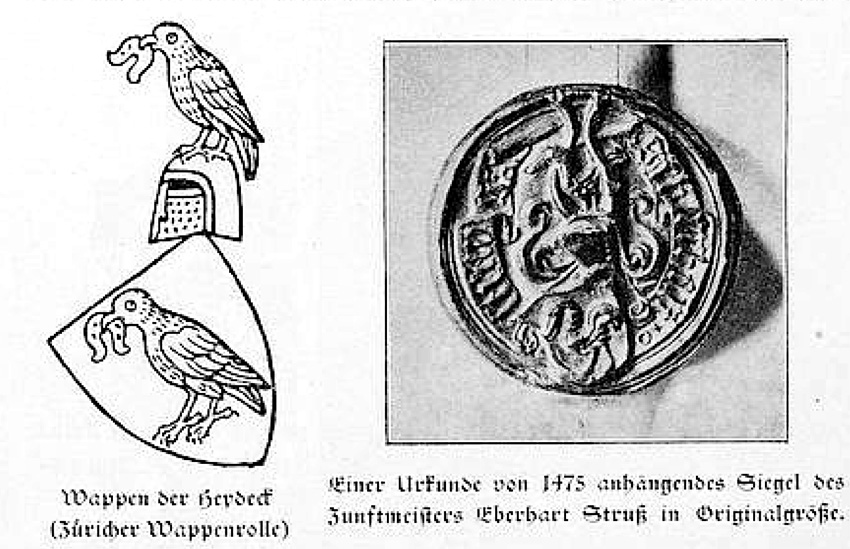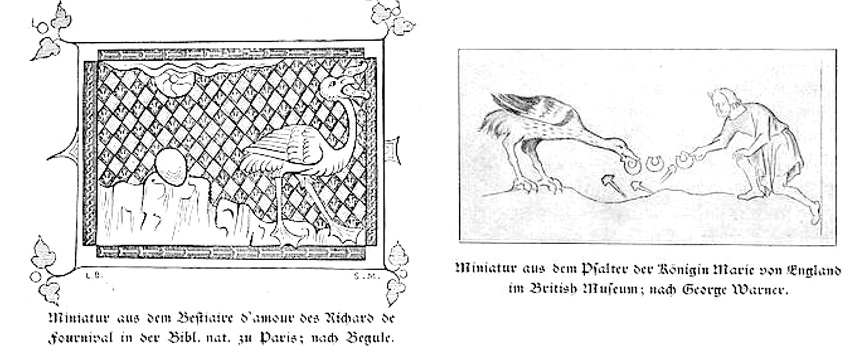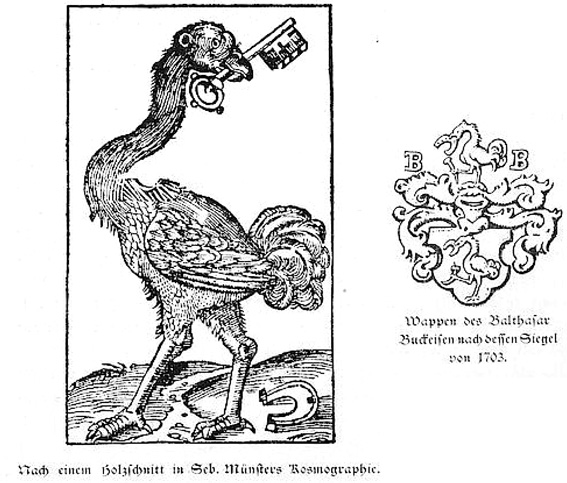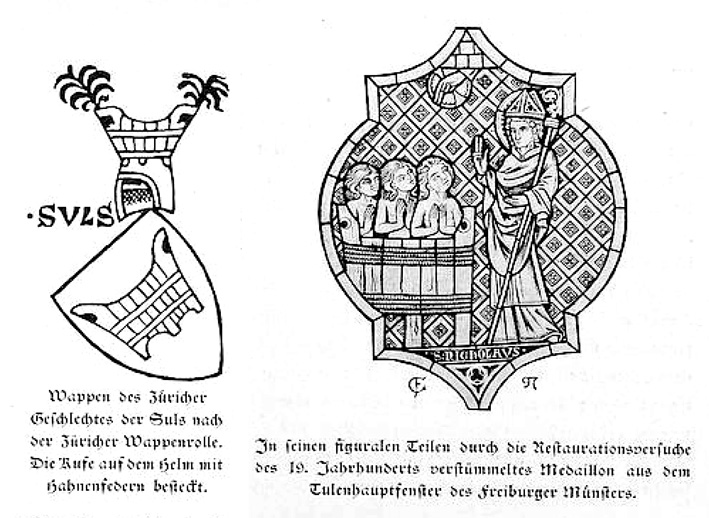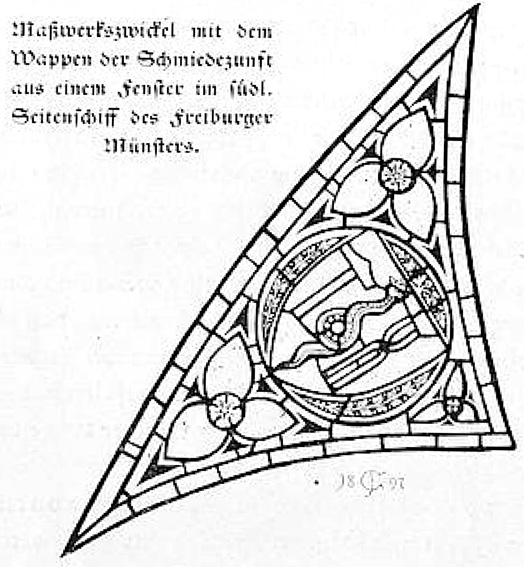Die
letzten Herren der Wilden Schneeburg und ihre Sippe
Eine heimatgeschichtliche kritische Studie
von
Prof. Dr. h.c. Fritz Geiges
in: Schau-ins-Land 1923, Seite 17-42
In seiner zweibändigen Geschichte der Stadt Freiburg i.Br. widmet Jos.
Bader dem Geschlecht der „Schnewelin“ einen besonderen, sieben Seiten
umfassenden Abschnitt. Nach wenigen einleitenden Worten über die alten
Freiburger Geschlechter im allgemeinen und die als Typ derselben
charakterisierten Snewelin im besonderen, berührt er in Kürze deren
Besitzverhältnisse, nennt die Namen der vermeintlichen Verzweigungen
des weitausgebreiteten Geschlechts – Angaben die nicht ganz
übereinstimmen mit den in vorangegangenen Kapiteln geborenen – und
gedenkt sodann mit eigenen Hinweisen der Verdienste, die sie sich um
ihre Vaterstadt erworben, nachdrücklich aber auch ihres übermütigen,
gewalttätigen, zügellosen Treibens, was er in dem Urteil zusammenfaßt,
daß sie die „bösesten Buben“ des ganzen Breisgauer Adels geliefert.
Gleichsam als anschauliche Illustration zu diesem Diktum wendet er sich
dann einer Schilderung der am Hochfarren hinter Oberried gelegenen sog.
wilden Schneeburg und ihrer Besitzer aus dem „Kolmannischen Zweig der
Familie“ zu, die den Hauptinhalt des Kapitels umfaßt.
Die Darstellung ist in der Hauptsache offenkundig ausschließlich aus
Dokumenten geschöpft, die bereits durch H.Schreiber in dessen 1828
erschienenen Freiburger Urkundenbuch veröffentlicht wurden. Was dieser
uns auf Grund derselben in seiner drei Jahrzehnte später
herausgegebenen Stadtgeschichte in Kürze berichtet, entspricht nicht
ganz dem urkundlichen Bilde. Das muß aber auch von dessen Wiedergabe
durch Bader gesagt werden: diese ist nicht nur von verschiedenen
unzutreffenden angaben durchsetzt, sondern vor allem auch nicht völlig
objektiv. Die Tendenz, das den Snewelin ausgestellte abfällige
Leumundszeugnis durch möglichst drastisches Beispiel zu belegen, ist
unverkennbar, sowohl in der Art, wie einzelne Lücken aus der Phantasie
ergänzt sind, als auch in der Verschweigung oder wenigstens
Abschwächung bedeutsamer Bekundungen.
Das ausgebreitete Sündenregister beginnt mit der Mitteilung, daß schon
1302, nachdem die wilde Schneeburg nicht lange zuvor in den Besitz des
Kolmannischen Zweiges der Familie übergegangen, zwei Bürger von
Offenburg und Gengenbach abgefangen und auf der Feste eingekerkert
worden waren. Ob diese damals tatsächlich schon im Besitz der Kolmann
war, steht dahin. Die Urfede, welche beide Städte am 28. April
gedachten Jahres für sich und die Ihren dem die Freilassung der
Gefangenen vermittelnden Freiburg ausstellten, läßt das nicht
erkennen, und ein anderes Dokument über den Vorgang existiert nicht.
Die Vermittlung der Stadt läßt aber auch nicht gerade auf ein
feindseliges Verhältnis derselben zu den ungenannten Tätern schließen,
und da wir andererseits später erfahren, daß die Edelknechte Heinrich
(Henzi) und Wilhelm Kolman seit den Tagen, da sie offenbar in noch
jugendlichem Alter die Burg erwarben, in steter Fehde mit ihrer
Vaterstadt und deren Bundesgenossen lagen, so wird man sich füglich
fragen dürfen, ob die Gewalttat tatsächlich auf das Konto des
Brüderpaares zu buchen ist und nicht vielmehr auf dasjenige der
Vorbesitzer der Burg. Das gelangt übrigens in dem Abschnitt, der von
den Fehden und Kriegen der Stadt handelt, unmittelbar auch in den
Ausführungen Bades zum Ausdruck.
Über die Ursache der andauernde Spenne werden wir nicht unterrichtet.
Solche Dinge waren damals an der Tagesordnung. In einer verwilderten
Zeit, da man allseits leicht geneigt war, die Durchsetzung wirklich
oder vermeintlich berechtigte Ansprüche kurzerhand der eigenen
bewehrten Faust anzuvertrauen, war an Anlass zu gegenseitiger Gewalttat
kein Mangel, und die Städter stunden darin nicht zurück.
Die durch eine unterm 20. Dezember 1312 vollzogene Seelgerettstiftung
ausgeglichen Schädigung, welche das Freiburger Heiliggeistspital zu
Neuershausen durch Wilhelm Kolman erfuhr, war jedenfalls nur eine
minder belangreiche Episode im Verlauf der andauernden Händel, die
schließlich allerdings ernst genug gewesen sein mögen und das
Brüderpaar offenbar nicht auf sich allein gestellt ließen, da sonst die
Stadt sich kaum veranlasst gesehen hätte, eine Reihe hoher Herren als
Bundesgenossen zu werben. Im Verlaufe dieser Händel war Heinrich, der
anscheinend Ältere, in die Gewalt der Bürger gefallen, woraus ihn sein
Bruder dadurch befreite, dass er seinerseits „Walthers son von
Bvochein“ sowie „Liebekinden den juden“ wegfing. Daß es gerade
Freiburger Kaufleute waren, wie Bader meint, der auch dem Vater Walter
statt des nicht mit Namen bezeichneten Sohnes nennt, wird nicht gesagt.
Da in dem Bündnis das die Stadt unterm 24. September 1314 abschloss,
unter dessen Druck schon zwei Wochen darauf eine Sühne zustande kam,
auch Graf Konrad von Freiburg sowie zwei Herren von Üsenberg beteiligst
sind, von welchen einer nach Ausweis einer Sühne von 1306 (Februar 11.)
von „her Colman“ einem Ritter von Freiburg, gefangen gesetzt war, so
darf man bei Walther vielleicht an den Üsenberger Lehensräger dieses
Namens denken, während es sich bei dem Juden um einen gräflichen
Kammerknecht gehandelt haben wird, der allerdings gleich dem Sohne des
ersteren auch Freiburger gewesen sein mag.
In dem Sühnebrief vom 5. Oktober 1314, der uns von diesem Vorgang
Kenntnis gibt, geloben die Brüder Colman „den burgern und der gemeinde
ze Friburg / und den iren / niemer leit noch schaden ze tünde mit
worten noch mit werchen von dekeiner sache / so unse her geschehen
ist....“ Er unterscheidet sich im übrigen von stets wiederkehrenden
anderweiten Ausgleichen dieser Art im wesentlichen nur durch die
ungewöhnlich hohe, entsprechende Rückschlüsse gestattende Buße von 1000
Mark Silbers, welche der Stadt bei „vreffelicher“ Verletzung des
Übereinkommens zu entrichten, wofür nicht weniger wie zwölf angesehene
Bürgen aus dem Kolmanschen Verwandtenkreise wie üblich durch
Verpflichtung zum Einlager der Gewähr übernehmen, das sie in der „die
Nüweburg“ genannten Vorstadt leisten sollten.
Wie sich die Dinge nach diesem Ausgleich weiter entwickelten, bei dem
übrigens nicht, wie Bader angibt, „der beliebte Ritter Otto von
Ampringen“, sondern der nicht minder angesehene „Herr Hug von Velthein“
Obmann war, darüber berichtet Bader wie folgt:
„dieses Gelöbnis hielt Herr Wilhelm aber so schlecht“- der übrigens nur
Edelknecht und nicht „Her“ war – „daß er nach der Befreiung seines
Bruders die Freiburger übermütig“ verspottete und von der wilden
Schnewburg aus ihren Leute und Güter neuerdings empfindlich
geschädigte“. „Aber kaum sah der Wolf im Schafspelz den lieben Bruder
wieder auf freien Füßen, so begann er weidlich, dass hochmütige, üppige
Bürgervolk zu verspotten und zu beschimpfen, und meinte nach damaliger
Junkergesinnung, dasselbe müssen niedergebeugt und vernichtet werden,“
so wird in einer späteren Abhandlung eingehender berichtet. Gedachten
Orts aber heißt es dann weiter: Da riss den Bürgern die Geduld; sie
griffen zu den Waffen, zogen die Hilfe ihrer Bundesgenossen an sich und
eilten hinauf ins Bruckachtal, um die verhasste Veste zu brennen und
niederzuwerfen“.
„Es war im Frühling 1315. Nachdem ein Mann der geringen Besatzung durch
die Würfe der Steinschleudern gefallen, gewannen die Freiburger das
Räubernest, machten eine ziemliche Beute ein Mehl, Wein, Harnischen und
anderem Gute, was sie nebst zwei Kühen und einem Maultier siegeslustig
hinweg führten.
„Damit aber nicht zufrieden, riß man das Kolmannische Haus in der Stadt
(vor dem Predigertore) nieder, wie das Gesetz gegen treulose Bürger es
erforderte, zerstörte die wilde Schnewburg und lichtete oder verwüstete
die dazugehörige Waldungen.“
„Dieser Schlag machte das junkerliche Brüderpaar etwas kirre, sie
gingen auf ein neues Schiedsgericht ein, dessen Obmann (wieder der
Ritter vom Ampringen), da die Schiedsleute nicht einig wurden, am 13.
Juli 1315 allein das Urteil dahin abgab, daß aller bisherige Hader für
immer abgetan sein, die Stadt den beiden Kolman das zerstörte Schloß
mit seiner Zubehör abkaufen und allen denselben zugefügten Schaden
(selbst den gefallenen Mann) nach unparteiischer Schätzung vergüten
sollte´.
Aus welchen Quellen Bader seine Kenntnis über den unmittelbaren Anlaß
zur Zerstörung der Burg sowie über die weiterhin damit verknüpften
Geschehnisse geschöpft, vermochte ich nicht zu ermitteln. Sie dürfte
teilweise einzig aus dem Borne seiner Phantasie geflossen sein.
Sicher ist vielmehr soviel, daß sich die Stadt durch ihren Gewaltakt,
der anscheinend einer impulsiven Entschließung entsprang und
wahrscheinlich in Abwesenheit der Burgherren erfolgte, ihrerseits in
ein flagrantes Unrecht gesetzt hatte. Die aus unbekanntem und
jedenfalls das Vorgehen der Stadt keineswegs rechtfertigenden Anlaß
erfolgte Zerstörung der wilden Schneeburg hatte offenbar in
Wirklichkeit die neue Fehde erst entfacht. Darüber lassen die beiden
Breisacher Austragungsurkunden von 1315, zumal die Entscheidung
vom St. Margarethentag (damals in der Diözese Konstanz der 14. Und
nicht der 13. Juli, wie Schreiber und Bader angeben) keinen Zweifel,
die, nachdem die Schiedsleute in ihren durch sechs Wochen hingezogenen
Verhandlungen "missehelle“ geworden, nunmehr nicht „wieder“ , der neue
Obmann Otto von Ampringen nach eigenem Ermessen allein traf. Das geht
im Gegensatz zu der von Bader gegebenen Deutung eigentlich schon aus
dem hervor, was er selbst über die der Stadt aufgelegte
Schadenersatzverpflichtung anführt. Viel prägnanter aber ist der
Wortlaut der bezüglichen, im Freiburger Stadtarchiv erhaltenen
Originalurkunde:
„....Dar nach spriche ich / “ – verkündet hier der Ritter Otto von
Ampringen – „wand nieman den andern ane gerrihte angriffen sol / so
heisse ich die vorgenanten burger von Friburg / den vorgeschribenen
Colmannen ir burg ze Sneberg die si gebrochen hant / iren walt / den si
gewuestet hant / und was guotes die selben Colemanne mit der bürge
kovften / gelten alse türe alse es gekovfet wart. Und das die burger
das selbe guot alles / wande si es geltent / gerruewecliche haben und
besizzen iemerme. Swas ovch an die burg gebuwen ist / sit si die
Colmanne kovftent / dar umbe sol ieweder teil zwene erber manne kiesen
/ die den kosten in der kuntsami uf den eit ernaren / und den kosten
süllen die burger von Friburg gelten alse ich sü heisse / nach der
vierer rate. Was ovch der man der uf der burg ze Sneberg erworfen wart
der Kolmannen eigen / so süllen inen die vorgenannten burger einen also
guoten man wider an des stat geben / was er nuet ir eigen / so heisse
ich die selben burger enheine besserunge umbe den man tuon / wan des
ieden man / sin conscience underwiser. Swas ouch melwes / wines /
harnesches / alder / dekeinre flahre guotes / uf de burg was / des
tages / do si besessen wart / ane das der Colmanne gesinde / abe
vertigeten / alder dekeinen weg ze nuzze kerte / alder vertet / dar
umbe süllen die vorgeschriebenen teile / vier erber manne kiesen / den
dar umbe aller kündigest si.mUnd swie ich nach der vierer bewisunge das
selbe getregede heisse gelten / des süln die burger gehorsam sin. Ich
heisse ouch die selben burger / die meiden / zwo kueye / und den mul /
die sü ze Sneberg namen / wider geben ane vürzug / alder gelten obe sin
üt verloren ist / alse ich denne heisse. Und alles das ich da vor
gesprochen han / über dü vor bescheidenen ding / die e nür gerrihtet
waren / das spriche ich / und erteile / nach wiser lüte / weltlicher
und geistlicher rate / an disem gegenwertigem briene / uffen minen eit
den ich dar umbe gesworen han. Und ze einem offenem urkünde / alles des
/ hie vor geschriben ist / so gibe ich Heinrich / und Willehelme den
vorgenanten gebruoderen / diesen brief / besigelt / mit minem
Ingesigele....“
Schärfer hätte das den Geschädigten verbriefte Urteil gegen die Stadt
kaum lauten können. Um die feindlichen Parteien ein für allemal
auseinander zu bringen, wird der Stadt zwar der verwüstete Kolmannische
Besitz am Hochfarren zugesprochen, aber sie muß ihn „abkaufen“ unter
Einrechnung all der erweisbaren Aufwendungen, welche die Brüder, seit
er ihr eigen, gemacht und zwar zu dem Preise, den der Schiedsmann
bestimmen wird. Und so soll sie nicht minder gleicherweise auch all den
Schaden wieder gut machen, welchen sie den Brüdern an deren fahrender
Habe zugefügt, durch Rückgabe des Geraubten oder volle Ausgleichung im
Geld. Den erworfenen Mann allerdings nur dann, falls es ein Höriger
war, der wie eine Sache behandelt wird, und darum durch einen
gleichwertigen ersetzt werden soll. War es ein Freier, so wird den
Bürgern keine Ersatzpflicht auferlegt, da eine Gewissenssache vorliege.
Für die Stadt ergab das sicher keine kleine Rechnung. Den Kolman ist
dagegen keinerlei Buße auferlegt. Von den 1000 Mark Silbers, die sie
bei böswilligem Verschulden erwirkt gehabt hätten, ist keinerlei Rede.
Es ist offenbar, die Stadt hate ihrerseits dadurch, daß sie gegenüber
dem unbekannten Verschulden des Gegenparts, ohne das Urteil der
Schiedsrichter einzuholen, zur Selbsthilfe griff, den im Oktober 1314
abgeschossenen Vergleich gebrochen. Die Bestimmung: „wand nieman den
andern ane gerrihte angriffen sol“ besagt das deutlich. Indem Bader
diese Urteilsbegründung verschwiegen, verwischte er in seiner
Darstellung das scharfe Gepräge des wirklichen vollen Tatbestandes.
Eine eigentliche Versöhnung und Austilgung der auf beiden Seiten durch
die andauernden gegenseitigen Schädigungen angesammelten Erbitterung
konnte der gefällte Schiedsspruch natürlich kaum bringen. Den
zwangsweise ihres Besitzes entäußerten beiden Brüdern vermochte auch
die bestbemessene Ersatzleitung das Gefühl erlittener Vergewaltigung
nicht zu unterdrücken, und zumal bei dem durch die Eintürmung mit
besonders nachhaltigem Groll erfüllten Junker Heinrich machte sich der
in seiner Seele fortglimmende Haß auch weiterhin in feindseligen
Handlungen Luft, während deren erneutem Austrag er im Sommer 1317 aus
dem Leben schied.
Aus den bezüglichen Dokumenten vom 13. Mai und 26. August dieses Jahres
geht hervor, daß er beschuldigt war, den Bürgern ihr Vieh verbrannt zu
haben, was er zwar „nüt enlougente“, aber anscheinend „weder übellich
noch freuellich“ getan haben wollte. Der weiteren Bezichtigung, einen
der Ihren abgefangen und um 13 Brisger geschädigt zu haben, begegnet er
mit dem Einwurf, „das er das teti umbe soliche sache, dü e versunet und
verrihtet was / e der brief gegeben wart, den die burger von ime und
von Willehelme sindem bruoder hant“. Wie die Schiedsleute, nach dem
schon vor letzterem Datum eingetretenen Ableben des Beschuldigten,
schließlich zu Recht erkannten, erfahren wir nicht.
Aber auch die die Voraussetzung des Besitzüberganges bildende
Schadensabfindung an den nach Kaisersberg im Elsaß übergesiedelten und
hier zur Ritterwürde gelangten Bruder Wilhelm vollzog sich offenbar
nicht gerade reibungslos. Infolgedessen kam der ganze Streit, trotz
verschiedener im Verlaufe der nächsten Jahrzehnte von diesem und seinen
drei Söhnen unter gleich exorbitanter Buße bei freventlichem Friedbruch
beschworener Urfehde, erst unterm 15. Dezember des Jahres 1355 zum
endgültigen Abschluß.
In diesem zu Freiburg vollzogenen endlichen Austrag des langwierigen
Handels, dessen Beurkundung auf Bitten Wilhelms auch die Grafen
Friedrich und dessen Bruden Egon von Freiburg vermutlich als
Lehensherrn mitbesiegelten, bekundet dieser, daß er „umb alle dinge“
mit den Bürgern „lieplich und guotlich verrihtet und versünet“ sei, an
sein und seines Bruders seligen statt, aber auch von seines „vatter
seligen wegen / oder von des huses wegen / das er hatte zuo Friburg vor
der Bredier tor“, und „ von inen geweret“ sei nun alles dessen, „so si
uns ie schuldig wurden“.
Wann und in welchem Zusammenhang sich die Zerstörung des väterlichen
Hauses vollzog, wissen wir nicht. Nachdem derselbe in dem Schiedspruch
des Otto von Ampringen nicht gedacht wird, steht entgegen der Annahme
Baders, vielmehr zu vermuten, daß es sich „umbe soliche sache / dü e
versünet und verrihtet was“, handelt. Zu dieser Auffassung gelangte
auch Schreiber.
Die Verfassung bestimmt, daß, wer nicht erscheint, wenn ihn die Glocke
wegen „blütigem slag“ vor Gericht ruft, „...er si burger oder gast /
dem wirt die stat mit rehter vrteilde widerteilt / und also swie er
darnach kumt in die stat / ist er tot den er wundet / es gat im an das
houber. Genist er / dü hant hat er verlorn / und ist er ein burger / so
sol man ime sin hof / da er burger an ist / nider slahen / und sol das
ligen ungebuwen als da vor ist geschriben.“ Das ist auf Jahr und Tag.
Wenn aber das Jahr abgelaufen, „so süln es denne han.“
Unterm 14. Oktober 1317 – also nach dem kinderlosen Ableben Heinrich
Kolmans – verkaufte dessen Bruder die „hofstat die gelegen ist ze
Friburg vor der Breidiger tor nebent Pfaffenberg dem wagener“ im
Einverständnis mit seiner dem Namen nach nicht bekannten Ehefrau um 6
Mark Silbers Freiburger Gewäges an das Heiliggeistspital, das sie zu
seiner benachbarten Mühle zog und anscheinend auch weiterhin unbebaut
ließ.
Es ist vielleicht nicht nur zufällig, daß die einer Ortsangabe
ermangelnde, von „Wilhelm Kolman“ besiegelte Verkaufsurkunde – wie nach
der ungewohnten Schreibweise „Breidiger tor“ und übrigens auch nach dem
Duktus der Handschrift zu vermuten – nicht in Freiburg ausgefertigt
wurde, und da auch die Freiburger keinen hiengen, „sie hätten ihn denn
zuvor“, so würde man, weil es dem Verkäufer wegen der gedachten Delikte
weder an das Haupt noch an die Hand gegangen, vielleicht noch nicht
folgern können, daß er auch nicht mit einer entsprechenden Tat belastet
war, wenn nicht anderseits die den Bürgern auch nach dieser Hinsicht
auferlegte Schadensersatzpflicht – denn eine solche spricht doch wohl
aus dem letzten Ausgleich von 1355 – erkennen ließe, daß sie sich auch
bei der zu vermutenden Zerstörung des väterlichen Hauses nicht auf
völlig gesichertem Rechtsboden bewegten.
Vierzig volle Jahre hatte sich die Beilegung des Streitfalles
hingezogen, immerhin eine beachtenswerte Leistung auch für die
fragliche Zeit, in der schier endloses Prozessieren gerade keine
ungewöhnliche Erscheinung war. „So zäh in seiner Verbissenheit war
dieser Schnewelin´sche Kopf“, bemerkt Bader dazu. Unter derselben
Tendenz hatte er uns dasselbe heimische Geschichtsbild, im einzelnen
variiert, anderweit wiederholt schon früher vorgeführt und im
wesentlichen gleichlautend und kaum nennenswert gedrängter, bereits
auch in einem vorhandenen, „in Fehden und Kriege der Stadt“
behandelnden Kapitel der Stadtgeschichte dargestellt, mit dem einzigen
Unterschied, daß sich der zähe und verbissene Snewlinsche Kopf schon
1332, also volle 23 Jahre früher zufrieden gab. Hier liegt ein kleiner
Lapsus memoriae des damals schon bejahrten, verdienten
heimatgeschichtlichen Forschers vor. Jedoch die Hauptsache: In dem von
ihm gedachten Sinne erweist sich seine Darstellung als ein Trugbild.
Auch von den Snewlin von Freiburg kann, Schiller Worte variierend,
gesagt werden: Von der Parteien Gunst und Haß verwirrt, schwangt ihr
Charakterbild in der Geschichte.- Sie waren Kinder ihrer Zeit, nich
besser und wohl auch icht schlechter als die meisten andern gleichen
Standes und gleicher Macht. Die ihnen vergleichbaren Zorn von Straßburg
und die Overstolz von Köln verrieten schon im Namen ihres Wesen Art.
Aber was immer auch einzelne Glieder der großen und mächtigen
Snewlinschen Sippe an wohlbezeugten Untaten auf dem Kerbholz haben
mögen, das, was Bader und andere bisher von der Verworfenheit genannter
Herren der wilden Schneeburg zu berichten wußten, mag man dafür in den
nicht lückenlosen urkundlichen Zeugnissen eine Bestätigung erkennen
oder nicht, zur Zeichnung des <Charakterbildes der Snewlin läßt es
sich jedenfalls nicht verwerten, und zwar aus dem einfachen,
unanfechtbaren Grund, weil die Kolman eben überhaupt gar keine Snewlin
waren, die Brüder Heinrich und Wilhelm so wenig wie alle andern.
Darüber hätte für Bader keinerlei Zweifel bestehen können, wenn er von
den verschiedenen im Stadtarchiv verwahrten Sühnebriefe auch nur den
einen vom 5. Oktober 1314, statt nur in der Schreiberschen
Veröffentlichung, im Original zu Rate gezogen haben würde. Ist doch
unter dessen 14 angehängten wohlerhaltenen Siegeln, unter deren
Inhabern vier Kolman erscheinen, kein einziges Wappenbild, das auf das
untrügliche Zeichen Snewlinscher Familiengemeinschaft gedeutet werden
könnte: den einfachen in Gold und Grün geteilten Schild. Das Wappenbild
der vier auftretenden Kolman ist vielmehr ausnahmslos ein teils sechs-,
teils achtspeichigen Wagenrad im gerandeten Schilde, und auch von den
übrigen zehn Sieglern aus deren Sippenkreis sind nicht weniger wie fünf
den zahlreichen Freiburger Wappengenossen mit dem Rade angehörig.
Eine ausreichende Orientierung hätte in dieser Richtung übrigens auch
schon ein Blick in die von Schreiber beigegebenen Siegelntafeln
gewähren können. Gewiß, auch bei Stammesgenossen konnte ein
Wappenwechsel eintreten, und die Wappenverschiedenheit ist somit noch
kein untrüglicher Beweis gegen die Familiengemeinschaft. Ein
naheliegendes Beispiel bietet uns die Wappenänderung der Grafen von
Urach infolge des Zähringischen Erbanfalles, wobei das von letzterem
berührte Glied und dessen Deszendenten sich ein aus Teilen des
abgestammten Wappens und desjenigen des Erblassers zusammengesetztes
neues schufen. Und auf die gleiche, in ihren Ursachen allerdings nicht
immer nachweisbare Erscheinung stoßen wir auch bei den Freiburger
Geschlechtern, und zwar ebenso bei den ritterbürtigen wie bei den
bürgerlichen. Bezüglich der Snewlinschen Sippe haben wir jedoch in
einem Fideikommißvertrag von 29. Dezember 1329 ein deren
Wappengemeinschaft unmittelbar bestätigendes urkundliches Zeugnis,
falls es eines solchen überhaupt bedürfte, denn hier wird gesagt, daß
das Erbrecht an dem verzeichneten Besitz den nächsten Gliedern des
Verwandtenkreises zustehen solle, „die Snewlin nammen hant und die
Snewlin wafen (Wappen) von geslehte füren“.
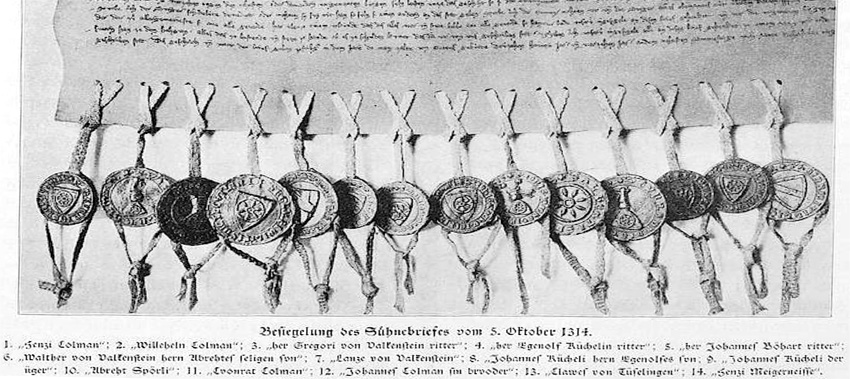
|
Die geschilderten Vorgänge konnten jedoch bei einiger Überlegung auch
an sich schon durch die Nennung der beidseitigen Schiedsrichter
erkennen lassen, daß wir in den Kolman keine Snewlin vor uns haben.
Während erster nämlich außer Wappenverwandten nur durch Elsässer
Freunde vertreten sind (die Ritter "Heinrich Spörlin“, den in Breisach
ansässigen "Heinrich von Bolsenhein“, "Cuonrat von Könshein“ und Wolvan
von Siglozhein“, sowie „Hessen von Könshein“, einen Edelknec´ht „von
Kolmer“), ist auf der andern Seite stets einer der beiden Schiedsleute
ein Snewlin; bei dem wichtigen Austrag von 1315, den Otto von Ampringen
als Obmann entschied, da die beiderseitigen Vertreter sich nicht
einigen konnten, hatte die Stadt als Männer ihres Vertrauens sogar
gleich deren zwei bestellt, nämlich den Bürgermeister "Snewlin in dem
hove“ und den Schultheißem „Berntapen Snewelin“. Sicherlich würde sie
die Wahrung ihrer Interessen in solchem Falle nicht deren Hände gelegt
haben, wenn die Gegner derselben Sippe angehört hätten.
Es ist eben immer und immer wieder ein und dieselbe Erscheinung, Einmal
durch den St.Blasianer Kapiturlar Fr. X. Kreuter, den Urheber der
Pseudoschnewlin, in die Literatur eingeführt, dann kritiklos von Kolb,
Schreiber, Troulliar, Dambacher, Münch usw. und als einem der ersten in
dieser Reihe schon früher auch von bader übernommen, hatten sich die
„Kolmann-Schnewlin“ eben als Requistit heimischer Geschichtsklitterung
derart eingebürgert, daß die Frage ihrer Echtheit aufzuwerfen kein
Anlaß vorzuliegen schien, für Bader zu allerletzt, nachdem er bei
denselben alle die von ihm mit Vorliebe des öfteren betonten, typischen
Eigenschaften des seiner Meinung nach semitischer Wurzeln entsprossenen
Snewlinschen Stammes in einer so scharf ausgeprägten, als bestes
Schulbeispiel dienlichen Entwicklung zu finden glaubte.
Auch Kreuter begründert seine „Schnewlin von Kollmann“ unter Verweisung
auf dasselbe, später durch Schreiber veröffentlichte urkundliche
Material über die wilde Schneeburg.
Daß die derart entstandene irrige Vorstellung zugleich eine weitere
Stütze fand durch die im Nekrologium von Günterstal für den 21. Juli,
bzw. den 24. November als verstorben verzeichneten „Elisabeth“ und
„Margaretha Sneweli dicta Kolmennin“, welche derselben falschen Deutung
unterliegen konnten, wie die an gleicher Stelle vermerkte „Margaretha
Snewlin dicta Wiswil“ – Frauen, bei welchen in Wirlkichkeit „Sneweli“
den Mädchennamen (geb. Snewlin) bezeichnet, wird man schon daraus
folgern dürfen, daß ja die gleichfalls von Kreuter eingebürgerten und
seltsamerweise auch noch von Socin übernommenen „Schnewelin von Wiswil“
überhaupt keine andere Grundlage haben, als die mißverstandene
Anniversarnotiz. Dagegen glaubte Kindler von Knobloch annehmen zu
dürfen, daß Bader in erster Linie durch den in die Mitte des 14.
Jahrhunderts mehrfach urkundenden Freiburger Edelknecht „Snewelin
Colman“ verführt wurde, dessen Siegel mit der etwas beschädigten
Legende“+S.SNEWELINI.DCI.(KOLM)AN.“ Einer im 13. Bande (1861) der
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins durch Dambacher
veröffentlichten Urkunde von 1351 (Febr. 26) anhängt. Wie dem auch sei,
auch in diesem Falle hätte ihn das Kolmansche Radwappen des gedachten
Orts beschriebenen Siegelbildes aufklären müssen, wenn – nun wenn ihn
nicht, was mir wahrscheinlicher dünkt, die längst vorgefasste Meinung
zu einer gleich einfachen Lösung des Problems geführt hätte wie
Dambacher, der den Snewelin Colman, welchem sein Taufname nach
bekanntem Brauch durch die Mutter (vorgenannte Elisabeth) geworden, im
Index kurzer Hand zu einem „Colman (Snewlin)“ umschuf, eine Methode,
durch welche sich ja auch Poinsignon in ähnlich gelagerten Fällen über
jegliches Kopfzerbrechen hinwegfand.
Andererseits war meines Wissens Poinsignon der erste, der ernsteren
Zweifeln an der Existenzberechtigung der „Kolman-Schnewlin“ zutreffend
begründeten Ausdruck lieh. Den eingelebten Anschauungen gegenüber zu
einem schlüssigen Urteil zu gelangen, wagte aber auch er zunächst
nicht. In seiner 1887 in der Zeitschrift für die Geschichte des
Oberrheins veröffentlichten wertvollen Untersuchung über die Ödungen im
Breisgau schreibt er nämlich unter „Wilde Schneeburg“:
„Über das Verhältnis der Colman zu den Schnewlin bin ich noch nicht
aufgeklärt. Bekanntlich zählt man die Colman zum großen Stamm der
Schnewlin, allein beide Familien führen ganz verschiedene Wappen.“
Über den dadurch angetretenen Zweifel kam auch der Bearbeiter des
Jahresverzeichnisses zu Band 1 bis 27 des Freiburger Diözesanarchivs
noch nicht hinaus. Er begnügte sich mit Beisetzung eines Fragezeichens.
Erst die ein Jahr später (1903) erschienene 5. Lieferung des 2. Bandes
vom Oberbadischen Geschlechterbuch brachte mit dem Artikel „Kolmann“
eine klare Auffassung der tatsächlichen Verhältnisse. Und die Wirkung?-
Das Jahr darauf schenkte uns die durch A. Krieger bearbeitete,
wertvolle Veröffentlichung des ersten Bandes der zweiten, stark
vermehrten Auflage des Topographischen Wörterbuches des Großherzogtums
Baden und gleichzeitig den 6., den Landkries Freiburg behandelnde Band,
zwei Handbücher, die mindestens gerade so vielfach zu Rate gezogen
werden dürften wie das Geschlechterbuch. Und welche Aufschlüsse geben
sie uns zu der aufgeworfenen Frage? Im ersteren Werk stehen die „Kolman
Schnewli“ gerade so frisch und fröhlich wie zuvor in der Reihe der
Schnewlinschen Linien mit folgender, hier unter Weglassung der
Signaturvermerke wiedergegebener urkundlicher Namens- und Datenauslese:
„ C. Cholmannus (dictus Cholman) miles de Friburch 1252 – Cuonrat
Kolman ritter 1278, 1281.
Heinrich Colman und Willehein sin bruoder 1314.
Snewlin Colman edelknecht 1351“
Also auch da wieder die immer noch nicht überwundene Verkennung, daß
„Snewlin“ hier Tauf- und nit Familienname ist, worüber doch schon die
auffallende Einzelerscheinung hätte aufklären müssen.
Und dann Band 6 der Kunstdenkmäler, leider in mehr als einer Hinsicht
nicht der einwandfreiste der bis jetzt erschienen Serie. Die für die
wilde Schneeburg angeführten Daten und Zitate sind zum Teil falsch, zum
Teil gar nicht auf diese beziehbar. Unter „Nachträge und
Berichtigungen“ wird uns aber durch M. Wingenroth die Belehrung:
„Zur wilden Schneeburg und ihren Besitzern ist zu bemerken, daß diese
wohl nur eine Linie der Schnewlin waren, von denen die Burg gegründet
worden.“
Man sieht, der Geist dieser Pseudo-Snewlin wurde durch die Feststellung
Kindlers von Knobloch noch nicht völlig gebannt, und so kann es doch
auch nicht überraschen, daß diese Spukgestalten ebenso, wenn auch etwas
zaghafter in der gleichzeitig veröffentlichten Abhandlung von Fr.
Pfaff, „Die Schneeburg im Breisgau und die Snewlin“, umgehen, hier wie
anderwärts in Gesellschaft gleichwertiger historischer Scheinwesen, was
übrigens an dieser Stelle insofern nichts Befremdendes hat, als
ausschließlich nur die ausnahmslos die getrübten literarischen Quellen
zu Rat gezogen wurden. „Sie“ – die wilde Schneeburg -, so lesen wir da,
„gehörte damals den Kolman von Freiburg, die vielleicht desselben
Stammes waren, wie die ausgebreitete Sippe der Snewlin von Freiburg“.
Selbst der nur scheinbar urkundlich belegte Hinweis P.P. Alberts in
dessen auch sonst einige Berichtigungen bedürftigen Abhandlung über die
Schneeburg auf dem Schienberg, daß die Schnewlin 1311 wohl „als
Ganerben“ auf der wilden Schneeburg saßen, also zuu einer Zeit, da
diese nachweisbar in alleinigen, erkauften Besitz der Gebrüder Kolman
war, ist nur aus der gleichen Unsicherheit über die Beantwortung der
einschlägigen, genealogischen Frage zu verstehen, durch die sich auch
Poinsignon zu der gleichen irrigen Meinung verführen ließ. Eine Urkunde
von 1311 oder irgend welche andere, aus der eine solche Ganerbenschaft
abgeleitet werden könnte, dürfte kaum beibringbar sein.
Der sich in alledem äußernde suggestive Einfluß einer gutgläubig immer
und immer wiederholten Behauptung hat übrigens in etwas auch auf die
Arbeit Kindlers von Knobloch abgefärbt. Gleich im zweiten Satze des
Artikels über die "Kolman“ heißt es nämlich einleitend:
„Sie waren fast seit ihrem ersten Auftreten in steter Fehde mit ihrer
Vaterstadt, aus deren Rate sie schon 1300 sammt ihren Kindern für immer
ausgeschlossen wurden, bis sie endlich gewaltsam aus der Heimat
vertrieben wurden.“
Mit der durch das eingeschobene „fast“ nur wenig eingeschrängten
Verallgemeinerung eines zeitlich und noch mehr persönlich begrenzten
Vorganges, nämlich der Aufbauschung des Streites der Stadt mit dem
Kolmanschen Brüderpaar zu einem „steten“ mit deren ganzer Familie, wird
eine ebenso unbewiesene wie unbeweisbare Behauptung aufgestellt, die
offenbar aus den Vorstellungen des Baderschen Gedankenkreises genährt
ist. Dadurch wird aber auch schon die damit in einem Atemzuge genannte
Tatsache der Ratsverweisung in ein falsches Licht gerückt und ihr für
den Unkundigen eine Bedeutung gegeben, die ihr keineswegs zukommt.
Sehen wir, wie die Dinge in Wirklichkeit lagen.
Mit „C. dictus Cholman“ ist für 1245 (Juli 25) der Name, soweit bis
jetzt bekannt, erstmals belegt. Das Auftreten der Familie in Freiburg
ist jedoch schon sieben Jahre früher mit „Chuonradus Bukkenrüte“
nachgewiesen, der als letzter unter 18 Zeugen in einer die Berufung des
Predigerordens betreffenden Urkunde erscheint. Seine
Familienzugehörigkeit ist uns mit der für 1256 und 1258 (Jan. 10)
belegten Nennung „C.Cholmannus et C.Buochenrüti, fratres“ bekundet.
Wenn man nun auch die Niederlassung des Bruderpaares füglich über den
Ausgang des ersten Drittels des 13. Jahrhunderts zurückdatieren darf:
daß von den verschiedenen Wappengenossen mit dem Rad im gerandeten
Schilde, von welchem nur die von Tußlingen schon in 12. Jahrhundert
bezeugt sind, sich auch die Kolman schon so frühe in Freiburg
eingefunden und gar zu „den ersten Mitarbeitern des Gründers der Stadt“
gezählt werden dürfen, ist nicht wahrscheinlich. Die Tatsache, daß ihre
ältesten nachweisbaren Seßhäuser vor den Mauern der alten Stadt lagen,
zwei vor dem Predigertor, das dritte sogar an der äußersten Grenze der
westlichen Vorstadt, also selbst außerhalbderjenigen des ursprünglichen
Stadtgebiets, spricht entschieden dagegen. Von einem der beiden
ersteren haben wir bereits gehört; von dem andern gibt uns eine noch zu
berührenden Urkunde von 1320 Kenntnis. Über die Lage des dritten
berichtet uns erstmals die durch den Grafen mitbesiegelte Ratsverfügung
vom 14. November 1288, welche bestimmt, wie es mit den aus der Stadt
Verwiesenen zu halten. Hier ist die Benennung der Grenze „alse des
rates gewalt gat“, die zu überschreiten verboten, auch „das dor bi
Johans Buggenrütes houe“ angeführt, das, 1297 als "her Buggenrütis tor“
bezeichnet, diesen Namen dauernd behielt.
Im urkundlichen Bild der Stadtgeschichte verschwindet das nicht sehr
ausgebreitete Kolmannsche Geschlecht allerdings schon bald nach der
Mitte des 14. Jahrhunderts. In den Herrschaftsrechtsregistern begegnen
wir demselben jedoch noch bis zum Ausgang des folgenden.
Scheidet man die letzteren Belege auch gänzliche aus, so umfaßt sein
sicher nachweisbarer Aufenthalt immer noch weit über ein Säkulum, vier
namentlich feststellbare Generationen einschließend. Während höchstens
zwei Dezennien etwa dieses Abschnittes, das ist vollgerechnet ein
Sechstel des ganzen Zeitraumes, sehen wir zwei Glieder der Familie
einer und derselben Generation mit ihrer Vaterstadt, aus deren Mauern
sie verzogen, in Fehde verwickelt, ein Vorgang, der, nebenbei bemerkt,
keineswegs vereinzelt dasteht und nach vollzogenem Ausgleich, bei allem
nachhaltigen Groll, noch nicht unbedingt eine Stadtverweisung zur Folge
haben mußte. Aus dem, was bekannt, kann auf eine solche jedenfalls noch
nicht geschlossen werden, wenn aus der nachherigen völligen Abwanderung
Wilhelms auch vermutet werden darf, daß seines Bleibens kein Raum mehr
war, zumal nach der Zerstörung des väterlichen Hauses.
Oder sollte doch auch andern, nicht unmittelbar von dem Zwiespalt
berührten Glieder der Familie in ihrer Heimat der Boden unter den Füßen
heiß geworden sein ? – „Wir / graue Cunrat / herre ze Friburg / tvon
kunt ....daz Cunrat Colman unser man / vor uns gieng und uns uf gab
allü dü lehen / dü er von uns-ze lehene het / in dem banne ze Herdern /
und uns bat / daz wir dü selben lehen lühent hern Snewelin Berrnlappen
/ hern Johannes Snewelins seligen sone / und luhent in ouch dü selben
lehen / als er uns bat“, besagt eine Urkunde von 1317 (Juli 26). Es
handelt sich fraglos um den Schwager des an letzterer Stelle genannten
Snewelin, des Stammherrn der Snewlin von Wiesneck. Dieser Verdacht wird
jedoch dadurch entkräftet, daß noch 1320 (Jan.30) die Mutter dieses
Conrat Colman „fro Berthe Colmannin / ein burgerin von Friburg / und
iru kint Johannes und Niclawes burger von Friburg / kamen ze Friburg in
das Rathus vier die Drizehne“, um ein Übergabsübereinkommen bezüglich
der Burg Dachswangen bei Gottenheim zu treffen, wobei dem jüngsten der
Söhne das der Mutter gehörige und dieser zu lebenslänglicher Benützung
gewährleistete „howe gesessede vor der Predier tor, dem man sprichet
hern Colmannes hof“, zufiel. Liegt nichts vor, woraus eine gewaltsame
Austreibung eines der übrigen Sippenglieder gefolgert werden könnte, so
ist aus dem Gesagten ebensowenig abzuleiten, daß die Kolman „fast seit
ihrem ersten Auftreten in steten Fehde mit ihrer Vaterstadt gelegen“.
Dem entgegenstehende Feststellungen bieten aber auch die im
Geschlechterbuch aufgeführten Daten nicht.
Was nun die Ausschließung aller Kolman aus dem Rat ihrer Vaterstadt
schon 1300 und zwar „für immer“ betrifft, so sagt das noch nicht
zugleich eine Stadtverweisung, und auch in ihrem eigentlichen Sinne
darf die Bedeutung einer solchen Verfügung keineswegs überschätzt
werden. Derartige Ratsbeschlüsse wurden damals ebenso oft gefaßt wie
unbeachtet gelassen.
Die „offene verkünde“, welche uns über den Ausschluß unterrichtet, ist
datiert vom 11. Juni 1356 und nennt in drei getrennten Gruppen die
Namen der in den Jahren 1300, 1338 und 1348 davon Betroffenen.
Abgesehen von dem Hinweise, daß es geschehen „von redlicher sachen
wegen / die si wider uns den rate / und ouch die statt zuo Friburg
getan hant“, enthält sie jedoch keinerlei weitere Angaben über die
eigentlichen unmittelbaren Anlässe. Es muß sich also durchweg um
Vorgänge gehandelt habe, die in lebendiger Erinnerung waren. Aus der
letzten Namensreihe läßt sich jedoch folgern, daß der verschärfte
Zwiespalt, welcher durch die wüsten Judenbrände und deren
Folgewirkungen in die Bürgerschaft getragen wurde, den Rat zu dem
Schritt bestimmt hatte, gleichzeitig auch die früheren Beschlüsse diese
Art in warnende Erinnerung zu bringen. Die Maßnahmen gegen die
aufrührerischen Zettelungen, von welchen 1338 außer den eigentlichen
Urhebern eine Anzahl Handwerker und deren Nachkommen betroffen wurden,
klingen in einem Ratsbeschluß vom 4. Dezember des folgenden Jahres
nach, dahin lautend: „Wer in deheine wise an unser stat ze Friburg /
oder an derselben stete ere / friheit / oder reht ratet / das dem rat
ze Friburg kuntwirt / oder dar uf gat / das er daheine grosse
missehellunge oder widerparten in der stat mache / da das ouch dem rat
kuntlich wirt / das der rat und die burger gemeinlich ze Friburg
setzent uf des lip von erste / und dar nach uf din guot.“
Über die eigentlichen Vorgänge von 1338 gibt uns des näheren eine
Stelle in einem späteren um 1350 entstandenen Verzeichnis der in
Freiburg rechtlos Gewordenen Aufschluß, die besagt: „Der Kempfe und der
Stecher“ / - der eine aus dem Geschlechte derer von Munzingen, der
andere ein Freiburger Tuchhändler und zugleich Lehensmann des Grafen –
„hant getriben / und geworben an grave Fridrichen von Friburg / das der
rat ze Friburg ermurdet solte sin / und der stete und des rates briefe
und friheit genommen und entwerte sollten sin / und het dis der rat
kuntlich ervaren / das enkein longenen darnach gat. Harumbe sint si
rechtelos gemachet ze Friburg / umbe die grossen missetat und unfouge
so si getan hant.“
Hier lag somit ein Delikt vor, auf das nicht nur Ausschließung aus dem
Rat gesetzt war. Was dagegen im Jahr 1300 in der durch äußere und
innere Wirren zerrissenen Bürgerschaft dazu führte, zwölf Geschlechter,
darunter neben den „Colmannen“ auch solche aus dem Kreise der in dem
Sühneabkommen von 1314 als Bürger verzeichneten weiteren
Sippengenossen, nämlich „der alt Meygerniesse sin süne, und iru kint“,
„her Egenolf Kücheli“ und „alle Spörlin“ (von Krozingen) „und dirre
aller kinde / und gemeinlich alle die da bi waren“ , für alle Zeit vom
Rat auszuschließen, ist nicht bekannt.
Wie es jedoch damit in Wirklichkeit gehalten wurde, darüber gewähren
uns schon die in der Aufstellung für das Jahr 1300 an erster Stelle
Genannten einen ausreichenden Aufschluß. Es sind das „Cuonrat Snewli
zer obern linden und sin süne / und iru kinde“. Dieser Konrad Snewli –
nebenbei bemerkt ein Schwager des vorgenannten Kempfe – gibt sich als
ein Mann zu erkennen, der, damals in jungen Jahren, späterhin – wenn er
auch vielleicht nie im Rat saß – durch lange Zeit als oberster Pfleger
des Münsterbaues eines gewiß nicht minder ehrenvollen Vertrauensamtes
waltete, während wir den ältesten seiner gleichfalls verfehmten Söhne
wenige Jahrzehnte, nachdem der Rat für gut befunden, seine alten
Dekrete nachdrücklich aufzufrischen, dessen Gericht vorsitzend und
schließlich sogar als von der Gemeinde erkorenen Bürgermeister an deren
Spitze sehen.
„Wande daz lebin der lüte kurze ist und ir gehügde zergangilich / da
von spulgit man zeschribinne swas beschiht / dur das ez ewigelich
belihe bi der gehügede / der die nu lebent und ouch der nahkomindon.“
So wird einleitend in dem ältesten deutschen Stadtrechte von 1275
gesagt. Aber auch das Aufschreiben ist kein Allheilmittel gegen das
„zergangiliche gehügde“, zumal wenn man vergessen will.
Aus dem Ratsbeschluß von 1300 könnte somit – ich wiederhole es –
jedenfalls keineswegs zugleich die durch nichts beweisbare Annahme
einer gewaltsamen Austreibung der Kolman abgeleitet werden, zumal sie
ja, von dem zu seinen mutmaßlich verschwägerten Verwandten nach dem
Elsaß verzogenen Wilhelm abgesehen, noch über ein volles Jahrhundert
als in Freiburg haushäblich nachgewiesen sind. Ich bin überzeugt,
Kindler von Knobloch wäre nicht auf einen solchen Gedanken gekommen,
wenn er nicht durch den von ihm selbst bezeugten Einblick in eine der
beiden gleichlautenden Darstellungen Baders sich das von diesem
gezeichnete Schreckbild Kolmannscher Verworfenheit hätte suggerieren
lassen, das er nur in genealogischer Hinsicht einer Korrektur unterwarf.
Soweit die in Freiburg verbliebenen wenigen Glieder der Familie nicht
durch Tod abgegangen, bedarf es zur Erklärung ihres Ausscheidens noch
keineswegs des Kindler von Knobloch unterstellten Vorganges. Hatte doch
die zunehmende Macht der Handwerkerzünfte in Verbindung mit der
wachsenden Steuerlast, die durch den unglücklichen Ausgang des Krieges
mit der Herrschaft eine schwer drückende geworden war, bei den im
Stadtregiment mehr und mehr zurückgedrängten Geschlechtern die
ursprüngliche Anziehungskraft der Gemeindezugehörigkeit in das
Gegenteil verkehrt, so daß der Rat schließlich 1368 (März 29), um der
bedrohlichen Abwanderung einen Riegel vorzuschieben, selbst die Auflage
der ansehlichen Abzugsgebühr von nicht weniger als „zweinzig gewerf /
als wir es dez jares so er von uns ziehet uf geleit / und genomen
hant“, und für den, der „burger ze Friburg ist“, dazu außerdem eine
weitere Steuer von einem Pfund Pfennige verfügen mußte. „Und meinent
ouch daz dez nimanne erlassen noch über werden solle“,so ist dem
beigefügt. Den Abzug ganz aufzuhalten, vermochte natürlich auch diese
Maßnahme nicht,und so verschwindet den von einer Reihe der alten Namen,
soweit deren Träger nicht allmählich ausgestorben, einer nach dem
andern.
Ob der im Geschlechterbuch nicht vermerkte „Clewy Kolman“, der 1439
(August 31) und 1448 (Januar 15) in dem unterdem markgräflichen Vogt
tagenden Denzlinger Dorfgericht erscheint, ein vielleicht illegitiemer
Nachkomme des einst ritterbürtigen Geschlechtes ist, muß dahingestellt
bleiben. Das gilt auch von den 1492 zu Freiburg im Grundsteuerregister
verzeichneten Ulrich und Jörg Collman. Dass der Name im weiteren
Sippenkreise auch als Taufname ins 15. Jahrhundert hineinreicht,
spricht gleichfalls dafür, daß das Band mit der Heimat nicht schon
lange zuvor zerrissen war. Wenn 1441 (Dezember 5) von einem „pfründli
das vor ziten“ der längst verstorbene Ritter „her Colman Kuechely“ in
das Münster gestiftet hat, gesprochen wird, so mag der Stifter, dem
Kindler von Knobloch bei seinen zahlreichen urkundlichen Ermittlungen
seltsamerweise nicht begegnet ist, noch ins 14. Jahrhundert
zurückgehen, aber noch 1468 finden sich in dem Verzeichnis der
vorderösterreichischen Ständeglieder beider Gestade unter den
Breisgauern „Melcher und Cholman gebruder von Valkenstain“ eingereiht.
Das geschichtliche Bild der Kolman von Freiburg gewinnt demnach bei
unbefangener Betrachtung jedenfalls nicht unwesentlich andere Züge, als
sie die bisherige Forschung zu zeichnen gewohnt war. Einiger Klärung
bedürfen übrigens auch die genealogischen Angaben des
Geschlechterbuches.
Zunächst mag eine Nennung ausgeschieden sein, die überhaupt keine
Daseinsberechtigung hat. Es ist das der für 1270 registrierte
„Cholomanus junior dct. Nuspoume“. Wir haben hier eine
Namenskombination gleichen Ursprungs vor uns, wie die der vielen in
meiner Untersuchung über Freiburgs ersten Bürgermeister auf ihren
eigentlichen Wert zurückgeführen Pseudo-Ziligen und anderer
Phantastiegebilde, mit welcher die heimatgeschichtliche Forschung durch
Jahrzehnte das Geschichtsbold verwirrt hatte, Spukgestalten, die
unfaßbarererweise mit denselben Methoden, die sie in Leben riefen,
erneut aus dem Orkus hervorgeholt worden sind. Die Nennung ist einer
von H. Schreiber in dessen Freiburger Urkundenbuch veröffentlichten
Adelhauser Urkunde vom 21. Juni gedachten Jahres entnommen, deren
Schlußsatz nach dieser Wiedergabe lautet: „Datum et actum Friburg anno
domini M.CC.LXX. feria tertia proxima ante Johannis baptiste
presentibus Volrico dicto Rintkovf / et Rvo. Filio suo / Johanne
Köchlino / Alberto de Bondorf / Johanne Morser / Cholmanno juniore /
... dichto Nuspvome et aliis fide dignis / et domino B. de Benzhusen
sacerdote.“ Dem hat dann Schreiber selbst in seiner Stadtgeschichte
unter der Aufzählung einer Anzahl für die ersten Jahrhunderte
nachweisbarer Namen aus dem Geschlechte der „Kolmann“ folgende Fassung
gegeben: „1270 Cholomanus junior dictus Nuspuome (Nußbaum?)“. Er hat
somit unter Ingnorierung des Trennungszeichens sowie der ursprünglich
richtig wiedergegebenen Dignitätspunkte (deren das kleine Original
allerdings nur zwei zeigt), die der Urkundenschreiber in
gewohnter Weise für den ihm unbekannt gebliebenen Taufnamen dem „dicto
Nuspvome“ vorgesetzt, aus diesem und dem in der Zeugenreihe
vorangehenden „Cholmanno juniore“ eine Person konstruiert.
Auch Socin hat den vermeintlichen „Cholmanus junior dictus Nuspovme“
begierig als Beispiel von Pleonasmus in Familiennamen für sein
mittelhochdeutsches Namensbuch ergriffen. Daß er auch von H.Maurer
übernommen worden ist, kann angesichts der nicht wenigen andern
Phantasiegestalten, die in seinem bekannten Verzeichnis der Freiburger
mittelalterlichen Geschlechter figurieren, nicht verwundern.
Ob Kindler von Knobloch selbständig auf den selben Irrtum verfallen
oder sein Zitat der Schreiberschen Stadtgeschichte, statt der primären
Quelle, dem Urkundenbuch, entnommen – denn das Original wird er wohl
kaum eingesehen haben – muß dahingestellt bleiben. Immerhin bin ich
geneigt anzunehmen, daß er aus ersterer geschöpft, da ihm andernfalls
doch mindestens Zweifel hätten aufsteiegn müssen, zu deren Behebung der
nötige Aufschluß unmittelbar zur Hand lag. Nennt er un doch
entsprechenden Orts einen „Meister Konrad Nußbaum Bürger zu Freiburg
1265-1315“ und dessen Bruder „Eberli 1287“, auf welch ersteren, der für
1291 (Febr. 14 Fbg.) mit dem „Magistro Cuonrado dicto Nvsbom“ und in
Zeugenreihen außerdem auch weiterhin belegt ist, somit fraglos auch die
mißverstandene Nennung von 1270 zu beziehen sein dürfte. Darnach ist
auch die Angabe von Alfred Götze richtigzustellen, der in
seinerAbhandlung „Familiennamen im badischen Oberland“ (in den
Neujahrsblättern der badischen historischen Kommission von 1918) sagt:
„zem Nusbom heißt in Freiburg ein Haus seit 1283, während der
entsprechende Familienname noch jahrhundertelang fehlt.“ Der Beleg von
1283 bezieht sich auf „Konrad zem Nusbom“, also vermutlich auf
gedachten Meister Konrad. Das Haus, in dem Herrschaftsrechtsregister
„zum vordern (resp. zum hintern) Nußbaum“ genannt, lag an der
nördlichen Ecke von Kaiser- und Nußmannstraße, deren Name somit nur
eine Verballhornisierung der ursprünglichen, nach dem Geschlecht
benannten „Nußpovmes Gassen“ ist, welcher in den Spitalurkunden von
1359 (August 21), 1386 (Oktober 15) und 1389 (November 15) gedacht wird.
Die Aufstellung einer Stammtafel der Träger des Namens Kolman ist im
Geschlechterbuch nicht versucht. Eine gewisse Unsicherheit besteht
jedoch, falls man allein die männlichen Glieder ins Auge fasst, einzig
hinsichtlich der mutmaßlich zweiten bekannten Generationsreihe, deren
beide Glieder schwer auseinander zu halten und darum auch nicht sicher
mit denjenigen der nachfolgenden zu verknüpfen sind.
Zu der mit „C.dictus Cholman“ verbürgten ersten Nennung – vermutliche
der erste dieses Namens überhaupt – wird im Geschlechterbuch
ausgeführt: „1245, miles de Friburg 1252, der Alte 1264. Er ist wohl
der Konrad K., welcher nebst drei andern Edelleuten samt ihren Frauen
und Töchtern unter reicher Beschenkung der Clarissinnen 1272 in den
Franziskanerorden trat.“ Und von dessen Gattin wird angenommen, daß sie
identisch sei mit der „im Necrologicum Güntherstalense als am 21. Juli
+ bezeichneten Elisabeth Snewelin dicta Kolmanennin“.
Das angeblich 1272 gegründete Karmelitenkloster „S Clara prope
Friburg“, somit noch extra muros, lag im Wohngebiet der Familie. Für
1327 ist mit „Elisabethe Buggenrütin“ auch eine Äbtissin aus dem
Geschlechte bezeugt. Das Anniversar gedachter angeblich gleichnamiger
Gemahlin Konrad Kolmans des Alten, deren Familienname wir in
Wirklichkeit nicht kennen, war zwar durch eine 1344 vollzogene Stiftung
der Anna Kolman, der Witwe des Johannes von Feldheim, für die
Zisterzienserinnen zu Günterstal zu begehen ein Anlaß gegeben, aber die
einzig auf die Taufnamensgemeinschaft gestüzte Hypthese Kindlers von
Knobloch – und mehr will es ja nicht sein – wird durch einen
unmittelbaren urkundlichen Ausweis einigermaßen hinfällig. Durch einen
Verkaufsbrief von 1316 (Januar 21) lernen wir nämlich einen „Colman
Johannes Snewelines seiligen tochtermann / und Elsbethen sin elichi
wirtinne“ kennen, auf welche sich somit aller Wahrscheinlichkeit nach
der Güntertaler Eintrag bezieht, und um deren Töchter wird es sich
vielleicht handeln, wenn sie erfahren, daß der 1347 verstorbene
Freiburger Bürgermeister Johannes Snewlin, genannt der Gresser, bei
seinen Zuwendungen an die zu Güntertal eingepfründeten Angehörigen
seines Verwandtenkriesen auch „Komans kinden“ gedenkt. Über die Person
des Vaters dieser Elisabeth orientieren uns ihre in gedachtem
Verkaufsbrief miturkundenden Brüder. Es ist der 1308 als bereits
verstorben bezeichnete Ritter und Bürgermeister gedachten Namens, der
1300 gegen ein Murbachsches Lehengut in Schliengen die Doppelburg
Landeck eintauschte. Den Taufnamen seines Schwiegersohnes erschließt
uns dessen anhängendes Siegel. Es handelt sich um den Edelknecht Konrad
Kolman, der nach Ausweis eines Vermerks auf der Plikatura des Dokuments
von 1316 den Beinamen „Jud“ führte. Er ist wohl der Stifter der
Kolman-Jude-Pfründe im Münster zu Freiburg und identisch mit dem von
Kindler von Knobloch verzeichneten „Konrad Bürger zu Freiburg“, der
1312 (Ferbuar 9) dem Kloster Oberried Gülten zu Kappel veräußert, von
dem er sagt: „seine Frau war damals eine Tochter des Johann Schnewli,
wohl die im Necrol. von Güntherstal als am 24. November + bezeichnete
Margarethe Snewli dicta Kolmennin“. Nachdem er die Elisabeth Kolmennin,
die vorerwähnte Mutter des Edelknechtes Snewlin Kolman, irrtümlich
bereits anderwärts untergebracht, blieb eben für den Konrad Kolman-Jud,
der übrigens dem Geschlechterbuch unter dem Namen nicht bekannt ist,
nur die Margaretha übrig.
Konrads noch 1330 (Februar 15 Fbg.) als Bürgerin von Freiburg einen
Verkauf an das Heiliggeistspital vollziehender Mutter, der „Frau Berthe
Kolmennin / hern Cuonrat Kolmans“ sel. Witwe, wurde nebst deren
jüngsten Söhnen Johannes und Nikolaus bereits gedacht. Das
Geschlechterbuch gibt die Altersfolge der drei Brüder in der Reihe:
Johannes, Nikolaus, Konrad, was in den mir zu Gesicht gekommenen
urkundlichen Ausweisen keine Bestätigung findet und auch an sich schon
durch die Annahme des Vaternamens für den Jüngsten unwahrscheinlich ist.
Als Gatte Bertas nimmt das Geschlechterbuch den 1258 bezeugten
„Conradus junior“ an, das Epitheton als Unterscheidung gegenüber dem
Vater deutend, als welcher der gleichzeitig (Sept. 22) als Zeuge
urkundende „C(onrado) dicto Colman senior“ in Anspruch genommen wird.
Dann könnte der „her Colman ein ritter“, der 1298 (Jan. 22) als Mage
der Brüder „Lanze von Nicolawes von Valkenstein“ urkundet, der Vater
der Brüder Heinrich und Wilhelm sein. Seine in der Verehelichung mit
einer Tochter des Geschlechtes begründete Magschaft – wobei jedoch
nicht an Berta zu denken – käme ja auch durch den bei den
Falkensteinern üblichen Namen des ältesten seiner beiden Söhne zum
Ausdruck, und auch das Auftreten von nicht weniger wie drei
Falkensteinern unter den Bürgen des Sühnebriefes von 1314 spricht für
ein näheres Verwandtschaftsverhältnis. Es ist vermutlich identisch mit
dem schon erwähnten „her Colman“, dem 1306 (Febr. 11) Herr Hug von
Üsenberg Urfehde schwor; vielleicht auch mit dem, Kindler von Knobloch
unbekannt gebliebenen „Colmanus scultetus“ von 1275 (Febr. 23). Ob hier
„Colman“ als Taufname zu gelten hat, oder dieser, wie in einigen
anderen Fällen, nur zufällig gegenüber einer prominenten Persönlichkeit
unterdrückt ist, lasse ich dahingestellt. Kindler von Knobloch ist an
diesen sich unmittelbar aufdrängenden Fragen kurzerhand vorbeigegangen.
Für die Zuteilung der „Margaretha Sneweli dichta Kolmennin“ bieten sich
einstweilen keinerlei Anhaltspunkte. Vor allem entbehren die
Bemühungen, für die letzten Besitzer der wilden Schneeburg zum
mindesten ein Verwandtschaftsverhältnis zu den Snewlin durch
Verschwägerung zu konstruieren, jeglicher sichern Grundlage. Wenn
Pfaff, im Widerspruch zur unkundlich bezeugten Erwerbung durch Kauf,
a.a.O. sagt: „Wahrscheinlich kamen die Kolmannen nur durch Heirate in
ihren Besitz, denn Konrad Kolman nennt um 1312 Johanns Snewlin selig
seinen Schwäher“ – das ist Schwiegervater-, so ist die aus dieser
Tatsache abgeleitete Folgerung, da ja dieser Konrad keinen Anteil an
dem Burgbesitz seiner Vettern hatte, ebenso völlig unzutreffend wie die
Angabe Gießlers, der in seiner Geschichte des Wilhelmitenklosters zu
Oberried „den Wegelagerer Ritter Kollmann einen Schwager der
Schnewelin“ sein läßt. Die beiden von ihm in eine Person verschmolzenen
Besitzer der Burg waren damals weder im Besitz der Ritterwürde noch
irgendwie nachweisbar mit den Snewlin verschwägert. Die durch nichts
begründete Annahme gedachter Verschwägerung hat aber in Verbindung mit
der den oberflächlichen Betrachter verwirrenden Gleichnamigkeit
verschiedener Snewlin und Kolman nicht wenig zu den das tatsächliche
Geschichtsbild entstellenden Ausführungen beigetragen, aus welchen das
unhaltbare Fundament der von einer fesselnden Räuberromantik umwobenen
Snewlin-Kolmann-Legende gebildet wurde, die namentlich in der beliebten
Ausmalung der Vorgänge bei der Zerstörung der wilden Schneeburg ihre
üppigsten Blüten getrieben. Es muß ausdrücklich betont werden: Mehr als
aus den beiden Sühnebriefen von 1315 (Juni 1 und Juli 15) herauszulesen
ist, wissen wir über den Fall der Burg nicht. Wir wissen nicht einmal
genau, wann sie gebrochen wurde. Bader spricht vom Frühjahr 1315, ein
andermal, ebenso wie A. Poinsignon, von 1314. Allein Gießler, der uns
die meisten Einzelheiten zu erzählen weiß, kennt sogar den Tag:“ Nach
heftigem Kampfe“, so berichtet er, „wurde dieselbe am 29. September
1314 von der Freiburger Bürgerschaft unter Führung ihres Grafen Konrad
erobert, ausgebrannt und dem Erdboden gleichgemacht. In Oberried geht
heute noch die Sage, daß eine Magd die Verräterin gespielt habe, indem
sie den Freiburgern mit einem weißen Tuche winkte, als die Burgherren
mittags zu Tische saßen. Die Freiburger hätten dann dieselben plötzlich
überfallen und alle erschlagen.“ Alles das wäre geschehen fünf Tage,
nachdem die Stadt ihren Bundbrief gegen die Brüder Kolman
angeschlossen, und sogar noch eine Woche vor dem Sühneabkommen, das
vermutlich unter diesem Druck mit den angeblich Erschlagenen zustande
kam, in dem aber von der Zerstörung der wilden Schneeburg mit keiner
Silbe die Rede ist. Wo Gießler seine haltlose Angabe her hat, sagt er
nicht. Das im Karlsruher Generallandes- sowie in den Freiburger
Archiven vorhandene urkundliche Material liegt für die in betracht
kommende Zeit in den von Stadtarchivar Dr. Hefele für das geplante
Freiburger Urkundenbuch aufs sorgfälltigste bearbeiteten Manuskripten
geschlossen vor. Es berechtigt, die Datierung des Falles der Burg auf
den 29. September 1314, da jedenfalls aus keiner urkundlichen Quelle
geschöpft, ebenso in den Bereich der Sagenbildung zu verweisen, wie die
Geschichte von der verräterischen Magd. Graf Konrad war bei der
Zerstörung der Burg und dem daraus entbrannten Krieg offenbar überhaupt
nicht beteiligt.
Unverständlich ist es, wie diese irrige Vorstellung vom Gang der
Ereignisse auch in dem Geschlechterbuch Eingang finden konnte. Hier
wird gesagt, daß sich „die Bürger von Freiburg 1314. 24.9. mit dem
Grafen von Freiburg und vielen Adligen verbündeten, die Burg einnahmen
und dem Erdboden gleich machten.“ Und unmittelbar anschließend gleich
weiter: „Heinrich war in Gefangenschaft der Freiburger geraten und
mußte nebst seinem Bruder unter Stellung zahlreicher Bürgen 1314.5.10.
Urfehde schwören“ usw.
Diese Angaben lassen doch fraglos nur die eine mit dem urkundlichen
Bild unvereinbare Deutung zu, die Zerstörung der Burg sei zwischen dem
24.September und 5. Oktober 1314 erfolgt und dabei Heinrich gefangen
worden, ein Irrtum, der sich allerdings auch schon in Schreibers
Stadtgeschichte eingeschlichen hatte und unmittelbar hieraus auch von
Bader in seinen in der Badenia veröffentlichten Aufsatz „Eine
Schwarzwaldwanderung“ übernommen worden war. Das Geschlechterbuch hätte
jedoch, nachdem die erschlossenen, urkundlichen Quellen leicht
zugänglichen waren, nur aus diesen schöpfen dürfen, und diese lassen
nicht den geringsten Zweifel, daß die Zerstörung der wilden Schneeburg
erst nach dem 5. Oktober erfolgte, wenn sie uns auch über den Tag, an
dem sich ihr Schicksal vollzog, keinen Aufschluß geben. In dieser
Hinsicht ist ja schließlich auch Bader zu einer richtigeren
Urkundenauslegung gelangt, wenn auch sein Zeitangabe – „Frühjahr 1315“
– nur als eine schätzungsweise, der Wirklichkeit allerdings vermutlich
näherkommende, angenommen werden darf.
„Die wilden Schneeberger“ hat Bader eine jüngere Abhandlung darüber
betitelt, und die Erzählung in seiner Schwarzwaldwanderung beschließt
er mit den Worten: „Seither liegt die Veste als wilde Schneeburg in
ihren Trümmern.“ Auch dieses die Tatsachen entstellende assoziative
Gedankenspiel ist bezeichnend. Nicht der Charakter der Burg, die rauhe
Lage des Felsennestes im hohen Schwarzwald, hätte, so könnte man
darnach glauben, dieser jüngeren Feste gegenüber jener gleichen Namens
auf dem Schienberg die Bezeichnung als „der nuwen unde wilden
Snevspurg“ verschafft, wie sie von Anbeginn genannt wird, sondern in
Erinnerung an die Untaten der wilden Raubgesellen, die hier ihren Horst
errichtet, habe der Volksmund den spärlichen Trümmern, welche noch von
der Stätte ihres verworfenen Treibens Kunde geben, den treffenden Namen
beigelegt. „Das Räuberschloß“ wird, wohl auf Grund der umgehenden Sage,
wie Poisignon berichtet, ein wilder Felszacken über dem Gefällmattenhof
genannt.
Erhalten hat sich von der Burg soviel wie nichts. Ihre „nur aus
Mauerbrocken und Steingeröll, untermischt mit Mörtelstücken,
bestehenden, doch unverkennbaren Reste“ unterhalb der Gefällsmatte,
deren Pfaff und wörtlich gleichlautend Gießler gedenkt, würden uns ohne
anderen Zeugen ihrer einstigen Existenz diese kaum verraten. Ob sie
gleich nach ihrer Einnahme „dem Erdboden völlig gleich gemacht wurde“,
zu welchem Behufe sofort nach Niederlegung des Hauses in der Stadt „die
bestaubten Arbeitsleute mit ihren Zerstörungswerkzeugen unverweilt
aufbrachen“ – wie Bader zu berichten weiß -, mag dahingestellt bleiben.
Von der ungefähr sechs Jahrzente später zerstörten Snewlinschen Feste
Birchiberg wird berichtet, daß die Freiburger sie, nachdem sie
„gewunnen wart“, vollständig „brachent / und gentzlich darnider
wurdent“, bie deren Lage an dem niedern Berghang des Möhlintales
immerhin eine einfacher Aufgabe. Der Feste am Hochfarren wird dagegen
noch zwei Jahre nach ihrem Fall in einem Anno 1601 vidimierten
Kaufbrief vom 12. April 1317 als der „Burg der man sprichet die wilde
Schneberg“ in einem Sinne gedacht, woraus man schließen möchte, es sei
doch noch etwas mehr übrig geblieben als nur ein Trümmerhaufen. Auch
der Wortlaut des Sühnebriefes vom St.Margartentag 1315 spricht für eine
solche Annahme. Immerhin scheinen die Freiburger gründliche Arbeit
geleistet zu haben, da sie ja nicht nur die Burg „brachen“, die
erbeuteten, von Bader unerwähnt gelassenen, Wallachen ("die Meiden“),
zwei Kühe und ein Maultier, den Bestand an Waffen, Wein, Mehl usw.
hinwegführten, was wiederum darauf schließen läßt, daß der Bau
erst nach wohl nicht allzuschwer gefallener Einnahme in Flammen
aufging, sondern auch den zugehörigen Wald verwüsteten. Der Sühnebrief
von 1355, der nur noch von dem "burgstal“, also der Ruine, spricht,
lässt jedenfalls erkennen, daß die Stadt da in ihrem Besitz gelangte
Bauwerk nicht mehr unter Dach brachte. Nachdem es einmal seinem Zerfall
überlassen, werden die harten Winterstürme verhältnismäßig rasch das
ihrige getan haben, um das ausgebrannte, gebrochene Gemäuer gänzlich
niederzuwerfen, von Menschenhänden wie überall durch Inanspruchnahme
des irgendwie anderweit Verwendbaren redlich unterstützt.
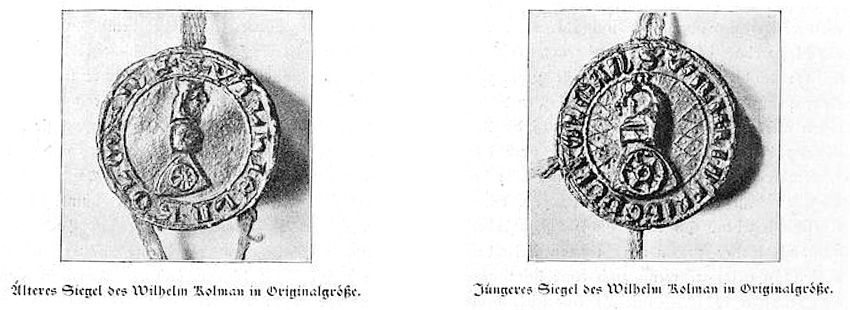
|
Berichtigend muß schließlich noch einmal in einem nicht unwesentlichen
Punkte an die Ausführungen des Geschlechterbuches herangetreten werden.
Was uns auf Grund der Arbeit Kindlers von Knobloch bis jetzt geboten
wurde, stellt schon dem Umfange nach eine geradezu bewundernswerte
Leistung dar, auch wenn man die Mitarbeit anderer mit in Rechnung
stellt. Daß der Verfasser dabei jedes einzelne genealogische Bild
ausnahmslos zu demjenigen Maß von Klärung gebracht, daß an der Hand des
verfügbaren urkundlichen Materials überhaupt erreichbar ist, wird man
billigerweise, da über die Kraft eines einzelnen weit hinausgehend,
nicht erwarten dürfen. Unter diesem Gesichtspunkt sind die
unterlaufenen Irrungen zu beurteilen.
Für den Heraldiker völlig unfaßbar ist dagegen die Auslegung welche
seitens Kindlers von Knobloch das von ihm abgebildete Kolmannsche
Wappenbild erfahren hat.
Das
Wappen des Geschlechts ist uns nur durch dessen ausnahmslos dem 14.
Jahrhundert angehörende Siegel überliefert. Unter den mir bekannt
gewordenen sind jedoch nur drei Helmsiegel. Zwei derselben gehören dem
Wilhelm Kolman. Das ältere, mit ausnahmsweise links geneigtem Schild
und dessen Form nach um 1300 entstanden, hat die Legende: "+S´.
WILHELN.KOLMAN“. Die zum Teil etwas undeutliche des jüngeren lautet:
"S. WILHEL´I. D`. FRIb´G. DCT. KOLMAN.“ Dieser erstmals an der Urkunde
vom 1. Juni 1315 nachgewiesene Neuschnitt, dessen sich Wilhelm auch
noch bediente, als er bereits im Besitz der Ritterwürde war (das Siegel
hängt der Urkunde von 1326 an), ist vermutlich durch den Verlust des
älteren Stempels bei Zerstörung der wilden Schneeburg veranlaßt und
anscheinend auch nicht in Freiburg gefertigt worden. Bemerkenswert ist
der Wechsel in der Legende durch Einschaltung der Herkunftsbezeichnung.
Das verschiedenen Urkunden anhängende dritte ist dasjenige des
Edelknechtes Konrad Kolman gen. Jud. Die Legende lautet: "+S`.
KUNRADI.DICTI. COLMAN.“ Mangelhaft bereits durch Schreiber in dessen
Urkundenbuch abgebildet, hat es offenbar auch der Wappenzeichnung im
Geschlechterbuch als Vorlage gedient.
Dazu wird nun gesagt: "Die Siegel zeigen im gerandeten Schilde ein
achtspeichiges Rad, das Siegel der Ek. Conrad 1314 zeigt als Helmzier
einen Adlerhals mit einem Hufeisen im Schnabel, welche Helmzier auch
die von Tußlingen führten.“
Die beiden Siegel des Wilhelm Kolman scheinen Kindler von Knobloch
unbekannt geblieben zu sein, ein Beweis, daß ihm die Originalurkunden
in Freiburger Stadtarchiv nicht zu Gesicht kamen. Das jüngere des
Wilhelm hat nur sechs Radspeichen, ebenso die helmlose seines Bruders
Heinrich sowie des Johannes, dessen jüngeren Bruders des Kolman Jud.
Doch das ist für die Blasonierung irrelevant.
Dagegen handelt es sich bei dem mit Ohren ausgestatteten Vogelkopf des
Helmschmucks keineswegs um einen Adler, sondern um einen Vogel Strauß,
in der typischen Auffassung des Mittelalters. Mit Ohren hatte man sich
wohl auch den Greif gedacht, den Adler niemals. Sie fehlen mitunter
auch dem Vogel Strauß (mittelhochdeutsch: "strüz, strüs, strouze,
strouse“, aus lat. "struthio“), das Hufeisen aber ist ein Attribut, das
einzig ihm zukam. Das hätte Kindler von Knobloch unbedingt wissen
müssen. Bot doch ausreichende Belege dafür schon G.A. Seyler in seiner
klassischen Geschichte der Heraldik.
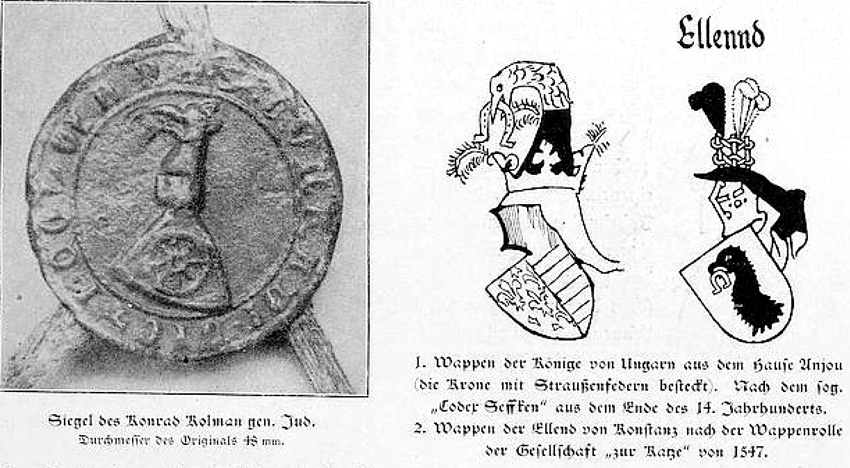
|
" Den schilt den wil ich gesten
den Aggalon do fuorte da
sin velt erlühe lafürbla
dar inne stuont von golde ein strüz
dem hiene ze sinem snabel uz
ein silberwiz rosisen“,
sagt Meister Konrad von Würzburg (+1287) vom Wappen des Königs Aggalon
im "Trojanischen Krieg“. Und in Übereinstimmung mit der Darstellung im
sog. "Codex Seffken“ beschreibt Peter Suchenwirt (+um 1395) den
Helmschmuck des Königs von Ungarn:
"Den stauzzenhals hermeleinen
sein augen von rubeinen
gleisten gen der veinde schar:
der snabel ist von golde gar
darin er fürt ze preisen
gestalt als ein hufeysen
gepogen chlar von golde rein
gekrönet ist daz howbet sein
mit golde reich.“
So ist denn auch das Wappenbild der Ellend von Konstanz, das Kindler
von Knobloch a.a.O. gleicherweise als "Adlerhals mit einem natürlichen
Hufeisen im Schnabel“ anspricht, wiederum nichts anderes als ein
Straußenhals, was zugleich auch die Straußenfedern auf dem Helm
anzeigen, die jedoch nicht, wie er auf Grund der verballhornisierten
Abbildung meint, aus einer "durch sieben (3. 4) g. Ringe gebildeten
Krone“, sondern aus einem sog. "Gebünde“, einem Zaun aus Flechtwerk,
herauswachsen, worüber die Wappenrolle der Konstanzer
Geschlechtergesellschaft "zur Katze“ keinen Zweifel läßt.
Das Hufeisen ist eben – ich wiederhole es – in der mittelalterlichen
Kunst, nicht nur ein untrügliches, sondern oft genug das einzige
Merkmal, durch das erkannt wird, daß ein Vogel Strauß dargestellt
werden sollte.
In dem am ehesten einem Rebhuhn vergleichbaren Federvieh, das unter den
teils symbolischen, teils groteskenhaften Vierpaßfüllungen der
Portallaibungen der Kathedrale zu Lyon auftritt, würde man ohne das im
Schnabel getragene Hufeisen ebensowenig einen Strauß zu erkennen
vermögen, wie in dem papageienartigen, kurzbeinigen, blauen Vogel im
Schild und auf dem Helm der Heydek in Schwaben in der Züricher
Wappenrolle. Das dem Ende des 15. Jahrhunderts entstammende, auf Schild
und Helm einen Straußen zeigende Siegel des Freiburger Ratsmitgliedes
Eberhart Strauß, das ich in der von Dr. Hefele geleiteten und bereits
zu stattlichem Umfang angewachsenen, ungemein wertvollen Wappensammlung
unseres städtischen Archivs gefunden, ist der einzige mir bekannt
gewordene Fall, wo auf das traditionelle Attribut verzichtet ist.
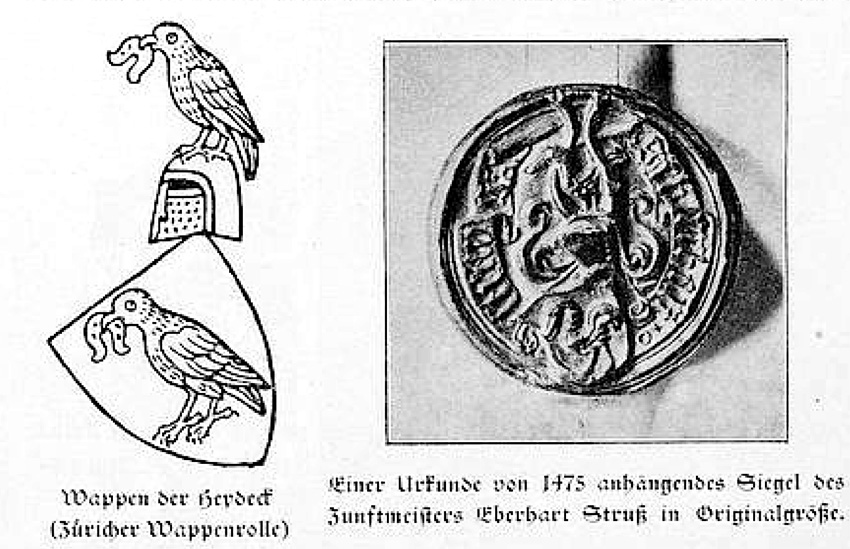
|
Der exotische Vogel war eben bei uns den meisten Darstellern nur nach
seinen aus den Bestiarien übernommenen Lebensgewohnheiten bekannt, denn
auch sein kostbares Gefieder kam – wenn desselben vereinzelt auch schon
früher gedacht wird – eigentlich erst seit dem 15. Jahrhundert als
prunkvoller Hut- und Helmschmuck neben den zuvor beliebten heimischen
Reiher-, Hahnen- und Pfauenfedern zu allgemeinerer, im Verlauf der 16.
Jahrhunderts allerdings dann auch zu denkbar üppigster Anwendung.
Die Vorstellung, welche sich das Mittelalter von den fremden Tieren zu
eigen gemacht, wird nun aber namentlich von dem Glauben beherrscht, daß
es eine unwiderstehliche Begierde nach dem Genuß von Eisen habe.
In
dem Bestiaire d´amour des Richard de Fournival sehen wir einen Vogel
Strauß, nachdem er eben ein Ei gelegt, das auszubrüten er nun geruhsam
der Sonne überläßt, nach getaner Arbeit sich an einem Hufeisen
erquickend, stolz davonschreiten, und in dem reich mit Bildwerk
geschmückten, dem Anfang des 14. Jahrhundert entstammenden Psalter der
Königin Marie von England begegnen wir der Darstellung, wie ein Mann
einen Vogel Strauß dadurch anzulocken sucht, daß er ihm Nägel und
Hufeisen vorwirft. In seinen nicht viel jüngeren Buch der Natur
berichtet aber der Regensburger Kanonikus Konrad von Megenberg (+1374)
"Von dem Strauzen“: "Strucio haizt ain strauz und haizt in kriechischer
sprach assida und haizt auch camelon 7 dar umb er gespalten fuez hat
als ein kammel.....er izt eisen und verdaut daz / wan er ist gar haizer
natur. Er hazzet die pfärd von natur und laidigt si wa er mag / und dar
umb fürhtent in diu pfärt gar ser und hazzent in also vast daz si in
niht getürrent angesehen.“
Wie diese Vorstellungen entstehen konnten, darüber unterrichtet uns die
Ausführungen des Basler Hochschullehrers Sebastian Münster, der in dem
von "Affrica mit seinen besondern Ländern / Thieren / und
wunderbarlichen Dingen“ handelnden Buche seiner bei Petri erstmals 1544
und fernerhin in nicht weniger wie 24 deutschen Ausgaben verlegten
Kosmographie "Von den Straussen“, welchen er ein besonderes Kapitel
gewidmet, zu erzählen weiß: "So man diesen Vogel abthuot / findet man
gemeinlich in seinem Magen stein / und etwann Eysen / und die sol er
verzeeren so sie lang bey jm geligen.“ Wenn er, ohne Schaden zu nehmen,
Steine verschlingen konnte – und das scheint erwiesen -, warum sollte
er nicht auch Eisen verdauen können, wenn er sich Zeit dazu ließ? Auch
der Künstler, der die Illustration zu dem Kapitel gefertigt, hat sein
Straußenbild offenbar nicht allein aus der Tiefe des Gemüts geschöpft.
Aber neben den Vogel zur Kennzeichnung seiner Neigung ein Hufeisen zu
legen, konnte er doch nicht unterlassen, wozu er ihm, in Bereicherung
seines Speisezettels wohl von künstlerischen Erwägungen geleitet, zur
Abwechslung einen mächtigen Schlüssel in den Schnabel gab.
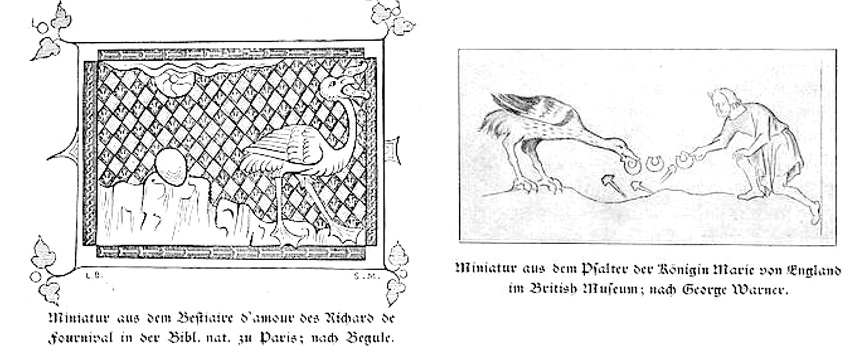
|
"Dieser verwandelt sich Eisen in Speiße“, sagt vom Strauß selbst
Leonardo da Vinci, ein Mann, der sonst in der richtigen Erkenntnis
solcher Dinge seiner Zeit weit vorausgeeilt, ein Beweis, wie fest und
unerschütterlich die eingelebte Vorstellung allgemein im Volksglauben
Wurzel gefaßt.
Durch diese vermeintliche Eigenschaft wurde nun der Vogel im
Mittelalter gerne mit allem in Beziehung gebracht, was irgendwie mit
Eisen zu tun hatte, wobei der naiven Kunst das auch als "isen“ kurzweg
bezeichnete Hufeisen im Schnabel als feststehendes, allbekanntes
Attribut den Mangel anderer ausreichend kenntlich machender Merkmale
ersetzen mußte. So zeigt den auch das Siegel der Stadt Leoben – des
Hauptstapelplatzes steirischen Eisens – einen Strauß. Ein Hufeisen im
Schnabel, ein zweites mit dem rechten Fuß emporhaltend; und nach
Siebmacher führten zu Wartberg im Komitat Preßburg einen solchen auch
die Schmiede, die sonst allerdings fast allgemein als Feuerarbeiter den
Lindwurm zum Wappenzeichen ihrer Zunft erkoren hatten. Doch auch vom
Strauß glaubte man, daß er glühendes Eisen und glühende Kohle
verschlingen könne. Und in Freiburg finden wir den Strauß als
Wappenbild bei den Schmiedefamilien Buckeisen und Biehler, bei ersteren
auch als Helmzier, bei letzteren statt dessen drei Straußenfedern;
ferner, mit seinem langen Schnabel allerdings mehr einem Storch
vergleichbar, auf dem Siegel des Satzbürgers Kapitänleutnant Franz
Christoph Eisenschmied von 1717, dessen unbekannter Ahnherr, wie Wort-
und Bildnahme untrüglich bezeugen, fraglos gleichfalls am Amboß
gestanden. Und wenn wir erfahren, daß ein Hans Struß in dem
Steuerregister von 1481 als der Schmiedekunst zugehörig verzeichnet
ist, so wird man angesichts seiner Wappenführung auch auch für den
gleichzeitig belegten bereits erwähnten Eberhart Struß, obwohl er als
Meister der Tuchkunst im Rat saß, dieselbe Herkunft unterstellen dürfen.
Für Freiburg sind durch die Herrschaftsrechtsregister für die Zeit nach
1400 allein in der alten Stadt auch nicht weniger wie fünf Häuser "zum
Strauß“ nachgewiesen, jedoch nur in einem einzigen Falle, und zwar für
1565 durch einen Angehörigen der Familie Biehler, Beziehungen in
gedachtem Sinne. Das schließt jedoch, da die Entstehung der Hauszeichen
jedenfalls über die Zeit der ältesten Einträge weit zurückreicht,
angesichts des häufigen Besitzerwechsels in fraglicher Zeit die
Wahrscheinlichkeit nicht aus, daß solche ursprünglich bei all den
gedachten Häusern bestanden. Auf nach Art und Zeit unzulässigen
Voraussetzungen fußend, entbehrt die dem entgegenstehende Erklärung
Götzes der objektiven Begründung, wenn er sagt: "Ihn (den Vogel Strauß)
wählte zur Hausmarke wohl, wer die Straußenfeder als Helmzier führte,
wie der Habsburger die Pfauenfeder, also ein Edelmann, und so trifft es
sich gut, daß als ältester Träger des Namens Strauß in Basel 1286 ein
nobilis vir Cuonradus dictus Striuz de Wartenberg erscheint.“ Von den
bekannten älteren Freiburger Geschlechtern ist bis jetzt keiner mit
gedachter Helmzier erwiesen, und sie dürfte vermutlich ebensowenig für
den zur Stütze der Hypothese herangezogenen Basler Edelmann nachweisbar
sein, dessen Wappenführung mir nur hinsichtlich des Schildbildes
bekannt ist.
Mit diesem symbolischen Gehalt gewinnt nun aber auch das von den Kolman
gewählte oder lehensweise übernommene Helmkleinod einen bis dahin
unbeachtet gelassenen Betrachtungswert. Dasselbe erschließt uns nicht
nur die eigentliche Bedeutung des Namens, sondern gestattet zugleich
Rüchschlüsse auf die berufliche Herkunft des Geschlechtes, die auf der
festen Grundlage der gegebenen örtlichen Verhältnisse aus dem Bereiche
der Hypothese so viel wie völlig in den gesicherter Tatsachen gerückt
erscheinen.
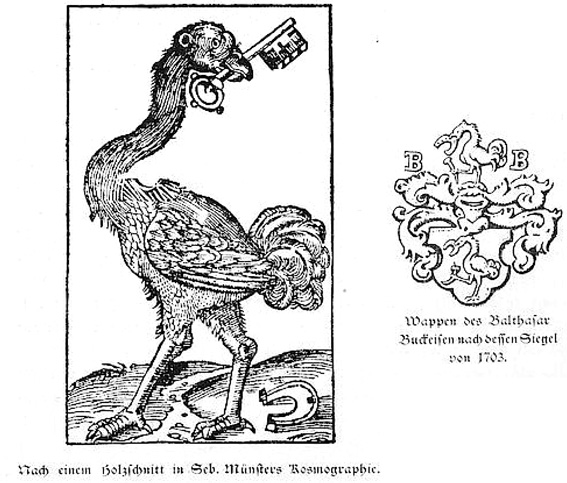
|
Gleich den verschiedensten Wurzeln, aus welchen die Nachnamen
erwachsen, sind auch die Ursachen, welche im einzelnen Falle die
Wappenwahl bestimmten, meist nicht zu ergründen. Die einen oder anderen
unserer Geschlechterwappen mögen mit einem Lehens- oder sonstigem
Besitzverhältnis in Zusammenhang stehen, Beziehungen, die sich mehrfach
in Helmzeichen nachweisen lassen. In anderer wiederum äußert sich eine
örtliche oder berufliche Ableitung, die ja namentlich auch in der
Wortnamensbildung eine große Rolle spielt, allerdings hierbei sowohl
wie in ihrer Verbildlichung oft nur in andeutender und darum nicht
immer unmittelbar sinnfälliger Form.
Zwei bezeichnende Beispiele letzterer Art bietet die Züricher
Wappenrolle mit dem Wapen des schwäbischen Geschlechtes der "Stuben“
sowie dem der "Suls“ von Zürich. Die "stube“ (englisch: "stove“, der
Ofen) ist das heizbare Gemach. Eine Stube ließ sich nach den
Grundsätzen der Heroldskunst nicht gut darstellen. Der Mann wählte also
einen wesentlichen Bestandteil derselben, das Glasfenster, das er auf
den Helm und zugleich dreimal in den Schild setzte. Das Wappen der Suls
zeigt auf dem Helm und im Schild eine Kufe. Hier ist die Beziehung
zwischen Wort- und Bildname scheinbar weniger in die Augen springend;
für die Zeitgenossen war der Zusammenhang jedoch auch da ohne weiteres
klar. Kaum eine andere Legende ist im Mittelalter, namentlich auf
Fenstergemälden häufiger dargestellt worden, wie diejenige des hl.
Nikolaus von Mira, und darunter gerade mit besonderer Vorliebe die
Szene, wie derselbe drei geschlachtete Knaben zum Leben erweckt, die
sich aus der Kufe erheben, in der sie eingesalzen werden sollten. Das
mittelhochdeutsche "sulzen“ bedeutet einsalzen. "Sulz“ (Suls) ist das
Eingesalzene. Das war natürlich wappenmäßig wiederum nicht gut
darzustellen. Man behalf sich darum mit dem zu seiner Aufnahme
dienenden Gefäß, das zwar an sich in nichts die ihm dabei zugedachte
Spezialbestimmung verriet, darum jedoch durch die Darstellungen des alt
und jung vertrauten Bilderbuches der Kirche ausreichend interpretiert
erschien.
Weniger offenkundig, aber darum vielleicht einer zwanglosen Erklärung
doch nicht unzugänglich ist die Beziehung zwischen Namen und Bild bei
dem bereits erwähnten Wappen der Ellend von Konstanz. Der Ellende ist
bekanntlich im Sprachgebrauch des Mittelalters derjenige, der in oder
aus einem fremden Lande, also fremd oder in der Fremde ist. Der Name
tritt als Zuname auch bei Freiburger Geschlechtern auf. Was mag nun
damit der Vogel Strauß zu tun haben? Ich glaube nicht, daß ihm hier die
übliche symbolische Bedeutung zukommt. Alles, zumal auch die Form des
Helmschmuckes spricht dafür, daß das Wappen nicht über das 15.
Jahrhundert zurückreicht. Früher ist das Geschlecht auch nicht bezeugt.
Wäre nicht eine Erklärung in dem Sinne denkbar, daß der Ahnherr
desselben im fernen Lande als Kaufmann durch den Handel mit
Straußenfedern oder gar durch eigene Straußzucht sein Vermögen
erworben, was er durch die in ein "Gebünde“ auf den Helm gesetzten
Straußfedern kund gab, während er in dem Schild den durch das Hufeisen
im Schnabel charakterisierten Kopf des Vogels aufnahm?
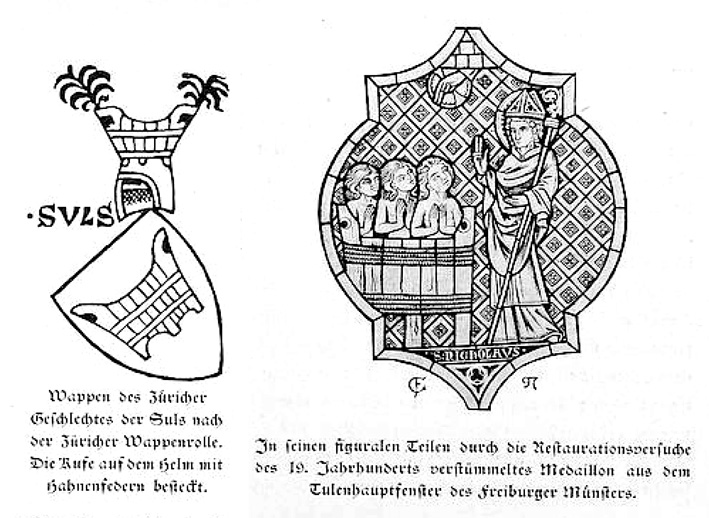
|
Die Quelle des Reichtums der Freiburger Kaufmannsgeschlechter entsprang
auf heimischen Boden. Schon frühe mag es neben anderen Unternehmungen
der Ertrag des breisgauischen Bergbaues gewesen sein, dessen Ausbeute
allmählich fast völlig lehens- und pfandweise in ihre Hände gelangt
war. Die Helmkleinodien verschiedener Geschlechter verraten ein solches
Lehensverhältnis. In erster Linie war es natürlich die Silbergewinnung,
und welche hervorragende Rolle dieser zukam, beweist der Börsenbericht
eines Italieners vom Jahre 1265 von der Messe der Champagne, in dem
derselbe neben dem Wert des Sterlings nur noch des ungemünzten "ariento
di Friburgho“ gedenkt. Daneben ging der Betrieb auf Blei und Eisen
sowie auf die Verarbeitung des letzteren, deren im oberrheinischen
Gebiet schon frühe gedacht wird. Ob die "zwene isenin fronteile“,
welche Graf Egeno 1303 (Juni 8) nebst einem Fronteil "ze dem
silberberge ze Oberriet“ dem Freiburger Bürger Gottfried von
Schlettstadt verleiht, die Auslegung gestattet, welche ihnen Dambacher
gegeben, lasse ich dahingestellt. Aber neben dem Stahl aus der
Lombardei geschieht in den Zollrodeln Freiburgs des "stahels von
Valckenstein“ Erwähnung. Hier oben im Zastlertal finden wir aber
Gleider der Kolmanschen Sippe bekanntlich zuerst bezeugt durch
"Chuonradus Bükenrüte“ schon bald nach dem ersten Drittel des 13.
Jahrhunderts. Daß die Kolman aber nicht erst durch die Erwerbung der ob
den einmündenden Schwarzwaldtälern gelegenen wilden Schneeburg hier
engere örtliche Beziehungen gewonnen, bekundet auch die Taufnamenswahl,
welche die Elter der beiden späteren Burgherren für diese getroffen.
Verrät sich bei "Heinrich“ die Versippung mit den benachbarten
Falkensteinern, so wurde die Wahl des in Freiburg damals keineswegs
häufigen Namens "Wilhelm“ fraglos im Hinblick auf den hl. Wilhelm von
Maleval, den Begründer des zu Oberied und Freiburg ansässigen
Wilhelmitenordens, gewählt. Und wenn uns auch keinerlei Pergamentbriefe
davon berichten, daß die Kolman hier oben ihre Tätigkeit mit der
Gewinnung oder der Verarbeitung von Eisen entfaltet haben, so spricht
dafür in kaum minder beredter Weise der erwählte Helmschmuck.
Von den sechs Kolmanschen Wappengenossen mit dem Wagenrad im gerandeten
Schilde, den Tußlingen, Bückenrüti, Stehelin, Kreier, Baldingen und
Endingen von Neuenburg, isz uns nur bei vieren auch der Helmschmuck
bekannt. Er ist bei zweien – den von Tußlingen und Stehelin – dem
Schildbild entnommen.teils ein halbes mit Kugeln besetztes, teils ein
ganzes Wagenrad. Die Endingen von Neuenburg führten einen mit Kugeln
besetzten Schwanenhals. Die späteren Wappenbücher geben, wohl
irrigerweise, auch den Tußlingen den Straußenhals; so auch dasjenige
des Kaspar von Baldung von Löwen von 1604 im Staatsarchiv zu Basel. Die
verlässigeren Siegel erbringen keinen Beleg dafür. Wohl aber besteht
zwischen dem Namen der Stehelin und dem Helmschmuck der Kolman – neben
diesem auch der Kreiern, die einzige, deren Name keine örtliche
Herkunftsbezeichnung darstellt – in der ersterem innewohnenden
Bedeutung eine innige Berührung, die eine Berufsverwandtschaft
offenbart; denn "stehelin“ ist das Adjektiv von Stahl. "So muuoz ich
sin gar stehelin und herter denne isen!“ heißt es im "Trojanischen
Krieg“ des Konrad von Würzburg. Liegt es nicht nahe, auf eine ähnliche
Beziehung zwischen Namen und Helmschmuck zu schließen, wenn wir sehen,
daß nach Grüneberg auch die "fry von Hardeck“ den Straußenhals mit dem
Hufeisen im Schnabel als Zimierde erkoren?
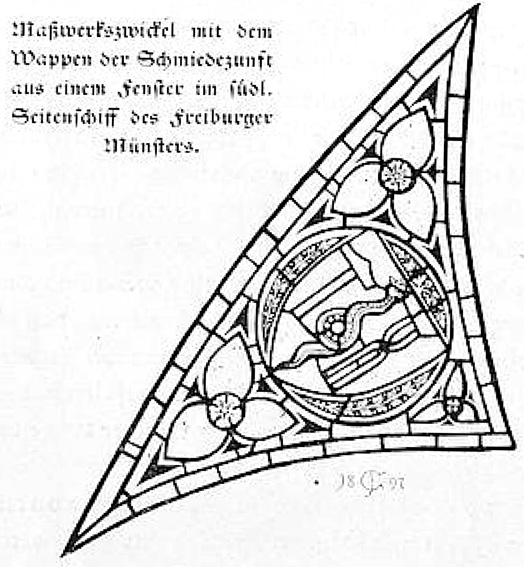
|
Die Wilkina-Sage, welche um 1300 aus mündlichen Erzählungen deutscher
Männer, die in Bremen und Münster geboren, sowie aus alten Liedern
deutscher Zunge zusammengesetzt ist, beschreibt den Helm von Welands
Sohn Wittig – ich folge den Angaben G.A.Seylers -: "...auf dem Helm war
ein Lindwurn gebildet, der Schlange genannt wird; dieser Wurm war
goldglänzend, das bedeutet Wittigs Ritterschaft; dabei war er
giftsprühend, und das bedeutet Wittigs Grimmigkeit. Der Schild war aber
weiß und mit roter Farbe Hammer und Zange darauf gemalt, weil sein
Vater ein Schmied war“. Also das traditionelle Wappenzeichen des
Schmiedehandwerks, mittels dessen auch der Minnesinger Barthel
Regenbogenseine durch eigene Aussage bekundete Abkunft zur Schau trug.
So mag auch dem ersten Kolman, der, gleich andern seines Standes
lehensfähig geworden, sich den Rittergurt um die Lenden band, der
mutmaßliche, als Unternehmertätigkeit zu erfassender Beruf seines
Vaters die Wahl des Kleinodes bestimmt haben, mit dem er den zum
ererbten Kaufmannsschild gewonnenen Ritterhelm schmückte, ohne darum
das einträgliche Kaufmannsgewerbe an den Nagel zu hängen; denn wenn
sich auch die Beschäftigung mit Kleinkram mit den Standesprätensionen
eines Ritters nicht vertrug, so verbot diese doch keineswegs den
Großverkauf in jeglicher Ware.
Der Nachweis, daß, näher besehen, auch ein unverkennbarer Zusammenhang
zwischen Wort- und Bildname der Kolman besteht, soweit letzterer im
Helmkleinod zum Ausdruck gelangt, setzt die Beantwortung der Vorfrage
nach der Deutungsmöglichkeit des ersteren voraus.
Auf dem unsicheren Gebiet der Namensdeutung umlauert uns die Gefahr von
Trugschlüssen an allen Ecken und Enden. Auch beim besten Willen wird es
schwer gelingen, angesichts verschiedener Auslegungsmöglichkeiten die
naheliegende Neigung völlig auszuschalten, derjenigen den Vorzug zu
geben, welche einer etwa vorgefassten Meinung am meisten entgegen
kommt.
Daß "ungründliche, schnell bereite Gelehrsamkeit gar leicht zu schnell
befriedigenden Antworten gelangt“, darauf hat einleitend auch Götze in
seiner wiederholt berührten, inhaltsreichen und anregenden Abhandlung
hingewiesen. Daß aber auch der berufene Forscher nicht immer sicher
über alle Fallstricke hinwegkommt, das beweisen auch seine eigenen
Auslegungsversuche. Im dritten, das Verhältnis der Familiennamen zu den
Geländenamen behandelnden Kapitel findet sich die Erklärung: “Von ihrem
Besitz bei den Föhren heißt die Familie Ferler, die in Freiburg 1460 in
der Schreibung Färler zuerst auftritt, während um 1530 ein und derselbe
Bürger Värler, Verler und Ferler geschrieben wird.“
Für die den Hauptbestand bildenden Freiburger Namen hat Götze leider
fast ausschließlich das Flammsche Häuserbuch herangezogen, das ja nur
vereinzelt über das 15. Jahrhundert zurückreichende Nennungen bietet.
Das gilt auch für den "Ferler". Die vorliegende Urkundenliteratur hätte
ihm anderfalls sagen können, dass das übrigens auch von Kindler von
Knobloch verzeichnet und von diesem irrigerweise später dem Stadtadel
zugewiesene bürgerliche Geschlecht zu Freiburg schon im 13. Jahrhundert
belegt ist. Durch volle drei Jahrhunderte begegnet es uns von nun an
unter den Ratsgliedern, und die urkundlichen Quellen hätten Götze
vereinzelt auch die seine Auffassung stützende Schreibweise "Förler“.
Geboten.
Und
doch ist diese ihm durch Gedankenverwandtschaft mit dem
vorhergehenden, aus einem Flurnamen "zem Boummilin“ entwickelten
"Bäumle“, und Bäumler“ nahegelegte Deutung falsch. "Verler“ kommt
nicht von "Föhre“, sondern von "Ferlin“, dem Deminutiv von "Varch“, der
Sau, also unserem heutigen Ferkel, dem jungen Schwein. "...Er verkauft
einem metzger ain saw mit dem ferlin / und wie er erfuere / das hernach
die saw geferlet und zwelf ferlin gehabt / ...“ ist in der Zimmerschen
Chronik zu lesen; weitere Belege bei Lerer (Mittelhochd. Wörterbuch).
Übrigens bietet auch schon das Flammsche Häuserbuch, dem Götze den
"Verler“ entnommen, eine völlig ausreichende Orientierung. Dieses
verzeichnet nämlich neben einem nahe dem schwabentor in der Gerberau
gelegenen Haus "zum schwarzen Fehrlin“ auch ein solches, "zum blauen
Fehrlin“ in der Kaiserstraße, das abwechselnd auch "zur blauen Sau“
genannt wurde. Zu alledem erfahren wir hier außerdem, daß in ersterem,
in dem durch zwei Jahrhunderte das Gerberhandwerk getrieben wurde, ein
Verler wohnhaft war. Fügen wir dazu noch die Tasache, daß die
Verler laut Ausweis eines Siegels des Peter Verler an einer Urkunde von
1411 (Juni 23) eine aufgerichtete Sau im Wappen führten, nach dem
weiteren einer Wappenscheibe aus dem 16. Jahrhundert auch auf dem Helm,
so dürfte jeglicher Zweifel über die Deutung des Namens ausgeschlossen
sein. Als Berufsname ist Verler nicht belegt. Wahrscheinlich liegt ein
aus der Berufstätigkeit abgeleiteter Übername vor, für welchen sich
nicht nur durch den aus dem Häuserbuch ermittelten Wohnsitz in der
Gerberau, sondern auch schon aus dem Zollrodel von 1396 ein gewisser
Rückschluß ergibt, in welchem als erster des Überwachungsausschusses,
der über die Ein- und Ausfuhr von "leder oder hüte gegerwet oder
ungegerwet“ gesetzt ist, "der Verler“ genannt wird, von weiteren
unedierten Belegen ganz abgesehen. Es ist nicht der einzige Berufsname
dieser Art; aber nirgends äußert sich die Namensbildung in so vielfach
variierten Anspielungen auf den Beruf wie bei den Eisen verarbeitenden
Gewerben. Die "Leg-, Been-, Vel-, Schrib-, Stern-, Gold-, Stolz-,
Hupsch-, Schuck-, Seng-, Menel-, Mol- und Grienisen“, welchen wir in
den Steuer- und Herrschaftsrechtsregistern des 15. Und 16. Jahrhunderts
begegnen, sind alle ebenso wie ursprünglich die "Buckisen“ Glieder der
ehrsamen Freiburger Schmiedezunft "zum Roß“. Und auch bei den als
Freiburger Schmiedefamilie nachgewiesenen Biehler wird man die
Ableitung des Namens vom Beruf im Sinne von "Beilschmied“ zu deuten
berechtigt sein; denn "biel, bihel“ ist das Beil.
Den im Flammschen Häuserbuch sechsmal vermerkten Namen "Kolman“ hat
Götze leider nicht in den Kreis seiner Betrachtungen gezogen. Auch bei
diesem dürfte jedoch, wie ich glaube, die nachstehend versuchte Deutung
durch den im Helmschmuck des Geschlechtes zum Ausdruck gelangenden
Bildnamenin gleicher Weise gestützt werden, wie diejenige des Verler
durch dessen auf Schild und Helm geführtes, den Beruf andeutenden
Zeichen, allerdings aus gleichen Gründen wie bei den "Stuben“, "Sulz“
und "Ellend“ nur in übertragenem Sinne.
Socin ordnet "Colman (Cholman)“ unter die aus Taufnamen entstandenen
Familiennamen, als welcher er unter unseren älteren Freiburger
Geschlechternamen ja auch nicht allein stehen würde. Ich nenne nur die
"Meinwart“ und "Reinbot“
Wir kennen zwei gleichbenannte irische Heilige, durch welche der
altgermanische Name auch eine besondere christliche Weihe erhalten hat.
Auf den einen oder anderen derselben mögen die Ortsnamen Coleman in
Texas und in der Südafrikanischen Republik, sowie der Coleman River in
Australien zurückgehen. Den einen führt sein Weg nach Österreich, wo er
1012 zu Melk den Märtyrertod erlitt. Auch "Coloman“ genannt, erinnert
der Colomanus-Berg beim Wallersee an ihn. Eines zwischen Brixen und
Trient gelegene Ortes "Colman“ wird in der Zimmerschen Chronik gedacht.
Damit wäre uns "Colman“ als Taufname ja nähergerückt; aber in
breisgauischem Gebiet ist er mir, wenn wir von den angeführten,
offenkundig als Rückbildung aus dem Familiennamen anzusprechenden
Fällen abgesehen, um die fragliche Zeit nicht begegnet.
Doch selbst wenn wir den Familiennamen Kolman als aus einem alten
Taufnamen erwachsen annähmen, so ist damit seine Entstehung noch nicht
erklärt. Faßt man ihn etymologische, so dürfte er wohl nur mit dem
mittelhochdeutschen "Koler“, das ist der Köhler oder Kohlenbrenner, zu
übersetzen sein.
Oder sollte die erste Silbe ursprünglich nicht "Col“ im Sinne von
"Kohle“, sondern "Colo“ gelautet haben, und Colmann nur die übliche
Koseform sein, entsprechend Hermann zu Heribert, Hartmann zu Hartmut,
Gallman zu Gallus usw., Bildungen, die namentlich im 14. Jahrhundert
bei uns erneut zusehens an Ausbreitung gewannen? Jedenfalls haben wir
auch "Koler“ und zwar schon im 13. Jahrhundert als Familienname und
nicht etwa nur in niederen Kreisen, sondern auch unter den
Geschlechtern; denn in der für 1218 belegten Nennung der Brüder
"Dietricus scultetus de Endingen et Colarius“ läßt sich letztere
ebensowohl als Nach- wie als Taufname erfassen, nachdem und für 1312
(Mai 1) mit "wir her Walter der Koler ein ritter und Kol min son“ die
gleichzeitige doppelte Gebrauchsform geboten ist. "COL . FILII .
COLERIS .“ so lautet die Legende auf dem Siegel des Sohnes. "Kol“ ist
aber nicht etwa eine Kürzung von "Koler“, sondern die mittelalterliche
Form für unser "Kohle“, die nach damaligen Sprachgebrauch sächlichen
und daneben auch männlichen Geschlechts war. Sollte zwischen den Kolman
und den Koler von Endingen vielleicht eine gewisse
Herkunftsgemeinschaft bestehen, eine Frage, zu der man berechtigt ist
angesichts der tatsache, daß nicht nur für 1290 (Nov. 3) ein "her
Buggenrüti“ zu Freiburg mit dem Beinamen "von Endingen“ bezeugt ist,
sondern auch der den Gebrüdern Heinrich und Wilhelm Kolmann anscheinend
besonders nahestehende Neuenburger Zweig der Sippe, von dem ein
Angehöriger den Sühnebrief von 1. Juni 1315 mitbesiegelte, sich
bekanntlich "von Endingen“ benannte. Den Namen "Koler“ leitet H. Maurer
von der bereits 1321 zerstörten Burg Koliberg (Kolberg 1408, Kolemberg
1494) ab. Mag sein; es ist auch umgekehrt denkbar. Das Topographische
Wörterbuch hat für letzteren die Erklärung "Berg des Kol“ zur Hand. So
oder so, es kommt für die Deutung des Namens auf dasselbe heraus.
Warum sollte "Kol“ in Kolman – denn die Schreibweise "Coloman“ kommt
bei der Failie nicht vor – anders auszulegen sein? Als Berufsname wäre
sie ja, obwohl dafür nicht belegt, den Zimberman, Rebmann, Vuormann
usw. analog, welchen allerdings außer "Zimmerer“ keine dem "Koler“
entsprechende gekürzte Form gegenübersteht. Zahlreich sind dagegen aus
dem 14. Jahrhundert bei uns die weiteren Namensbildungen gleichen
Sinnes, bald mit, bald ohne Dehnungs-"h“, wie Kohlplatz, Kohlstatt,
Kohlerhof, Kohlhalden, Kohlwald, Kohlplatz, Kohlstatt, Kohlbach usw.
"Bach des Col“ interpretiert das Topographische Wörterbuch, ananlog
"Kohlberg“, die letztere Nennung, und zu "Hof des Col“ müsste und
dementsprechend die an erster Stelle verzeichnet führen, die mehrfach
belegt (darunter auch für Überlingen durch den "Bertholdus miles
cognomine Colhofe“ des Eintrags aus dem 13. Jahrhundert in dem
Güterbuche des Klosters Salem), zugleich als Familienname auftritt.
Nehmen wir eine solche Auslegung an, wodurch ja diejenige der Silbe
"Col“ nicht erschüttert wird, so werden wir auch bei dem "Bach des Col“
nach diesem Kol selbst fragen dürfen.
Mit der Nennung "in dem sellande unter Colbach“, 1311 (Dezember 9 Fgb.)
– soweit mir bekannt – erstmals gelegt, begegnet uns weiterhin der
heute verschollene Name unter den wechselnden Schreibweisen "Kolbach,
Kolibach, Colenbach“ wiederholt, örtlich bestimmbar durch den Dingrodel
von Kirchzarten für das Tal und die Höfe bei Burg. Hier lag auch der
Kohlbacherhof. Soll man nun darauf hinweisen, daß das die Gegend ist,
wo wir der Kolmanschen Sippe schon bei ihrem ersten geschichtlichen
Auftreten begegnen und der "Bach des Col“ schließlich der "Bach des
Kolman“ sein könnte, obwohl sich der Name nicht nur hier findet?
"Kohlenbach“ heißt auch ein bereits 1314 nachgewiesener Zinken in der
Gemeinde Kollnau, von dem auch die "Kolenbächin“ her sein dürfte, von
deren Gut in einer Waldkircher Urkunde von 1337 (Februar 22) die Rede
ist.
Doch alle diese Nennungen können wohl einzig und allein als Anzeichen
von in der Nähe betriebener Köhlerei bewertet werden, und wenn sie sich
mit den Namen Kolman zusammenbringen lassen, so könnte das schließlich
nur in dem Sinne geschehen, daß eben auch dieser gleichen Ursprungs
ist.
Wo Erz gegraben und aufbereitet wurde, stellte sich auch der Köhler
ein. Eine "Ordnung den Ysenbach (Hammereisenbach) petreffend“ von 1533
enthält die Bestimmung:“ Zvm vierzechden sol man gedenken / das man
alwegen peym schmelzzofen und hamerschmiten anzal holcz nit also grien
kolen mueß / den groß schad pey ist / gibt auch pöß kolln.“ Doch nicht
nur für die Erzgewinnung, sondern nicht minder auch für die Eisen
verarbeitenden Gewerbebetriebe der nahen Stadt war die Kohle ein
wichtiger Bedarfsartikel. Zwischen den Zollsätzen für allerlei
"geschmide“ steht auch der für Kohle, deren Bedeutung auf dem Markt der
Stadt schon aus dem in der Münstervorhalle bereits 1292 eingehauenen
Normalmaß für den Kohlenverkauf erhellt. Die Köhlerei war darum
jedenfalls ein für den kaufmännischen Großbetrieb geeignetes, lohnendes
Gewerbe. So gab es denn wie Bergwerks- auch Kohler-Lehen. Sollte in dem
Unternehmerkreise, aus dem die älteren Freiburger Geschlechter
hervorgegangen, angesichts der gesamten örtlichen und zeitlichen
Verhältnisse, die Köhlerei nicht vertreten gewesen sein? Das ist doch
kaum denkbar.
Unter den Gläubigern der Stadt, welche ihr mit Darlehen zur
Befriedigung der immer und immer wiederkehrenden Ansprüche ihrer schwer
verschuldeten Grafen an die Hand gingen, stehen neben den mit großen
Summen vertretenen Juden sowie den mächtigen Snewlin und anderen auch
die Kolman; und wenn dazu in den Rechnungsaufstellungen der Stadt vom
20. Oktober 1328 vermerkt wird: "Die hant alle brieue / ane Colmannen“,
so wird man nicht erst fragen müssen, bei welchem Anlaß wohl deren von
ersterer anerkannte Schuldbriefe in Verlust geraten sind. Ist es eine
zu gewagte Hypothese, wenn man annimmt, daß sie die Mittel zu ihren
Darlehnsgeschäften auf dem gedachten Weg gewonnen? Sie werden
vielleicht nicht die einzigen Freiburger Eisen- und Kohlenbarone des
13. Jahrhunderts gewesen sein, aber es sind die einzigen, die sich
durch ihre Wort- und Bildnamen als solche untrüglich zu erkennen geben.
Dies als zutreffend angenommen, war das andauernde Zerwürfnis der Stadt
mit ihren auf der Feste am Hochfarren sitzenden Bürger vielleicht doch
einigermaßen anderer Art, als von Bader und seinen Nachbetern
unterstellt; offenkundige freie Erfindung zumal ist, daß das angebliche
höhnische Gekläffe des "Wolfs im Schafspelz“ schließlich den
unmittelbaren Anstoß zur Verwüstung des Kolmanschen Besitzes gegeben
haben soll. Es ist vielmehr nicht ausgeschlossen, daß etwaige auf
Schleichwegen bewirkte Umgehung des städtischen Durchganszolles,
worüber ständig Klagen und scharfe Abwehrmaßnahmen dokumentiert sind,
die eigentliche Hauptquelle des Streites gebildet, in welchem Falle
auch die im Sühneabkommen von 1314 stipulierte und seltsamerweise bis
zum vollen Ausgleich festgehaltene ungewöhnlich hohe Buße von 1000 Mark
Silbers verständlich würde, und das bezeugte Wegfangen von Freiburgern,
soweit es unter Fehderecht erfolgte, "als in semlichen kriegen
gewonlich ist“, nicht kurzerhand als "Wegelagerei“ gebrandmarkt werden
darf. Fiel doch späterhin aus verwandten Ursachen und unter ähnlichen
Begleiterscheinungen von gleicher Seite auch die zum Schutz des
bischöflich straßburgischen Bergwerklehens errichtete Burg Birchiberg
im Möhlintal der gänzlichen Zerstörung anheim, ein Besitz der Snewlin,
die wir übrigens mit guten Gründen auch als Erbauer und Vorbesitzer der
"nüwen vunde wilden Snevspurg“ vermuten dürfen. Nur in diesem Sinne
konnte von einem Zusammenhang des Besitzverhältnissen der Snewlin und
Kolman an letzterer gesprochen werden.
Die versuchte Deutung von Wort- und Bildname mit den daraus
abgeleiteten Folgerungen stützen Geschichte und Sage.
"Dann und wann kommen Leute hinabgewallfahrt und beten und glauben, der
Weland (zu Gloggensachsen in Tirol) sei ein großer Heiliger gewesen“,
läßt V. v. Scheffel in seinem Ekkehart den herzoglichen Kämmerer Spazzo
im Anschluß an die von diesem zum besten gegebene
"Grobschmiedsgeschichte“ sagen, gestützt auf die Acta sanctorum,
welche, "Welandus ab aliquibus Sanctus dictus....“ verzeichnen.
Laut verschiedenen Einträgen in dem im 16. Jahrhundert entstandenen
Urkundenrepertorien 1 und 2 des Heiliggeistspitals zu Freiburg hatte
"meister Wieland der schmid“ sein in der Vorstadt "Newenburg bey der
Brotlouben zwischen Menlis (Mendlis) des schmidts huß von Tentzlingen“
und "Fricken Schmider“ gelegenes, 1309 mit aller Zugehör von dem
Schlosser "Berhtold“ gekauftes Haus 1341 zu einem Viertel, 1347 völlig
"sinem sun Wyttichen“ – in letzterem Dokument "Wygken“ genannt – "zue
eigen“ übergeben. Könnte nicht gleicherweise eine entsprechende, mit
der Person des hl. Kolman verknüpfte, uns nicht mehr bekannte Legende,
die unter Umständen gerade aus der, wenn vielleicht auch nur
fälschlichen, Erymologie des Namens erwachsen, auch die Namenswahl des
Ahnherrn der Kolman von Freiburg bestimmt ahben, wie dem Schmiedmeister
in der Neuenburg der seine, den er dem Sohne als Familienname vererbt –
denn "Witich Wielant“ nennt sich dieser 1403 (Sept. 15) -, von dem zum
Heiligen erhobenen berühmten Sagenhelden seines Handwerks geworden war?
Der 1420 als Priester zu Straßburg verstorbene Jacob Twinger von
Königshofen berichtet in seiner bekannten Freiburger Chronik:
"Die sag ist / das die Hertzogen von Zeringen vor zeiten Köler sind
gewesen unnd haben ir wonung gehabt in dem gebirg / unnd den welden
hinder Zeringen dem schlos / da es dan itzund stehrt / unnd haben alda
kollen gebrent. Nun hat es sich begeben / das derselbige Köler an eine
ordt in dem gebirg kollen hatt gebrant / unnd hatt mit demselbigen
grund und erden den kolhauffen bedeckt / unnd den ungefert also do
ausgebrant.
Da er nun die kollen hinweg hatt gethan / hatt er an dem boden eyn
schwere / geschmelzte matery funden / unnd das also besichtigett / do
ist es gut silber gewesen / also hat er derfür immerdar an demselbigen
ordt kollen gebrant / unnd wider mit derselbigen erden und grundt
bedeckt / unnd da aber silber funden wie vor / darbey er hatt mercken
können / das es des bergs unnd des grundt schuldt sey / unnd hat
solches in einer geheim bey im behalten / unnd damit von tag zu tag an
demselbigen ordt kollen gebrandt / unnd ein grossen schatz silbers
darmit zusammen bracht.“
Die heimatgeschichtliche Forschung hat uns, wie wir gesehen,
Schilderungen aus längst vergangenen Zeiten geboten, die zum Teil
einigermaßen abirren von den Pfaden historischer Wahrheit, selbst da,
wo diese durch deutliche Wegweiser kenntlich waren. In dem entrollten
Sagenbild mit seinem zur Herzogswürde aufgestiegenen Köhler ist meines
Erachtens die von der unermüdlich schaffenden Phantasie der Volksseele
in gewohnter Übertragung auf ihrem Gedankenkreise vertraute Namen
spielend umgebildete Überlieferung wirklicher Geschehnisse unverkennbar.
Vorstehende Abhandlung ist im wesentlichen einer Serie gleichgearteter
kritischer Studien über die Snewlin von Freiburg entnommen, welche
ürsprünglich auszugsweise in gedrängtester Form meiner Untersuchung
über Freiburgs ersten Bürgermeister (Schau.-ins-Land 1913) als Exkurs
beigegeben werden sollten. Dort Raummangels halber ausgeschieden, mußte
deren Veröffentlichung aus anderen Erwägungen auch weiterhin
zurückgestellt werden. Ökonomische Rücksichten nötigten auch hier zu
möglichster Beschränkung und damit zum Verzicht auf die wünschenswerten
Quellennachweise. Wer das Bedürfnis einer Nachprüfung empfindet, dem
bleibt diese an Hand der gebotenen Angaben in der Hauptsache auch so
durchführbar. Eine völlige buchstabentreue Wiedergabe der angeführten
Urkundenstellen konnte insoweit nicht eingehalten werden, als die
erforderlichen Spezialtypen nicht zur Verfügung stunden.