
| Pater Jan Pieter Notermans S.C.J (1912-2005) |
 |
| Schloß Weyler zu Stegen bei Freiburg i. Brg. |
| Ein geschichtlicher Überblick über die Entstehung des Hauses von den ältesten Anfängen bis zum heutigen Tag (1942) |
|
|
|
Alles zur größeren Ehre Gottes. |
Eng angeschmiegt an den Abhang der Schwarzwaldberge liegt im
südöstlichen Dreisamtal, etwa 10 km von der Stadt Freiburg
i.Brg. entfernt, 3 km von Himmelreich am Ausgang des
Höllentales, auf dem Wege zwischen Kirchzarten über Eschbach
nach St.Peter die kleine Bauernortschaft Stegen.
Stegen, etwa 390 m über dem Meere gelegen, hat mit seinen drei
Nebenorten Rechtenbach, Oberbirken und Unterbirken einen
Flächeninhalt von 548 ha. Das Dorf zählt außer dem
reichsgräflichen Schloß Weyler mit Schlosskapelle 55 Häuser mit
Neben und Ökonomiegebäuden, darunter das Rathaus, welches mit
der Schule verbunden ist, drei Wirtshäuser und eine eigene Post.
Das Dorf hat in normalen Zeiten ungefähr 400 Einwohner, die
größtenteils Landwirtschaft und Viehzucht betreiben.
Der Ort ist von den Vorhügeln und den Ausläufern des Feldbergs,
Kandel und Rosskopf umschlossen und liegt genau am Fuße des
eigentlichen Hochschwarzwaldes. Bei klarem Wetter hat man von
hier aus einen prachtvollen Ausblick auf den König des
Schwarzwaldes, den Feldberg. Die kleine Anhöhe in der Nähe des
Rathauses ist das Reckeneck und beim Nadelhof der sogenannte
„Galgenbühl“, der einstigen Richtstätte der Herrschaft von
Weyler. Von hier aus hat man einen sehr schönen Ausblick in das
Dreisamtal bis hinein in die Vogesen.
Der Name „Stegen“ stammt, wie aus einer Urkunde des 13.
Jahrhunderts hervorgeht, von der Brücke über die Dreisam. Damals
sind die beiden Bäche „Wagensteigbach und Höllentalbach“
oberhalb ihres Zusammenflusses mit je einem Steg überbrückt
gewesen; Der Häuserkomplex nördlich davon wurde „oberhalb der
Stegen“ genannt. Die jetzige Betonbrücke befindet sich etwa 20 m
unterhalb des Zusammenflusses der beiden Bäche.
Eben an dieser Stelle, von der Brücke aus deutlich sichtbar,
befindet sich eine flache, weit ausgedehnte Erderhöhung von 4-5
m Höhe. Wir stehen hier auf ältestem geschichtlichen Boden. Um
die Mitte des 4. Jahrhunderts vor Christus mag es gewesen sein,
als die Kelten jene Gebiete wieder auffüllten, die durch den Zug
der suebischen Stämme über den Rhein nach Gallien zu, hier im
Schwarzwald frei geworden waren. Im Dreisamtal erbauten die
Kelten zur Überwachung der Höllentalschlucht und der Freistraße
in Richtung des heutigen Freiburg eine gewaltige Festung,
Tarodunum genannt, d.h. Ochsenburg.
 |
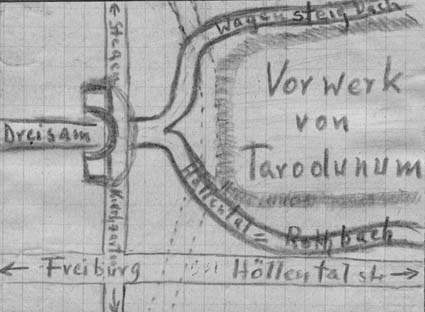 |
|
| Dreisambrücke oberhalb Stegen |
Skizze zu Tarodunum |
Vorwerk der "Ochsenburg" von der Stegener Dreisambrücke aus gesehen |
Besagte Erderhöhung, von der Brücke
aus gut sichtbar ist ein Vorwerk dieser Festung. Geistlicher Rat
Gustenhofer von Eschbach sagt in seiner Chronik, daß Schloß
Weyler in seinem ursprünglichen Teil wohl als Vorwerk der
Festung „Tarodunum“ angelegt worden sei. Das Kernstück dieser
militärischen Anlage wird wohl im heutigen „Burg“ zu suchen
sein, einer kleinen Ortschaft zwischen Stegen und Buchenbach.
Tarodunum, Zardunum, Zartuna, Zarten, in diesen Formen begegnen
wir dem Namen in den Urkunden. Schon der griechische Geograph
Ptolomäus erwähnt bereits im 2. Jahrhundert nach Christus in
seinem Weltatlas den Ort und die Festung Tarodunum.
Um das Jahr 50 nach Christus drangen die Römer in dieses Gebiete
ein. Damals wurde das Land Zehntland genannt. (Wegen Abgabe des
Zehnten) Die Römer haben die Festung Tarodunum als Rastort und
Reisestation benutzt, wie aus zahlreichen römischen Funden
hervorgeht, die 1928 von H. Wirth, Freiburg, gemacht
wurden.
Um das Jahr 260 nach Christus war die Römerherrschaft auf
badischem Boden beendet. Das Land war in langen, blutigen
Kämpfen von den Alemannen erobert worden. Aber nicht lange waren
die Alemannen Herren des Landes. Um 500 nach Chr. Drangen die
Franken, die damals mächtigste Völkerschaft, in das Land ein und
unterwarfen es. Die Franken teilten das Land in Gaue ein, und
diese Gegend erhielt den Namen „ Breisgau “.
Unter der Frankenherrschaft begann das Christentum in diesen
Gegenden allmählich festen Fuß zu fassen. Wohl gab es zur Zeit
der Römer schon vereinzelte Christen, aber eine regelrechte
Missionierung begann erst unter St.Gallus (* um 6445),
St.Fridolin und St.Trudbert.
Eines der ältesten christlichen Denkmäler des Dreisamtales ist
die Kapelle von Schloß Weyler in Stegen.
|
|
 |
 |
 |
| Schloßkapelle Weyler ca 1940 | |||
Ignatius Speckle, der letzte Abt
von St.Peter behauptet nach der Chronik des geistlichen Rats
Gustenhofer von Eschbach: „Die Kapelle von Weyler zu Stegen ist
aller Wahrscheinlichkeit nach das erste christliche Gebäude des
heutigen Kirchzartener Tales und Weyler der Pfarrsitz des ganzen
Tales gewesen.“ „Erst später ist die Kirchzartener Kirche erbaut
und die Pfarrei dorthin verlegt worden.“
Die genaue Jahreszahl über die Entstehung der Kirchzartener
Kirche kennen wir nicht. Kirchenpatron ist St.Gallus. Sicher
ist, daß Mönche von St.Gallen den Grundstein gelegt haben. Nach
einer Urkunde vom Jahre 765 übergibt der Breisgauer Edle
Trudbert alle seine Besitzungen in der Mark Zartuna dem Kloster
St.Gallen. Nach den Neujahrsblättern der Bad. Histor. Kommission
„Die Anfänge des Christentums und der Kirche in Baden“ von Jos.
Sauer, S. 102 wird um das Jahr 812 eine zum Kloster St.Gallen
gehörige Kirche zu Kirchzarten erwähnt, von welcher aus die
ganze Gegend pastoriert wurde. Nach den Tauf- Ehe- und
Totenbüchern der Pfarrei Kirchzarten vom Jahre 1609 ff. gehört
das ganze Tal einschließlich der jetzigen Pfarreien
Buchenbach, Ebnet, Eschbach, Hofsgrund (auf dem
Schauinsland), Kappel und Oberried – zur kath. Pfarrei
Kirchzarten. Bei Neugründung der Pfarrei Eschbach (etwa 1786)
wurde der Hauptort Stegen jener neugegründeten Pfarrei
zugeteilt, während die Nebenorte: Unterbirken, Oberbirken und
Rechtenbach bis auf den heutigen Tag bei der Pfarrei Kirchzarten
verblieben.
Von St.Gallen gingen die Besitzungen der Mark Zartuna auf
Kloster Einsiedeln über: denn Kaiser Ott I. bestätigt im Jahre
973 die Besitzungen des Klosters Einsiedeln, wobei Zarten ein
„Einsiedliches Gut“ genannt wird. Von Einsiedeln erwarb das
Kloster Maria Zell zu St.Märgen den oberen Teil des
Dreisamtales, verkaufte ihm aber bald wieder an die Ritter
Snevelin zu Landeck. Kloster St.Blasien bestätigt den Rittern
von Snevelin nach einer Urkunde aus dem 11. Jahrh. die oberen
Teile des Dreisamtales als ihr rechtmäßiges Eigentum.
Um das Jahr 800 waren noch die meisten Höfe freies Eigentum der
Bauern; das herrenlose Land gehörte dem König. Das änderte sich,
als gegen Ende des neunten und zu Anfang des zehnten
Jahrhunderts schwere Zeiten über das Land einbrachen. Auf der
einen Seite zwang die Not zahlreich kleine Bauern sich teils
freiwillig, teils gezwungen unter den Schutz mächtiger Herren zu
begeben, wodurch immer mehr freie Leute zur Leibeigenschaft
herabsanken. Auf der anderen Seite stiegen unternehmende Männer
zu großem Einfluß empor, wurden vom König mit mächtigen Gütern
und Herrenrechten belehnt, und sind so Herren über ganze
Gegenden geworden.
Auf diese Weise ist ein großer Teil dieses Landes an die Grafen
von Breisgau gekommen, die sich später Herzoge von Zähringen
nannten. Einige dieser Herzoge waren große Förderer der
damaligen Kultur. So erbaute Herzog Bertold II. um das Jahr 1091
die Burg Zähringen und 1093 das Kloster St.Peter. Er regierte
von 1078-1111 und liegt im Kloster St.Peter begraben. Herzog
Konrad gründete im Jahre 1120 die Stadt Freiburg und erbaute das
herrliche Münster. Er starb am 8. Januar 1152 und liegt in der
Familiengruft zu St.Peter begraben. Der letzte Herzog von
Zähringen war Berthold V. Er starb 1218 und liegt im Münster zu
Freiburg begraben.
Erbe des Breisgaus wurde zunächst Bertholds Schwager, dann sein
Schwesternsohn Egon von Urach, der sich zunächst Herr, dann Graf
von Freiburg nannte.
Die Ritter von Snevelin (Schnevelin oder Schnewlin) zu Landeck
hatten um das Jahr 1000 ihren Wohnsitz auf dem Landgut Weyler zu
Stegen. Ihr Besitzverhältnis der oberen Dreisamer Gemarkung
brachten sie im Stegener Siegel zum Ausdruck:
|
|
“Ein gespaltener Schild; die linke Hälfte: Goldgrün geteilt = Snevelin. Die rechte Hälfte: ein aufsteigender Hirsch = St.Blasien“ |
Dieses Siegel ist bis auf den heutigen Tag das Gemeindesiegel
von Stegen (1942 Datum der Chronik. Der
Hrsg.) geblieben und wurde vom Generallandesarchiv
Karlsruhe als das einzig richtige, geschichtliche Gemeindesiegel
geprüft und bestätigt.
Die Ritter von Snevelin besaßen um das Jahr 1200 auch Burg
Wiesneck, 3 km östlich von Stegen entfernt am Ausgang des
Höllentales direkt gegenüber. Von hier aus konnte man leicht das
Höllental überwachen und die Ritter von Snevelin sollen der sage
nach von der Burg Wiesneck aus Raubüberfälle auf die Wanderer
des Höllentales gemacht haben. Vielleicht steh damit im
Zusammenhang die noch heute existierende Überlieferung, daß Burg
Wieneck und Schloß Stegen durch einen unterirdischen Gang
miteinander verbunden waren. Spuren davon sind jedoch nicht mehr
nachzuweisen.
In späterer Zeit ging das Besitzrecht von Schloß Weyler auf die
Herrschaft von Freiburg über und die Ritter von Wiesneck
erhielten es als Lehen übertragen. In einem Dingrodel
(Aktenrolle = Amtsbeschluß) über die Rechte zu Weyler (sine
dato) steht zu lesen:
“Dies seind die Rechten, die zu Weyler in den Hof gehörend, da
spricht man darnach. Wennt ihr Herrn hören, warumb wir her
seind kummen, so spricht er Ja, so spricht man, da unser
Altvorderen unser Lehen empfingent von der Herrschaft von
Freyburg. Da ward aufgesetzt, dass wir herkämet drei Zeit in
dem Jahr und hie heltend Geding; da ist der ein Tag der erst
zu Mitten Hornung an den Zinstag und der ander zu mitten Meyen
am negsten Zinstag, und der Drittag nach St.Gallentag, am
negsten Zinstag. Die drei Tag sollen ein jeglich Mann wissende
sein. Wer Erben und Lehen empfangen het vom Hofe, als
lieb ihm drei Schilling seind, der soll auf dieselben Tag ohn
Gebieten da zedinge seind......und do das beschah, - darnach
ward der Hofe zu Weyler verliehen Herre Eurn Vorderen von der
Herrschaft von Freyburg, zu einem rechten Erben Euch und euren
Nachkommenden alle Jahr umb dreissig Schilling Pfennig....
Auch ist zu wissende, wäre es ein Erb als ein ander Erbe, so
erbte auch dies Mayertumb ein Kind als des ander, des ist es
nit, es ist Manneslehen je des ältesten Sunes, das recht Erb
ist es. Und wäre. Dass an demselben abging, so wäre es darnach
des ältesten Erbe und auch wär, dass ein Herre an seinen
Kindern abginge, von Knaben, hätte dann ein Bruder, der recht
Erbe wäre es, hätt er’s das nit, so ist es darnach des negsten
Erben vom Mannen und von dem Geschlecht, auch zum rechten Erbe
als vorgeschrieben steht und wär sin denne zum Erbe kumbt, der
solle Herre und Vogt hie sein und Richter über Fereveln, über
Herrsuna und über alle Ding, des ze Klage oder ze Busse
gehört, nach Klag und nach Antwurt.....
So spricht man und fragt sie denn auf Eid, sagent an ihr
Herren ist es alles also herkummen, so sprechend sie, Ja, es
Herre Euer forderen Hand al also an Euch gebracht und unser
Forderen an uns.
Auch soll man wissen, wer hulden soll, der soll Nieman hulden.
Wann dem Herre zu Weyler ist, so fragt man sie aber auf den
Eid.
Auch soll man wissen, dass ein
Herre fürbaß mererecht zu diesem Hof hat, das auch her ist
kommen von der Herrschaft zu Freyburg. Das ist, als zu
Freyburg an dem Fischmarkt, und soll das anfachen von dem
großen Stein herinn und von den Leiweren herinn und wäre, daß
dazwischen Jeman den anderen jagte und seinen Leib oder umb
sein Gut, der soll kaufen des Herren Huld, als lieb sie ihm
sei, so fraget man sie aber auf den
Eid.
Auch ist zu wissend, dass das eine Herre mehr Rechtes hat zu
diesem Hof, das ist sein Zugochsen, die er zu Weyler hat. Sie
geen aus weiden und sond an fachen zum Maygtag und sond gan
vor sungichten vierzehn Nächt in den Matten allenacht und sond
einNacht unter sich herabgan in den Matten unzt an Atenthaler
Gassen, und die ander Nacht auf in den Matten unzt an
Sturenthaler Gassen, und die dritt Nacht sont sie an disshalb
auf in den Matten gen Rechtenbach unzt an Brunnengassen und
sond Weidganges gan. Unden soll nit auf eine Fürbasser haben
denne auf den anderen und soll ein Knecht hinter ihnen gan und
der soll den Gört (Stecken) in den Handen haben und soll den
Daume auf dem Görteisen han, und soll den Daume unter dem
Künne han, ob er schlafen wöll, daß ihn das Görteisen weck,
und layt aber er sich nieder schlafen, oder fährt von
Vigenschaft auf eine Fürbasser denne auf den anderen, fündet
man in schlafen, schlecht man ihn zu Tode, so bessert nieman
mit. Dies seins des Hofes Recht, so fragt man sie aber auf den
Eid.
Auch ist zu wissend, daß ein Herre zu Weyler mehr Rechtens zu dem Hofe hat. Das ist wo zwei erste Menschen sitzend mit Ehe und mit Ehren, wann da Gott über sie gebeutet, daß er´s scheiden will; ist daß der Mann versturbt, ist daß er ein eigen Mann ist oder an ein Gotteshaus gehöret, so hat die Eigenschaft das fürbracht, daß sie verfallend vor dem Leibe. Wer denn des Herren Knecht ist, der soll zu einem Herren gehen zu Weyler gehen oder zu seinen Knechten und soll einen Fall fordern von dem Leibe und nicht von dem Gut, und soll eins Herrn zu Weyler Knecht dargegen, und soll austreiben, ist nit da zu treiben und ist nit da zu treibend, so soll man austragen, was von Wehre ist oder von Harnesch, das zu sein Lib horte, und soll ihm einen Fall geben nach der Geburten küst uns soll ihn darmit begnügen und soll aber den gebührenden Fall Schilling dalassen und wenn das geschickt, so soll ,am dem Herrn zu Weyler darnach einen Fall geben von dem Gut und nit von dem Leibe. Darnach den besten Fall als er da ist und mit all dem Rechte, als davor von dem Leibe geschrieben steht. Und ist, daß über die Frauen Gott gebietet vor dem Mann, ist sie dann eigen, so soll die Eigenschaft da sie hingehört, auch begnügen mit ihrem besten Hesse nach der gebüren küst und gilt der Mann anderst nüman nit von der Frauen, weders denne da blieb lebend, so soll denne Erb und Lehen empfachen von einem Herrn zu Weyler. Ist, daß er nit empfangen het, ist aber das der Mann des Nachgend, ist was rechtes denne die Eigenschaft vor ihm zu hete, damit soll sie auch dornach begnügen, ist aber das lehenbar wurd, so ist der Eigenschaft ihr Rechte behalten von des Fallers wegen.
Auch het der Herr zu Weyler ein
Rechtes zu dem Hof, wenn die Eh zergat, umb die zween ersten
Menschen und die beede abgant, so soll der Herr von dem
Jungesten eines Drittels warten und allen karrenden Gut, ohne
getröschen Straue und ohne verhauen Fleische und ohne verhauen
Tuche ongewerd und ohne Wägen und Karren, ohne das Niet und
Nagel het, und was auf dem Felde ist, von Stödt und von Mödt,
da het ein Herr kein Recht zu es wär denn, daß angegriffen wer
mit der Sichlen oder mit der Segissen ongeverde, so het der
Herr recht zu dem Dritteil, er soll aber das Dritteil auf dem
Felde helfen kosten, daß es einkomme. So fragt man sie aber
auf den Eid.“.................. .......
..........................“
So geht es endlos weiter mit den Rechten der Herren von Weyler.
In diesem Dingrodel ist das Besitzverhältnis, die Erbfolge, die
Gerichtsbarkeit, Zins und Abgaben und dgl. Geregelt. Und jeder
Abschnitt endet mit den Worten: „ So fragt man sie aber auf den
Eid.“ In diesen Dingrodels sicherten sich die freien Herren ihre
Hoheitsrechte und Privilegien, währen die Bauern immer mehr in
Abhängigkeit und Leibeigenschaft gerieten.
Zu bestimmten Zeiten, etwa dreimal
jährlich, wurden auf einem bestimmten Platze öffentlich Gericht
gehalten. Diese Gerichte nannte man Dinggericht, wozu alle
Untertanen
zu erscheinen hatten. Vor den eigentlichen Verhandlungen wurden
die Rechte und Privilegien des Lehnsherren verlesen,
verschiedene Rechtssachen geordnet und den Untertanen ihre
Pflichten wieder eingeschärft.
Alsdann begannen die Verhandlungen über vorgekommene Vergehen
und Verbrechen. Dabei wurden die hierfür bestimmten Strafen
verhängt. Sowohl die Herrschaft wie die Unetrtanen hatten das
Recht, Klagen und Beschwerden beim Dinggericht vorzutragen. Die
Rechte der Herren waren auf große Pergamentrollen „Dingrodels“
aufgeschrieben. Die Lasten der Bauern waren sehr drückend. Es
folgt jetzt ein Gebot und Verbot zu Weyler, das uns einen
kleinen Einblick gibt in die Verhältnisse der damaligen Zeit
(nach einem Dingrodel von 1520)
„Folgen gemeine Verbot, so man alle Jahr auf Mayen erst
Dinggericht zu Weyler, den Untertonen dahin gehörig, dasselbst
vor Gericht offentlich liest und verbrütt, laut also:
Zu wissen ein Jeglichem, es sey Frauen oder Mann, der ein
Erblehen zu Yba oder Stegen empfacht, der soll dem Junkern ein
Schilling Pfennig geben. Zu wissen daß auf Zinstag nach
Reminiscere geboten ist worden am Dinggericht des Hornungs zu
Weyler, daß keiner so im Gericht sitzet oder belehnet ist,
kein Blumen verkaufen soll, ohn Bewilligung des Junkern,
desgleichen ohne Aufbietung des Vogts, es sei Heu, Stroh,
Staub und Holz oder wie es genannt mag werden, bei Besserung
eines Pfund Pfennigs."
(Besserung = Strafe; ein Pfund Pfennig = 12 Gulden)
Niemand durfte kein Zinsvolk (Hausleute) sei es Weib oder Mann
aufnehmen ohne Wissen der Junker bei Strafe von 12 Gulden; das
Abschiessen von Tieren oder Vöglen war verboten bei Strafe von
der Pfund Pfenning. Item Vogel ausnehmen ist verboten bei einem
Pfund. Item Fischen in des Junkers Wassern ist verboten bei der
Nacht an drei Pfund, bei Tag an einem Pfund. Item Bauholz
abhauen in des Junkers Wälder an einem Pfund, Brennholz bei
jeglichem Stumpf an fünf Schilling Pfennig.
Uebernachten von übergelaufenen Kriegleuten ist verboten bei
Besserung eines Pfund Pfennigs.
Item den Untertanen des Gerichts Weyler ist aus vielerlei
Ursachen, so ihnen von den Junkern fürgehalten worden, beboten
worden, daß keiner, so Erb und Eigen hat von Weyler, sich in
Stand der hl. Ehe mit einer Person, so einen nachfolgenden Herrn
hat verändern solle, bei Besserung von zehn Pfund Pfennig.“
Das Weylersche Hochgericht (Malefizgericht) befand sich auf dem
sogen. Spitzenberg beim Nadelhof, später Galgenbühl genannt.
Die Zehtenpflicht, welche teilweise schon zur Römerzeit bestand,
hat sich nach und nach zu einer Art Kirchensteuer entwickelt.
Der Zehnt wurde geleistet zur Unterhaltung der Geistlichen und
der Kirche. So war der Zehnten Widemrecht d.i. Kirchengut.
Der Zehnt betrug für Stegen mit dem Nadelhof ohne die beiden
Birken und Rechtenbach: zu Anfang des vorigen Jahrhunderts: 68
Sester Roggen, 127 Sester Hafer, und 800 Pfund Stroh.
Um 1250 erbauten die Snevelin an Stelle des baufällig gewordenen
Gotteshauses eine kleine Kapelle im frühgotischen Stil; Diese
Kapelle ist bis zum heutigen Tag unversehrt erhalten geblieben.
Sie bildet das jetzige Chor, in dem sich der Hauptaltar
befindet. Damals ist um die Kapelle herum ein Friedhof angelegt
worden. Beim Aufgraben der Kapellenumgebung fand man wiederholt
menschliche Gebeine, zuletzt im Jahre 1942 bei
Kanalisationsarbeiten.
Die Ritter von Snevelin haben sich auch außerhalb von Stegen und
Wiesneck einen Namen gemacht. Daß sie sich um die Stadt Freiburg
Verdienste erworben haben darf man wohl mit Recht daraus
schließen, daß dort eine Straße nach ihrem Namen benannt ist,
die „Schnewlin Straße“ zwischen Schlachthof und
Eilgutabfertigung. Von einem Schnewlin wissen wir, daß er
Bürgermeister der Stadt Freiburg war, nämlich Johann Snevlin,
genannt Gresser. Dieser gründete im Jahr 1347 das
Kartäuserkloster auf dem St.Johannesberg bei Ebnet.
Sein missratener Sohn ermordetet zwischen Weyler und Ebnet den
Abt von St.Märgen, wurde daraufhin mit dem Bann belegt und
musste als Sühne an dem Ort der Tat eine Kapelle erbauen. Diese
Kapelle ist im Laufe der Jahrhunderte zerfallen. Klägliche
Mauerüberreste kann man jetzt noch dortselbst finden. An ihrer
Stelle steht heute ein steinernes Kreuz unter drei hohen Linden
an der Straßenvereinigung Stegen - Ebnet und Zarten - Ebnet.
Im Jahre 1486 starb mit Ullrich
Maier das Geschlecht der Snevelin von Landeck aus.
Das Landgut Weyler wurde jetzt von der Herrschaft zu Freiburg
dem Ritter Eucharius von Reyschach zu Lehen übertragen:
In einem Dingrodel von 1510 heißt es:
„Auf Zinstag nach
St.Gallentag im fünfzehnhundert und zehnten Jahr nach Brauch
und Herkommen – Dinggericht gehalten ist worden; seynd
Vogtgericht und ganz Gemeinde zu Yben und Stegen mit zeitigem,
wohlerwogenen Rate, besonders auch mit Wissen und Willen des
edlen, gestrengen Herrn von Reyschachs zu der Nyven Hofen
Riters Herrn........“
Nyven Hofen wird Weyler zu Stegen genannt, weil Ritter Eucharius
von Reyschach an Stelle des Mayerhofes, der durch eine
Unwetterkatastrophe völlig zerstört worden war, ein befestigtes
Schloß errichten ließ, das von seinem Sohne Hans von Reyschach
vollendet wurde.
Dieser neue Hof ist wahrscheinlich noch vor 1525 gebaut worden,
denn in diesem Jahre wurde Schloß Wiesneck in den Bauernkriegen
(Bundschuh) total verwüstet?
Auf dem Sebastiansbild aber, dem ältesten und erhaltenen Gemälde
vom Schloß Weyler ist die Burg Wiesneck noch unversehrt.
Wie weit die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern,
wie Luther sie nannte, welche neben anderen Forderungen den
freien Gebrauch des Waldes, des Wassers und des Evangeliums
verlangten, sich an Schloß Weyler vergriffen haben, ist uns
nicht überliefert worden.
Zugleich mit der Neuerrichtung des
Schlosses bauten die Reischachs auch eine würdige
Schlosskapelle. Wie auf der Kopie des Sebastianbildes sichtbar
ist, wurde an die ursprüngliche kleine Kapelle der Snevlin ein
Langhaus angebaut von 11 m Länge und 7 m Breite. Über der Mitte
des Langhauses erhob sich ein starker Turm. Die Haupttür war auf
der Frauenseite.
Vom 21.X.1517 ist uns ein Stiftungsbrief erhalten, den Hans von
Reyschach für die „Capellen im Schlosshof zu Weyler“ ausstellte.
(Generalarchiv Klrh)
„Im namen der Heyligen Drifaltigkeit. Amen. Kundt und wissen
syg allen denen, so diesen gegenwurtigen Brief sehen oder
hören lesen, daß ich, Hanns von Rischach betracht und
erwegen die kurzen und schnellen Zit...Darumb so hab ich zu
Lob und eer dem allmechtigen weigen Gott. Der hochgelobten
reynen Jungfrau Marien und allen in Gott geheyligten auch
meiner lieben Ehgemahl seligen.....zu trost und Hilf mit
gueter zittiger Vorbetrachtung, gesundt und vernünftig an
lyb und synnen zu den Ziten, do ich soliches zu tun wohl
mechtig bin, besonder auch mit wissen, willen und vergunsten
des Erwürdigen Edlen Herrn Johannes von Hatstein, sandt
Johanns Ordensmeister in deutschen Landen. Demm dann die
Pfarrkirch zu Kilchzarten als einem Comthur zu Fryburg und
Heytersheim im Prysgau insteet und incorporiert ist eine
ewige, jemerwerende Mess und Prister Pfrundt in der Eere der
Heiligen, der Hochgelobten reynen Jungfrau marie auch der
Heyligen St.Stephan, St.Jorgen, St.Nikolaus, St.Margaretha
und St.Ursula als derselben Pfrundt rechten Patronen zu
Weyler in menem Schloß und derselbig Capell im
Kilchzartertal ob Fryburg im Prysgau gelegen und in die
pfarrkirch gerechtigkeit der obgemelten pfarr Kilchzarten
gehörende, von meinem eigen Gut auch von dem Gozgaben und
handreichungen, so mir von frommen Leuten hierzu auch
gegeben und mitgeteilt sind für mich und all meine Erben und
Nachkommen in allweg
Form, wys und Gestalt, wie Ich das allerwertigst tun soll,
kann und mag, von meinen Dingen furgenommen zustiften; und
stift jetzt wissentlich hiermit, und habe dieselben pfrundt
bewidmet, begabt und färsehen...Also das nun fernerhin
ewiglich yedem Caplan dieser pfrundt die vorgeschrieben
yerlichen guld uf die Zeyt wytere hieran vergabt und geben
wurd....
Wer auch sach, daß über kurz oder lang die Capell zu unser
lieben Fraue uf dem Lindenberg in Wesen oder in ein fürgang
kein so sollicher Capellen schuldig und pflichtig sein,
dasselbe uf dem Lindenberg ein Mess zu haben, ye eine in
vierzehn tagen. Und in welicher Wochen er die Mess uf dem
Lindenberg hat, soll er sieselbig wochen nit wytter schuldig
seyn noch verbunden, dann zwon messen zu han in der Capellen
zu Wyler un sich sunst in allweg priesterlich und erbarlich
halten, kein andern Dienst noch ampt zu solcher pfrundt
annehmen, die ach nit verwechseln, verennern noch hingeben
anders, dann mit mein und meiner Nachkommen zu wissen willen
und zu unsern handen, wie sich das alles gezimpt und
gebührt; item der gemelt Caplan, so er als Behusung zu Wyler
überkompt, sol sich daweder Holz noch Wald, das Wyler
zugehört, gebuchen – es geschah denn mit gunst wissen und
willen, daß der Wyler erblich inn hat und mit usdrukten
Worten und angedingten Vorbehalt so soll sich ein jeder
Caplan dieser pfrundt der pfarrkirchlichen rechten und
Berechtichkeiten der pfarr zu Kilchzarten, es sich an Großen
oder Kleinen zuhennden mit Bychthören, mit administracion
der Heyligen Sacramennt ganz und gar nit annehmen noch
verziehen. Er mag aber mit eingepfarrers zu Kilchzarten
erlop und den alten Schwachen, desgleichen den kranken
Menschen und schwangeren Wybern das sacramennt in der
obgenannten Capell zu Wyler, so er Mess hat, mitteilen; Er
soll aber überweg und tross nit tragen, sich auch der olung,
begrebnis Sybendryssigst seel und ander opfer nit annehmen.
So ein Edelmann oder eines Edelmanns Weyb zu Wyler ihren Jez
haben, so sol und mag ein Caplan dieser pfrundt us Vermögen
dieser Stiftung zu den vier Hochzyten an den Sonntagen und
den hohen Feyrtagen mess zu Wyler in der Capell lesen...
Item ferrer, so behalt auch Ich obgemelter Hans von Ryschach
Stifter, mir un
demien Erben und Nachkommen mit ausdrukten worten bevor, daß
jetzt am anfang
und umhin für jenem ewiglich so oft diese pfrundt ledig
wurde, und sic der Fall
begibt, Ich mein lebenlang und nach meinem Absterben all
mein Erben und
Nachkommen die das Schloß und der Wyler innehaben und zu
lehen tragen, ein
weltlichen priester uf dies obgemelten pfrundt erkiesen, und
ihm die lyhen mogen;
darnach sollen wir den dem oben genannten Herrn Johannsen
von Hatstein und
seinen Nachkommen Compthur zu Freyburg und Heytersheim als
dem Patronen und
Pfarrer zu Kilchzarten, wie obstat, ernennen, und also dann
derselb Compthur und
sein Nachkommen verbunden und pflichtig sein den priester,
den ich oder meine
Nachkommen also ernennet haben, und keinen anderen einem
Bischoff oder seinem
Vicarien zu Constenntz zuzuzyten wesennde zu presentieren,
wie sich geburt und
recht ist...
derselb so von mir und meinen Nachkommen ernennt priester
sol diese pfrundt in
eigener Person besetzen, zu Weyler sein stette wohnung
haben, auch das pfrundt
hus darzu geordnet wurde, in eeren halten - allwochen zu
lesen, namlich montag,
mittwoch und Freytag, desgleichen allgebannenen Feyrtag;
damit darnach derselb
Edelmann oder eins Edelmanns Wyb, dazu ihr Diener und
Hausgesind an pfarrlichen
Kirchgang, wie sya gewollt christlicher Kirchen dieselben
Tag verpunden und
schuldig sind und nit verhindert werden. Ob aber kein
Edelmann oder Edelmanns
Wyb zu Wyler sizten, wurd, solang das geschicht, so soll an
Caplan dieser
pfrundt zu Wyler allsonntag desgleichen zu den vier
Hochzyten und anderen
gebnnen Frytagen schuldig und verpunden sein, zu Kilchzarten
in der Pfarrmess zu
haben und Ihm alsdann der Kilchherr zu Kilchzarten Messkelch
und ander Notdurft
darlyn, es ware denn uf dieselb Zeyt fest und Patrocinia in
obbestimmter Capell
zu Wyler, so soll der Capellan doselbst blieben und nit den
Kilchzarten gen,
mess zu lesen, und soll sunstgemelter Caplan von allen
anderen Satzungen,
stattuten und Berechtigkeiten der gemelter Pfarr Kilchzarten
in allweg
usgenommen wie obgelüstert stat, elempt und entladen sein,
und soll sich ein
jeden Priester, der von mir und meinen Nachkommen erkyrt
wurd, von stund an
alles das so obstat bekennen das zu halten in pester forn
geloben und
versprechen, mit Verzyhung alles absolution, Dispencion und
anderen Dingen,
Freyheiten und Vorzügen, so Ihm dawider fürstenlich und
behälflich sein
mochten und gnugsam hierüber brieff und sygl geben, so er
aber persönlich
Residenz mitteilt oder der oberzelten punkten und artikeln
einen oder me, so nit
inne die binden nit hielt, alsdann soll von stnd an die
gemelt pfrundtrecht
ledig sein, und Er derselbst nach ordentlichen Rechten , wie
sich gepürt,
entsett, und die von mir und meinen Nachkommen einem anderen
verliehen
werden. ........ Und daruff so bitt Ich,
Hans von Ryschach,
Stifter der Stiftung obgemelt der hochwürdigen Fürsten und
Herren, Herrn Eugen
Bischoff zu Constennz meinen gnedigen Herrn, oder seiner
fürstlichen Gnaden
Vicaren in geistlichen sach dies Stiftung ordnung und
fürnehmen, uf
ordentlichem gewalt und mit den Solemniteten und Zeyerheiten
wie sich gepurt zu
bestätigen, confirmieren und zu becredigen, das erpent Ich
mich guetwilliglich
zuner..dinen des zu Urkund und ewiger sicherheit, so hab ich
mein eigen Insigl
für mich und all mein Nachkommen zu Wyler wie obstatt auch
an diesen brieff
thun henken, der geben ist uf sanct Ursula der Heyligen
Jungfrauen tag, was der
einundzwentzigste tag des Monats Oktobris als man anch
Christi unseres lieben
Herrn gepurt zallet Fünfzehnhundertund sybzehn Johr"
=+=+=+=+=
Derselbe Hans von Reyschach erscheint auch in einem Freiburger
Aktenstück, das acht Tage vor dem obigen besiegelt wurde.
(Stadtarchiv Freiburg, Gemeindevermögen, Passive
Zinsverschreibungen vom 14.X.1517) Bürgermeister, Rat, Bürger
und Gemeinde von Freiburg verkaufen an „Herrn Hannsen von
Rischach zu der Nywen Hofen Ritter als ein anfanger und Stifter
der Pfrundt in der Capellen zu Wyler“ einen auf St.Gallentag
fälligen Zins von 20 Gulden von den städtische Gütern und
Einkünften an die an die Pfrunde zu Weyler um 400 fl.
Auf Hans folgt Joppen (Josef) von Reyschach.
In einem Vertragsbrief von 1530: Zu wissen und kund sei
allmenniglich mit diesem Brief, als sich dann etwas Irrung und
Spann zwischen dem edlen und festen Joppen von Reyschach.....Das
zur wahren Urkund ist dieser gültige Vertrag mit Bastian vonn
Blummegs und Benedikt Constanzen eigen anhangenden Insiegeln.
Beschehen und geben montags nach dem Sonntag Laetare in der
Fasten als man nach Christi unseres lieben Herrn gepurt zälet
tausend fünfhundert und dreissig Jahr.“
Joppen von Reyschach ließ sich damals von allen seinen
Besitzurkunden seiner Ahnen neue Abschriften machen. Von obigem
Vertrag ließ er am 19-IV.1535 durch den kaiserlichen Statthalter
Friedrich von Hatstatt eine Kopie anfertigen: Diweil wir nun den
obengemelten Rodel vor uns gehabt gesehen, gegen der
obgeschriebenen Abschrift vor uns lesen gehört, dazu an
Bergamenn (=Pergament) und der Geschrift, die etwas alt und gar
bei etlichen Orten verblichen gewesen, doch sonst gerecht und
ohn allen Argwohn gefunden; so haben wir des zu Urkund dem
genannten Joppen von Reyschach dies „Vidimus“ mit mein Friedrich
von Hatstatten des Statthalters obgenannts anhangenden Insiegl
von unser und der Regierung wegen versiegelt und geben zu
Ennsisheim den 19. Tag des Monats Aprilis nach Christi unseres
lieben Herren Geburt gezählt fünfzehn hundert dreißig und fünf
Jahr.“
Joppen von Reyschach ließ aus einem schlau erwogenen Grunde die
alten Akten über den Besitz seiner Vorfahren kopieren; Denn es
war noch kaum 50 Jahre her, daß das Geschlecht von Reyschach
Schloß Weyler erworben hatte, und schon gab es „Irrungen und
Spann“ wegen der Grenzen. Bis 1486 waren noch die
Snevelin hier in vollem Besitzrecht gewesen. Beinahe 500 Jahre
hatten die Ritter von Snevelin im Kirchzartener Tal geherrscht;
da konnten die alten Urkunden schon etwas unleserlich werden.
Joppen von Reyschach tat also gut daran alle seine Besitz-Akten
in deutlich leserlicher Handschrift abfassen zu lassen, um gegen
jede Streitigkeit gefeit zu sein. Jedoch, er war schon der
letzte seines Stammes.
Im Jahre 1579 kam das Gut an Justian Moser von Freiburg, Dr.
utriusque juris.
Dieses Geschlecht musste es erleben, daß Schloß Weyler während
des 30 jährigen Krieges bis auf die Grundmauern zerstört wurde.
Diesem Geschlecht der Moser haben wir auch den Wiederaufbau des
Schlosses zu verdanken in der Gestalt, wie es heute vor uns
steht.
Die Moserin, Frau Maria Clara Anna, begann bereits im Jahre 1648
mit dem Wiederaufbau „damit das noch stehende Gemäuer und der
schön gewölbte Keller nicht zugrunde gehen“ wie es in einem
Aktenstück von 19.II.1663 heißt. Wie denn überhaupt das
Kellergewölbe unstreitig der älteste Teil des Schlosses ist.
Wahrscheinlich stammt das Fundament noch aus der Keltenzeit.
Sicher aber stammt der heutige massive Grundbau mit seinen 3, ja
stellenweise 4 m dicken Mauern aus den Jahren 1490 – 1500, als
der von einem Unwetter zerstörte alte Meyerhof durch Eucharius
von Reyschach zu einem befestigten Schloß umgebaut wurde.
Nach dem Tod der Frau Moserin am 1.III. 1657 vollendeten ihre
drei Kinder Franz Christian, Johann Heinrich und Maria Esther
den Bau des Schlosses. Und in dieser Gestalt ist das Schloß
erhalten geblieben bis zum heutigen Tag.
Die Schlosskapelle scheint den Stürmen des dreißigjährigen
Krieges getrotzt zu haben. Unversehrt wurde sie vom Ausgang des
15. Jahrhunderts in unsere Tage hinübergerettet. Die Familie
Moser ließ es sich angelegen sein, in großzügiger Weise für die
Innenausstattung der Kapelle zu sorgen. Herrliche Barockaltäre
wetteiferten mit der Pracht kostbarster Paramente,
Kerzenleuchter, Statuen und Bilder. Von all diesen Dingen sind
leider nur noch klägliche Überreste vorhanden, wie z.B. ein
Stück des Lavabobeckens aus Bronce, die steinerne Halbfigur des
hl. Ignatius, vier handgetriebene Messingleuchte in echt Silber.
Auch dem Geschlecht der Moser war es nicht beschieden, die
Früchte ihrer Arbeit lange zu genießen. Im Jahre 1702 starb
Franz Christian als letztes Glied der Familie und wurde neben
seiner Mutter in der Schlosskapelle beigesetzt. Hier ruhten die
Gebeine der Neuerbauer des Schlosses bis zum Jahre 1893. Ihre
Gräber waren zugedeckt mit zwei schweren Steinplatten. Bei der
Exhumierung (1893) fand Pfarrer Gustenhofer von Eschbach unter
diesen Grabsteinen drei Skelette: „Auf der Epistelseite zu die
eines Kindes, gegen die Evangelienseite zu das Skelett einer
weiblichen Person, die noch den Zopf
mit rötlichen Haaren aufwies und in der Mitte das Skelett eines
Mannes. Auf der ersten Steinplatte die sich über dieser
Grabstätte befand, stand die Umschrift oben links beginnend:
|
AD : MDCLVII DEN I MARTII |
Pfarrer Gustenhofer hatte gewünscht, die ehrfurchtgebietenden
Gebeine an ihrer Ruhestätte zu belassen, allein, man begrub
dieselben außerhalb der Kapelle an der westlichen Seite (rechts
neben der Statue Fides, Spes et Caritas) wohin bald auch (1896)
der verunglückte Graf Franz von Kageneck beigesetzt wurde.
(Eschbacher Chronik)
Die Gräber wurden wieder mit den beiden Platten zugedeckt. Der
zweite Grabstein, stark abgetreten, lässt noch folgendes mit
Sicherheit erkennen:
|
ANNO 1702 DEN 27 .....CHRISTIAN |
Christian ist der schon erwähnte Sohn der Frau Anna Moserin. Mit
ihm starb das Geschlecht der Moser aus.
Als im Jahre 1926 die Gebeine des bei Zarten verunglückten
Grafen Franz von Kageneck an der Seite seiner Gemahlin
Wilhelmine von Linden in der Schlosskapelle unter dem
Sakramentaltar beigesetzt wurden, hob man bei den Vorarbeiten
auch die beiden Grabplatten der Familie Moser und stellte sie an
die gegenüberliegenden Kapellenwand. Dort sind sie stehen
geblieben bis zum heutigen Tag. Unter der Sonnenuhr aber ruhen
die sterblichen Überreste der Frau Anna Moserin und ihres Sohnes
Christian im Schatten der Schloßkapelle ihrer ewigen
Auferstehung entgegen. Mögen die Schlossbewohnen die Grabstätten
dieses edlen Menschen stets in Ehren halten.
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
||
 |
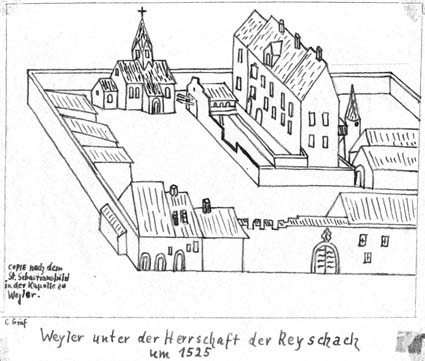 |
 |
||
Nach dem Tode des letzten Moser Franz Christian fiel Schloß
Weyler an das Haus Oesterreich. Kaiser Leopold I. hatte zwar im
Frieden von Ryßwick 1697 auf Straßburg verzichten müssen, aber
Kehl, Freiburg und Breisach musste Ludwig XIV. an den Kaiser
wieder abtreten.
Wie weit sich die aus dem Elsass stammenden Ritter von Kageneck
in diesen Kämpfen gegen Frankreich ausgezeichnet haben, wissen
wir nicht. Wir können aber annehmen, daß sie dort eine
ehrenvolle Rolle gespielt haben; denn gleich nach Aussterben der
Familie Moser belehnte das Haus Oesterreich den Freiherrn Johann
Friedrich von Kageneck, der seit 1660 auf Schloß Munzingen
lebte, mit Schloß Weyler
zu Stegen und all seinen Besitzungen im Kirchzartener Tal.
Mehr als 100 Jahre blieben das
Schloß und die Kapelle in dem Zustand, wie er von den Mosern
hinterlassen worden war. Erst Graf Philipp Josef von Kageneck
der Begründer der Stegener Linie, ging daran, in den Jahren
1841-43 Schloß und Kapelle gründlich zu renovieren. Auf das
Schloß baute er ein drittes Stockwerk. (= der jetzige große
Schlafsaal, auf dem seit Mitte Juli 1943 ein Waisenhaus aus
Hagen-Eilpe mit 81 Kindern, 6 Ordenschwestern (Vinzentinerinnen)
und 4 Hausgehilfinnen, untergebracht sind)
In dieser Zeit (1841-43) wurde die alte Scheune, welche auf dem
jetzigen Rasenplatz stand, rechterhand vom Haupteingang,
abgebrochen (siehe Kopie des St.Sebastianbildes von 1525) und
das neue Oekonomiegebäude, die große Scheune und das
zweistöckige Wohnhaus neuerrichtet. Dieses zweistöckige Haus ist
jetzt bewohnt von den Brüdern, Familie Köppke und der Familie
Coenenberg – Rettig aus Düsseldorf.
Nicht nur das Schloß, sondern auch die Kapelle wurde in den Jahren 1841-43 einer gründlichen Renovierung unterzogen. Der Dachreiter der Kapelle wurde in der Mitte des Firstes (siehe Kopie des St.Sebastianbildes) nach dem Westgiebel versetzt. Der seitliche Eingang, das sogenannte Frauentor, wurde auf die Westseite verlegt.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
||
Im Innern der Kapelle wurde die bisherige Empore abgebrochen und
hinter dem Hochaltar ein kleiner Anbau mit Turmtreppe angelegt,
die auf den Kapellenspeicher und zum Glockenturm führte.
Graf Josef Philipp verkaufte die alte Barockausstattung und lies
die Altäre im neugotischen Stil, der damals üblichen
Schreinerarbeit, anfertigen. Die echten, altgotischen Altäre
sind restlos verschwunden. Die Glasfenster, für 650 Gulden in
der Werkstätte Helme und Merrweiler in Freiburg hergestellt,
dienten als Blätter der Familienchronik der Grafen der Kageneck.
Rechts vorn befindet sich das Bild eines knienden Ritters, der
andächtig die Hände faltet zum Gebet. Darüber steht die
Inschrift:
RITTER STEPHAN VON KAGENECK BLIEB IN DER SCHLACHT ZUM SEMPACH
DEN 9. JULI 1386.
Im vorderen linken Fenster sieht man den gerüsteten Fähnrich mit
der Fahne der Stadt Straßburg; darüber die Inschrift:
ARBOGAST VON KAGENECK FUEHRT IN DER SCHLACHT ZU DORNACH DIE
FAHNE DER STADT STRASSBURG UND FAELLT, TAPFER VERTEIDIGEND, AM
22. JULI 1499.
Auf der Fahne, die Arbogast v. Kageneck in der Hand hält,
befindet sich die Madonna von Strassburg, die sitzende Mutter
Gottes mit ausgestreckten Armen, auf ihrem Schoß das Jesuskind.
Von diesem Bilde ließ Graf Max von Kageneck, der Vater unseres
noch jtzt lebenden Reichsgrafen Philipp eine getreue Nachbildung
in Stein anfertigen.
Die Statue, die Madonna von Straßburg, befindet sich jetzt an
der linken Kapellenwand, unmittelbar neben dem Bilde des
Fähnrichs Arbogast von Kageneck. Am Fuße der Statue ist das
Wappen der Gräflichen Familie von Kageneck – Aulendorf
angebracht. (Graf Max v.K. und Friederike, Gräfin von
Königseck-Aulendorf).
Auf dem Sockel stehen die Worte:
SENTIANT OMNES TUUM JUVAMEN, QUI TUAM SANCTAM CELEBRANT
COMMEMORATIONEM.
Mögen alle deinen Schutz erfahren, die dein hl. Andenken
feiern.
Links neben der Statue, auf dem unteren Fenster ist zu lesen:
Die Restauration und Neubauten dieses Weylers begannen 1841,
wurden vollendet 1843 unter dem Grafen Philipp von Kageneck und
der Leitung des Herrschaftlichen Schaffners Mathias Heizler von
Stegen.“
Auf dem gegenüberliegenden unteren Fenster auf der rechten Seite
steht geschrieben:
Reichsgraf Philipp von Kageneck, geboren zu Freiburg den 2.
August 1788, verehelicht am 29. September 1819 zu Osthausen im
Unterelsass mit Wilhelmine Freiin von Zorn-Bulach, geb. zu
Straßburg am 24. August 1792
Kinder aus dieser Ehe entsprossen:
| Franziska Ferdinande | geb. zu Bleichheim 13. Febr. 1821 |
| Anna Ernestine | geb. zu Bleichheim 11. Jun. 1822 |
| Maria Franziska | geb. zu Bleichheim 26. Nov. 1823 |
| Eleonore Karoline | geb. zu Bleichheim 1. Aug. 1825 |
| Benedikt Philipp Maximilian | geb. zu Freiburg 12. Jun. 1828 |
Dieser schon erwähnte Max von Kageneck verehelichte sich 1859 mit Friederike Gräfin von Königseck – Aulendorf (+1912) und starb im Jahre 1891 zu Freiburg. Kinder aus dieser Ehe waren:
| Franz Xaver | geb. 1860 zu Freiburg |
| Philipp Ernst | geb. 31. Okt. 1861 zu Freiburg |
| Maria Wilhelmine | geb. 1863 zu Freiburg |
| Gustav Max | geb. 1866 zu Freiburg |
Graf PHILIPP ERNST ist jetzt der noch lebende Besitzer von
Schloß Weyler zu Stegen.
Gräfin Maria Wilhelmine verehelichte sich am 23. Juli 1883 mit
Max Freiherr von Rotberg zu Bamlach.
Max von Rotberg starb im Jahre 1912, am 16. Dezember. Seit 1925
lebt Frau Baronin von Rotberg dem Schloß gegenüber im
sogenannten Tantenhaus.
Franz Xaver vermählte sich am 25. Juni 1885 mit Wilhelmine
Gräfin von Linden. Dieser Ehe entsprossen 3 Söhne und 2 Töchter:
Heinrich (lebt mit seiner Frau in Berlin. Haben keine Kinder)
Philipp (gefallen zu Anfang des Weltkrieges 1914)
In der Kapelle ist am Sakarmentsaltar in der Wand eine
Broncetafel eingelassen mit der Inschrift:
DEM EHRENDEN ANGEDENKEN DES REICHSGRAFEN PHILIPP VON KAGENECK,
GRUNDHERRN DES GROSSHERZOGTUMS BADEN, LEUTNANT IM REGIMENT
GROSSHERZOG VON SACHSEN NR 94 (5. THUERINGISCHES) GEBOREN ZU
SCHLOSS PFAFFENDORF UNTER-FRANKEN. DEN 1. FEBRUAR 1891 UND
SEINER VAETER WERT. GEFALLEN IN VERTEIDIGUNG SEINES GELIEBTEN
VATERLANDES ZU SECHSERBEN, KR. GERDAUEN, OSTPREUSSEN AM 19.
SEPTEMBER 1914. SEINE IRDISCHEN UEBERRESTE SIND AUF DEM
SCHLACHTFELDE BESTATTET.
R.i.P.
 |
Der dritte Sohn, Franz, heiratete in erster Ehe eine
Tochter Israels und wohnt jetzt mit seiner Familie in
Kastanienbaum bei Luzern in der Schweiz. Von den beiden Töchtern lebt Marie von Oettingen auf Gut Rabenstein bei Hohensalza im Warthegau, Marie Elisabeth von Unruh auf Gut Alt Stübritz Kreis Dramburg, (Pommern). Der Vater der letztgenannten, Graf Franz von Kageneck bezog im Jahre 1892 das Schloß Weyler zu Stegen und nahm den Oekonomiehof für kurze Zeit in eigenem Betrieb. Im kleinen Garten legte er die beiden Gewächshäuser an. Am 30. Mai 1895 verunglückte Graf Franz auf einem Spazierritt zwischen Zarten und Kirchzarten und hauchte nach wenigen Stunden seine edle Seele aus. Gräfin Wilhelmine ließ das neugekaufte, scheugewordene Pferd, das den Grafen abgeworfen hatte, erschießen und im Schlosshof einscharren.
Die gräfliche Familie blieb noch einige Zeit in Stegen
und verzog dann nach Weimar. |
Zu seiner Primiz im Jahre 1894 ließ Graf Philipp das Innere der
Kapelle neu einrichten. Der Anbau hinter dem Hochaltar wurde zu
einer kleinen Sakristei umgebaut. Im unteren Teil des Langhauses
wurde eine Empore die jetzige Orgelbühne errichtet. Bei einer
Versteigerung in München kaufte Graf Philipp drei altgotische
Flügelaltare auf, die zur Kapelle sehr gut passen. Restaurator
Hübner aus Freiburg hat im Jahre 1942 dies Altare in Arbeit
genommen. In einem Gutachten vom 30. Dez. 1941 hat Herr P.H.
Hübner, Konservator und Restaurator der städtischen Sammlungen
Freiburg i.Br. einen Plan entworfen zur Wiederherstellung der
Altäre. In diesem Gutachten über den Erhaltungszustand der drei
Altäre heißt es:
 |
 |
 |
||||||||||||||||||||||||
|
I. Der Sakramentsaltar. Darstellung: Schnitzaltar mit zwei Flügeln, auf diesen je ein holzgeschnitztes Relief. Im Schrein steht Maria mit dem Kinde vor Strahlenmadorla. Darüber zwei schwebende Engel mit einer Krone. Auf dem linken Flügel in Reliefschnitzerei die heilige Isberga, auf dem rechten Flügel in Reliefschnitzerei die hl. Afra. Auf der Rückseite der Flügel sind keine Darstellungen. Umrahmt und verziert mit holzgeschnitzten Ornamenten. Der Altar mit den Figuren ist eine Arbeit aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts und wohl bayerischen Ursprungs. Der Aufsatz ist eine Ergänzung aus dem 19. Jahrhundert, die im gotischen Stil ausgeführt wurde. An der Predella, rechts und links vom Tabernakel je ein kniender und bemalter Engel in Reliefschnitzerei. Die Engel sind Zutaten aus dem 19. Jahrhundert, ausgeführt in gotischem Stil. Die übrigen Teile der Predella sind original. Der Tabernakelschrein, sowie die geschnitzten Ornamente sind ebenfalls original. |
II. Der linke Seitenaltar Darstellung: Schnitzaltar mit zwei beiderseitig bemalten Flügeln und bemalter Predella. Im Schrein die holzgeschnitzten Figuren „St.Sebastian“ und St.Wolfgang“. Auf den Flügeln folgende bemalet Darstellungen:
Auf der Predella die gemalte Darstellung: „Zwei Engel
halten das Schweißtuch Christi“. |
III. Der Hochaltar Darstellung: Schnitzaltar mit zwei bemalten Flügeln. Im Schrein ein aus Holz geschnitztes Kruzifix. Eine Arbeit aus der Zeit um 1500. Auf dem linken Flügel, auf Holz gemalt, die Heiligen „Georg“ und „Urban“, auf dem rechten Flügel auf Holz gemalt die Heiligen „Christophorus“ und „Antonius“. Die Rückseiten haben keine Malereien. Umrahmt und verziert mit holzgeschnitzten Ornamenten. In der Predella in Reliefschnitzerei „Christus am Oelberg“. Eine recht gute Arbeit. Aus der Zeit um 1500. Der Aufsatz ist eine Ergänzung aus dem 19. Jahrhundert. Im gotischen Stil ausgeführt. Der ganze Altar ist vermutlich aus der Zeit um 1500 und wohl eine bayerische Arbeit. |
Soweit das Gutachten des Herrn Hübner, Konservator und
Restaurator der Städtischen Sammlungen, Freiburg.
Zu diesen Ausführungen sei noch Folgendes bemerkt: Im
Mittelstück des Hauptaltares befindet sich während des Jahres
der bereits erwähnte sehr ausdrucksvolle Crucifixus. In der
Weihnachtszeit wird ein holzgeschnitztes Krippenbildrelief an
Stelle des Crucifixus eingesetzt mit zwei Flügelbildern der hl.
3 Könige. Dieses Werk, im Auftrag des Grafen Max von Kageneck um
1870 von einem Freiburger Künstler hergestellt, ist eines der
wertvollsten Kostbarkeiten, die Schloß Weyler besitzt. Während
des Jahres, mit Ausnahme der Weihnachtszeit, befindet sich
dieses Krippenbild im Sprechzimmer des Schlosses.
Darstellung: Der Künstler hat die Szene der hl. Nacht
in das alte Chor der Stegener Schloßkapelle verlegt. Im
Treffpunkt der beiden gotischen Spitzbogen sehen wir genau wie
im Kapellenchor, das reichsgräfliche Wappen der Familie
Kageneck.
In edler Größe kniet Maria vor ihrem göttlichen Kind. Der
überaus reiche Faltenwurf ihres Gewandes zeugt von der zarten
Liebe, womit der Künstler an diesem Bilde geschaffen hat. St.
Josef steht bescheiden im Hintergrund. Seine ganze Haltung aber
lässt deutlich erkennen, daß er scu der großen Verantwortung
wohl bewusst ist, die nun auf ihm lastet.
Um die linke Hälfte des Werkes schlingt sich ein Efeugewächs, an
dessen Wurzel ein Mäuslein nagt.
Auf den Flügelbildern eilen die hl. Drei Könige zum Stall von
Bethlehem. Auf der Fahne, die ein Page trägt, sehen wir auf dem
linken Seitenflügel das Wappen der von Kageneck, rechts das
Wappen der von Königseck-Aulendorf.
In der Predella des Hochaltars befindet sich, wie bereits
erähnt, eine Reliefschnitzerei, darstellend „Christus am
Oelgarten“.
 |
 |
In der deutschen Kunst kommt die Oelgartenszene nicht vor 13.
Und 14. Jahrh. vor. Im Norden erlebt die plastische
Oelbergdarstellung aus Stein oder Holz, im 15. Und 16.
Jahrhundert ihre höchste Blüte. Durchweg hält sie sich dabei an
einen feststehenden Typ: “Die Gruppe der schlafenden Jünger, im
Mittelpunkt Christus, kniend und betend vor einem Felsen;
der Engel mit dem Kelch; Judas mit den Häschern und das Bild der
Stadt Jerusalem.
Die Heimat dieser Oelbergszenen in Holz oder Stein ist Schwaben
und Franken. Große Meister haben daran gearbeitet.
Das Bild in der Stegener Schloßkapelle ist außerordentlich gut
erhalten und spricht in seiner klaren vollen Stimmung nicht
wenig an.
Der Oelgarten ist deutlich charakterisiert, links der
abschließende Flecktwerkzaun, in der Mitte ein an und für sich
ungefüges, aber künstlerisch geschickt behandeltes Baumgebilde.
Rechts ragen im Dunkel der Nacht die Umrisse der Stadt Jerusalem
hervor.
Oben links nahen die Häscher unter Führung des Verräterapostels,
deutlich erkennbar durch den Geldbeutel.
Im Vordergrund sitzen die drei schlafenden Jünger. Ganz rechts:
Petrus, ordentlich müde, fest schlafend, ein Buch auf seinen
Knien haltend. Daneben Jakobus, auf dem rechten Ellenbogen
gestützt, etwas nach vorn neigend. Links vom Herrn die
jugendliche Gestalt des Lieblingsjüngers. Der etwas
aufgebauschte Faltenwurf ruht wie ein zartes, inniges
Schlummerlied um den Schlafenden.
In der Mitte der Szene kniet der Herr, allein, einsam vor sein
Schicksal gestellt, mannhaft dem Tode in Anlitz schauend. Sein
Blick ruht in weiter
Zukunft, und sieht all die Unbilden, die Undankbarkeit und
Gleichgültigkeit der Menschen gegen ihn, nicht achtend seines
liebesglühenden Herzens.
Und händeringend fleht er zum Vater: „Nimm diesen Kelch von mir.
Doch nicht wie ich will, Dein Wille geschehe.“
Eine echt stimmungsvolle Oelbergszene. Leider ist der Meister
dieses Kunstwerkes unbekannt.
Das vielleicht wertvollste Kunstwerk, das sich in der Stegener
Schloßkapelle befindet, ist das St.Sebastianbild. Konservator
und Restaurator Hübner aus Freiburg sagt darüber: „Gemälde
Sancti Sebastiani in der Schloßkapelle zu Weyler in Stegen:
Martyrium des hl. Sebastian. In Landschaft. Im Hintergrund die
Burg „Wiesneck“,
Schloß „Weyler“ und „Kirchzarten“. Harzölfarbenmalerei auf
Tannenholz. Hoch: 140 cm, breit: 49,5 cm, mit altem Rahmen.
Gemalt um 1550.“
Die Abbildung von Schloß Weyler ist jenes Schloß, das Eucharius
und Hans von Reyschach um 1500 an Stelle des durch Unwetter
zerstörten Mayerhofes neu erbauten. Burg Wiesneck ist auf dem
Bilde noch gut erhalten. Da Burg Wisneck geschichtlich
nachweisbar im Jahre 1525 in den Bauernkriegen zerstört worden
ist, so darf man wohl mit Recht annehmen, daß unser Gemälde vor
1525 fertiggestellt worden ist.
 |
 |
Das neue Sebastiansbild an der Decke der Kapelle wurde um das
Jahr 1893 hergestellt, als Graf Philipp zu seiner Primiz 1894
das Innere der Schloßkapelle renovieren ließ. St.Sebastian ist
dargestellt als römischer Offizier. Im Hintergrund erheben sich
die Schwarzwaldberge. In seiner Linken hält er die Pfeile, die
Werkzeuge und die Palme seines Martyriums. Mit der rechten Hand
hält der jugendliche Heilige seinen Mantel schützend über Schloß
Weyler, das in seiner heutigen Gestalt abgebildet ist.
Das alte Sebastiansbild stellt das Martytium des Heiligen das.
Ruhig und voll edler Würde steht der Held des Glaubens vor uns,
an einem Baumstumpf gebunden, in übermenschlicher Größe, von
Licht umstrahlt. Vor ihm auf dem Boden hocken die Schergen. Der
eine ist damit beschäftigt, den locker geworfenen Strick fester
zu binden, der andere legt gerade einen neuen Pfeil in den
Köcher. Ein dritter Henker im Hintergrund hat gerade einen Pfeil
abgeschossen. Die Kleidung der Henker ist die der
mittelalterlichen Landsknechte.
Schloß Weyler war damals, wie das Bild zeigt, von einer stark
befestigten Ringmauer umgeben. Die Mauern sind zum Teil stehen
geblieben bis zum heutigen Tag. Sämtliche Stallungen aber und
Oekonomiegebaulichkeiten von damals existieren heute nicht
mehr.
Burg Wiesneck ist unter dem Ellenbogen des rechten Armes auf der
Photographie etwas unklar, auf dem Original aber sehr deutlich
zu erkennen. Ebenso Kirchzarten mit dem hohen Kirchturm neben
dem linken Arm des
hl.Sebastian.
Kapellenfond
Die in der Pfarregistratur Eschbach liegenden Rechnungen vom
Jahre 1657 bis zum 1. Januar 1788 enthalten das Vermögen der
Kapelle „Zu unserer Lieben Frau auf dem Lindenberg“
zusammengeworfen mit dem Vermögen der St.Sebastianskapelle zu
Weyler. Das Vermögen entstand durch Anniversar-Stiftungen und
Opfergeldern. Am 1. Januar 1787 betrugen die Aktivrückstände an
Kapital: 2179 fl. 37 kr. d.i. 3736 RM 20 Pfg.
Das Reichsgraflich v. Kageneck´sche Amt nahm nun infolge der
Aufhebung der Wallfahrt auf dem Lindenberg und des Abbruchs der
dortigen Kapelle eine Ausscheidung vor und zwar so, daß für die
Kapelle zu Weyler als Jahrtagsstiftungen Rm 800.- an Kapitalien
ausgeschieden wurden und für den kath. Religionsfond in Freiburg
Rm 2936,20 (Die übrigen)
Das Gesamt-Anniversar-Stiftungskapital betrug im Jahre 1920:
5927,77 Rm.
Die Wertpapiere werden in der Stiftungsschatulle im Pfarrhaus zu
Eschbach aufbewahrt.
Der Zweck der Stiftung ist in erster Reihe die Persolvierung der
gestifteten Anniversarien, weshalb der Fond die verschiedenen
Jahrtagsgebühren und die zur Abhaltung des Gottesdienstes
nötigen Kirchenbedürfnisse zu bestreiten hat. Hierzu dient das
oben genannte Stiftungskapital. Könne die gestifteten
Anniversarien nicht in der Kapelle zu Stegen abgehalten werden,
wie z.B. 1860 oder 1893/94 wegen Reparaturarbeiten, so werden
dieselben in der Mutterkirche zu Eschbach persolviert gegen
Bezahlung der betreffenden Gebühren an den Priester, Messmer und
Ministranten der Pfarrkirche.
Eine Baupflicht des Fonds besteht nicht, weder für Neubau noch
für Unterhaltung der Kapelle, da das ganze Gebäude sammt Altäre,
Kirchenstühlen, Turmuhr und Glocken Eigentum der Grundherrschaft
zu Weyler ist.
Die Obliegenheiten eines Messmers und Glöckners außerhalb der
Zeit des eigentlichen Gottesdienstes wie z.B. Betzeit läuten,
Engel des
Herrn, Aufziehen der Turmuhr usw. entlohnt von jeher die
Grundherrschaft aus ihren eigenen Mitteln.
Der Fond wird von einem besonderen Stiftungsrat verwaltet, zu
dessen Mitgliedern zählen: Der Pfarrer von Eschbach, der
Bürgermeister von Stegen und einige Ratsmitglieder.
Schulhäuser in Stegen.
Der Schulunterricht wurde in früheren Jahrhunderten von
ortseingesessenen Handwerkern in deren eigenen Wohnungen
erteilt. Die Kinder wurden notdürftig im Lesen, Schreiben und
Rechnen unterrichtet. Die Entlohnung dieser Lehrer, ehemals
Schulmeister genannt, fand in Naturalien statt.
Im Jahre 1788 wurde die Gemeinde Stegen angehalten, eine eigene
Schule zu errichten. Dieser Schule wurden auch die Orte
Rechtenbach und Wittental zugeteilt. Das zum Schulgebäude
bestimmte Haus verbrannte aber im selben Jahre und nun wurde der
Schulunterricht nach Schloß Weyler verlegt, wo in einem Zimmer
des zweiten Stockes auf der nördlichen Seite bis zum Jahre 1814
Schule gehalten wurde.
Im Jahre 1814 kaufte Johann Janz, Spannmeister aus Birken einen
Teil des herschaftlichen Hauses nördlich der Straße mit dem
Wirtschaftsschild zur Krone und richtete in der unteren Stube um
einen jährlichen Mietzins von 12 Gulden eine Trivialschule für
Stegen ein.
Im Jahre 1876 wurde das jetzige Schulgebäude mit angebautem
Rathaus in Stegen errichtet.
Schloß Weyler in Stegen wurde noch einmal zu Schulzwecken
verwandt während der Jahre 1934-37, als hier von den
Herz-Jesu-Priestern eine Spätberufenenschule für Priesterberufe
in Betrieb genommen wurde. In den Jahren 1937/39 wurde sogar
Philosophie
und Theologie im hiesigen Scholastikat doziert. Den Namen
„Missionsschule“ hat Schloß Weyler bis heute beibehalten.
Als im Jahre 1943 infolge der Räumung von Städten im Rheinland
und Ruhrgebiet das große Waisenhaus „Schutzengelkinderheim“ von
Hagen-Eilpe nach Stegen verlegt wurde, erwies sich die hiesige
Dorfschule als entschieden zu klein, und im Schloß wurde
wiederum ein großer Saale für den Volksschulunterricht
freigemacht.
Tantenhaus
Nördlich des Schlosses zwischen der Landstraße und dem Eschbach
steht ein Herrschaftshaus, das sogenannte Spann- oder
Tantenhaus, daher rührend, weil früher ein Spannmeister und
später die Schwestern des Grafen Max von Kageneck, die Tanten
des jetzigen Grafen Philipp und der Frau Baronin in demselben
Haus wohnten. Das Haus war damals herrschaftliches Eigentum. Auf
demselben ruhte die Schildgerechtigkeit zur Krone als Realrecht.
Die Wirtschaftsgerechtigkeit wurde auf den 1843 neu errichteten
Oekonomiehof verlegt.
|
|
Mühle.
Zu den herrschaftlichen Gütern gehörte von altersher die einige
Schritte vom Oekonomiegebäude zum
Walde zu gelegene Mühle. Bei derselben befindet sich eine
Sägemühle, die im Jahre 1663 erbaut wurde. Die Mühle ist 1819
abgebrannt und wurde wieder neu aufgebaut, während die 1896
abgebrannte Säge nicht mehr hergestellt wurde. Die Mühle stand
von jeher im Eigentum der Schlossbesitzer und war stets
verpachtet. Im Jahre 1896 bezog Josef Fackler, Müller und Bäcker
von Bleibach, die Mühle. Die Herrschaft richtete in dem Wohnhaus
für diesen Pächter eine Bäckerei ein, welche aber keinen großen
Ertrag einbrachte und bald aufgegeben wurde. Fackler starb 1918
worauf die Pacht an Maurermeister Karl Walter abgetreten wurde.
Dieser verheiratete sich am 18. Februar 1919 mit Maria Burger
von Eschbach und starb schon am 29. März 1919 an den Folgen des
Weltkrieges, nachdem das Ehepaar nur drei Tage gesund auf der
Mühle gelebt hatte. Auf ihn folgte nun eine Tochter des vorigen
Pächters, Rosa Fackler, welche sich mit dem Müller August Kreutz
von St.Peter am 9. Juli 1919 verehelichte. Dieser betreibt nun
die Mühle mit einer kleinen Landwirtschaft.
Die Gastwirtschaft „Zur Krone“
Seit 1804 gehörte zu Schloß Weyler eine eigene Gastwirtschaft,
genannt „Zur Krone“. Sie befand sich an der Stelle des heutigen
Bruderbaues, seit 1843 in dem großen Zimmer, das jetzt von
Familie Coenenberg als Tagesraum benutzt wird. In den Jahren
1804
bis 1843 war die Gastwirtschaft „Zur Krone“ im heutigen
Tantenhaus.
Als die Oekonomie 1891 von Franz v. Kageneck in Eigenbetrieb
genommen wurde, war der Gärtner des Schlosses Innozenz Ginter
für zwei Jahre Wirt „Zur Krone“. Danach wurde der Ausschank
eingestellt. Später wurde die Wirtschaftsgerechtigkeit noch
einmal erneuert. Als dann die Erneuerung unterblieb, hörte das
Gasthaus „Zur Krone“ für immer auf, zu existieren. Die Krone war
der Konkurrenz des „Hirschen“ unterlegen bis auf den heutigen
Tag.
Wappenzeichen der einstigen Herren von Weyler.
| Das Wappen der Snevelin von Landeck: | Goldgrün
geteilter Schild. Helmzier: Zwei golne Hörner mit roten Schnüren. |
| Das Reyschach´sche Wappen: | Kopf und Hals
eines schwarzen Ebers mit goldener Mähne im silbernen
Feld. Helmzier: das gleiche Bild |
| Das Wappen der Familie Moser: | gespaltener
Schild, rot und gold, darin ein entwurzelter Baum, welcher
in goldenem Felde dürre Äste zeigt, im roten Felde aber
eine grüne Laubkrone mit mehreren Rosen aufweist. Helmzier: Zwei einwärts gebogene Arme mit goldenem, bzw. einem blühenden entwurzelzem Baum. |
| Das v. Kageneck´sche Wappen | zeigt in Rot
einen silbernen Schragbalken. Sinnspruch: In valore
virtus. Helmzier: seit 1467 „das Heidenmännlein“ vorher ein gekrönter Leu. „In valore virtus“ = „ In seinem inneren Wert liegt die Kraft des Menschen.“ |
|
Sonstige Wappen in der Kapelle: v. Linden: |
goldenes Kreuz auf rotem Hintergrund. |
| v. Königseck-Aulendorf: | rotsilbernes Karrée |
| v. Zorn-Bulach: | gespaltener Schild mit goldenem Stern auf dunkelrotem Grund. |
| v. Rotberg: | wagerechter Pfeil auf rotem Grund |
Die jüngste Vergangenheit von Schloß Weyler
Nach dem Todes des bei Zarten verunglückten Franz v. Kageneck
übernahm dessen Kutscher Heinrich Dresmann einen Teil des
Oekonomiehofes in Pacht
Im Jahre 1913 wurde das Schloß mit Parkanlagen und
Gebäulichkeiten an Graf August von Bismarck vom Lilienhof
vermietet. Alle Aecker und Grundstücke sind seit dem Zuzug
Bismarcks an die Einwohner von Stegen verpachtet worden.
Graf August von Bismarck, unter dessen persönlichen Leitung
Schloß Weyler in ordentlichem Zustand erhalten blieb, heiratete
1918 nach dem Todes seiner Mutter, die zu Lebzeiten die Heirat
nicht billigte, seine bisherige Gesellschaftsdame Frl. v.
Redlich, eine geborene Russin. Die kirchliche Trauung fand in
der Schloßkapelle statt.
V. Bismarck starb im Jahre 1920 in Stegen und wurde zu
Wasenweiler beerdigt. Seine Frau bewohnte alsdann das Schloß
noch ungefähr 3-4 Jahre, bis ihr der Aufenthalt nicht mehr
geheuer war. Eines Nachts nämlich wurde sie von einem Sohn ihres
früheren Kutschers (Kölpke) überfallen, verprügelt und beraubt
in dem jetzigen Oekonomatszimmer. Der Missetäter erhielt zwei
Jahre Zuchthaus aber Frau von Bismarck verließ Stegen für immer.
Am 1. April 1924 bezog der Holzhändler Ludwig Krämer das Schloß.
In Kirchzarten hatte er seine Holzhandlung. Bei ihm wohnte ein
Kunstmaler mit Namen Vittali (Otto Vittali
1872 - 1959, geb. in Offenburg sic) und ein Beamter namens Jakob
Janz als Untermieter.
Der Holzhändler Ludwig Krämer geriet in Geschäftsschwierigkeiten
und musste Bakrott machen. In seiner Verzweiflung hat er sich am
5. November 1925 erschossen in dem heutigen Wäscherei- und
Bügelzimmer. Von da ab geriet das Schloß immer mehr in einen
Zustand der Verwahrlosung und Unordnung bis Frau Krämer im Jahre
1928 das verwunschene Schloß verlies.
Seit 1928 weilen die Herz-Jesu-Priester in Stegen. Nachdem das
haus unter vieler Mühe wieder wohnlich eingerichtet worden war,
feierte P. Heinr. Middendorf, derzeitiger Rektor des
Missionshauses, am 8. Mai 1929 die erste hl. Messe in der
Schloßkapelle, wobei nur die Klosterinsassen und Frau Baronin
von Rotberg mit ihrer Gouvernante Frl.Anna Gabel zugegen waren.
Ursprünglich als Ferien- und Erholungsheim für das Kath.
Studienhaus in Freiburg gedacht, wurde Schloß Weyler über ein
halbes Jahrzehnt eine Spätberufenenschule, nach deren Auflösung
Noviziat und Scholastikat bis zum Jahre 1940.
Von da ab hat es mehr den Charakter eines Seelsorgehauses
angenommen.
Seit Herbst 1942 weilen die obdachlosen Familien Coenenberg –
Rettig aus Düsseldorf im Nordflügel des Brüderbaues. Dieselben
schlafen in einem großen Saal über den Stallungen.
Seit den schweren Luftterrorangriffen der Engländer auf die
Städte des Rheinlandes und Ruhrgebietes wurden im Sommer des
Jahres 1943 das „Schutzengelkinderheim“ von Hagen-Eilpe in
Westfalen nach Schloß Stegen verlegt. Das Waisenhaus hatte im
August 1943 eine Gesamtbelegschaft von 95 Personen. Davon 46
Kinder von 2-8 Jahren, 38 Kinder von 9-14 Jahren, 6
Ordensschwestern, Vinzentinerinnen, 4 Hausangestellte für Küche
und Kindergarten und eine Lehrerin, für den eigenen Schulbetrieb
im Schloß.
Außerdem waren in besagtem Monat August in Schloß Weyler
untergebracht:
5 Patres, 8 Brüder, 3 Schwestern von Neusatzeck, ferner die
Angehörigen der Familie Coenenberg – Rettig – Vogelsang -
Prévot, zusammen 18 Personen; dazu noch in den 4 ersten Tagen
des Monats August Familie Tietz aus Dortmund mit 7
Personen. Gibt alles in allem eine Gesamtbelegschaft von
136 Personen.
So wirft das Kriegsjahr 1943 seine Wellen tief hinein in den
stillen, friedlichen Schwarzwald.
Seit einigen Jahren befindet sich in Schloß Weyler im dazu
gehörigen Oekonomiegebäude eine vorbildliche Schweinezucht und
Mästerei. Unter Leitung von P. Rektor Schuster wurden im Jahre
1937 die Viehställe renoviert. Der Schweinestall wurde nach dem
neuesten Stand der landwirtschaftlichen Erfahrung in Bezug auf
Licht, Luft, Ausdünstung usw. hergerichtet. Die Abfälle aus der
Stadt und das übrige Futter wird in einem großen Dampfkessel von
allen Krankheitsstoffen befreit und zur Fütterung
zubereitet.
Soldaten in Schloß Weyler
In der Nacht vom 27. Auf 28. August 1939 traf Leutnant Hepperle
mit 30 Mann, zumeist Schwaben, zur Einquartierung ein. Am 1.
Februar 1940 verließen sie das Haus, um einer
brandenburgisch-ostpreussischen Einheit Platz zu machen. Vor dem
Rheinübergang 1940 lagen 350 Soldaten im Schloß und der Park war
ein vorzügliches Versteck für eine Unmenge von Benzinfässern.
N.B. Diese Abhandlung erhebt nicht den Anspruch auf
wissenschaftlich exakte Forschung, sondern will nur einen
kleinen Beitrag liefern zu dem Thema: Liebe zur Heimat, und
Ehrfurcht vor dem Überlieferten.
Als Quellen wurden benutzt:
1 Geschichte der Gemeinde Stegen. Dem Volke erzählt von
Maximilian Walter
2 Die Eschbacher Chronik von Pfr. Gustenhofer
3 Mündl. Besprechungen mit dem hochw. Herrn Grafen Philipp v.
Kageneck und seiner Schwester der Frau Baronin von Rotberg.
4 Besprechungen mit dem Grafen Heinr. V. Kageneck zu Munzingen
5 Die Geschichte der gräflichen Familie v. Kageneck von Heinr.
Julius, Graf v. Kageneck.
+++++++++++++++
Text und Photos, zusammengestellt und herausgegeben
Stegen, 28. August 1943
P. Notermans S.C.J