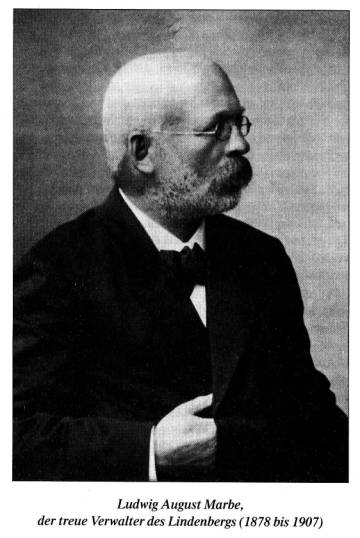zum
Inhaltsverzeichnis
zur Lindenberg-Liste
Das Unrecht am Lindenberg
bei St.Peter im Schwarzwald |
|
Erzählt
von Dr. Josef Schofer
1928 Freiburg i.Br. Verlag des Erzbischöflichen Missionsinstituts |
|
Dieses
Schriftchen widme ich dem Andenken der vertriebenen Tertiarinnen, dem
treuen Hüter des Heiligtums Ludwig Marbe und dem treukatholischen Volk
des Breisgaus in Berg und Tal.
Freiburg
i.Br., den 11. Februar 1928
Dr.
Josef Schofer
|
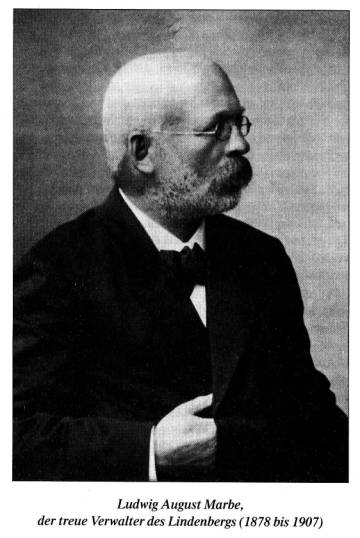
|
Einleitung.
Kirchen
und Kapellen, Kreuze und Bildstöckchen können dem gläubigen Volk viel erzählen;
man muß ihre Sprache nur verstehen und gern zuhorchen, wenn sie von ihren
Erlebnissen zu plaudern anfangen. Unser Konradsblatt hat ja den schönen Vorzug,
daß es in Wort und Bild in die religiöse Heimatkunde einführt und die Denkmäler
unseres badischen Landes zum Volke sprechen läßt. Die Leute haben das recht
gern.
So
will ich mir jetzt vornehmen, vom Lindenberg bei St.Peter etwas zu erzählen.
Dazu habe ich zwei gewichtige Gründe. Einmal steht jetzt neben der
Wallfahrtskirche ein prächtiges Exerzitienhaus. Es werden neben den
Wallfahrtsleuten nun auch eifrige Katholiken beiderlei Geschlechts
hinaufpilgern, um die hl. Uebungen dort zu machen. Sie wollen und sollen etwas
erfahren, was da oben schon alles passiert ist. Sodann sind es bald 60 Jahre,
seit ein arges Unrecht auf dem Lindenberg begangen wurde. Da das heutige
Geschlecht nichts mehr davon weiß, es aber zu wissen ihm besonders nützlich
sein dürfte, darum soll das Unrecht vom Lindenberg besonders erzählt werden.
Schon vorher ist ein anderes großes Unrecht an der Wallfahrt passiert. Auch das
soll zuvor mitgeteilt werden.
1.
Von der Wallfahrt da droben überhaupt.
Unser
Priesterseminar hat seit den vierziger Jahren seine Zuflucht in St.Peter
gefunden. Von dort aus machen die künftigen Priester gewöhnlich alsbald nach
ihrer Ankunft eine Wallfahrt auf den Lindenberg. So sind auch wir im Herbst 1891
hinausgepilgert zur Muttergottes auf dem Lindenberg und haben dort vor ihrem
Gnadenthron gebetet. Dann traten wir in die herrliche, farbenprächtige
Herbstlandschaft hinaus und sahen hinab ins Tal und hinüber auf die Berge vom
Kandel bis zum Schauinsland und Feldberg. Der Blick von hier aus gehört zu den
schönsten in unserem Schwarzwald. Die Berge mit ihrer stillen Majestät stimmen
von selbst zum Gebet, ziehen das Herz himmelwärts. Dafür haben unsere tiefgläubigen
Altvorderen ein feines Verständnis gezeigt. Darum kann man es verstehen, wenn
sie auf solch einem Punkt eine Stätte des Gebetes errichteten, mit ihren
Anliegen dahin zu pilgerten und immer wieder heraufkamen.
Warum
sollte die Gnade des Himmels diesem gesunden Zug nicht entgegenkommen, die heißen
Gebete der Wallfahren erhören, die Pilger segnen? Wann die erste Kapelle hier
oben gegründet wurde, welches die erste Erhörung war, darüber schweigt die
Geschichte. Abt Jakob Steyrer von St.Peter hat „keine Müh gesparet,
der Sach auf den Grund zu kommen“. Allein die Stürme der Zeiten oder, wie der
Abt es nennt, „Kriegstroublen“ ließen fast „alle Urkundschriften zu Grund
gehen“. Darum liegt ein Schleier über den ersten Zeiten der Wallfahrt. Wohl
werden allerlei wundersame Erscheinungen der Mutter der Gnaden berichtet, von
allerlei Erhörungen erzählt; allein die geschichtliche Wahrheit aus den
Legenden herauszustellen, wird kaum möglich sein. Ist es überhaupt notwendig?
Der Münsterturm, von der milden Herbstsonne durchleuchtet, schaut mir eben ins
Zimmer auf den Tisch und meint: der geniale Baumeister, der mich geschaffen, hat
seinen Namen auch verschwiegen und keine Urkunde meldet uns sein Wer und Woher.
Das Werk allein soll gelten, soll Gott die Ehre geben und den Menschen durch die
Jahrhunderte das sursum corda (erhebet
die Herzen sic.) zurufen. Daß es ein
großer Meister war, daß ein opferfrohes Volk ihm die Mittel bot, daß künstlerisches
Schaffen und gläubiges Opfer, kurz, daß echt christlicher Sinn mich schuf, das
predige ich mit lauter Stimme allen Jahrhunderten, die vorbeirauschen. So ist es
auch mit der Wallfahrt auf dem Lindenberg. Sie ist das Werk des gläubigen
Volkes aus verflossenen Jahrhunderten und der Gnaden der göttlichen Vorsehung.
Das zu wissen, genügt und muß genügen.
Das
Heiligtum auf dem Lindenberg nahm an den Leiden und Heimsuchungen der Zeit teil.
Von Abt Gremmelspacher wird erzählt, daß unter ihm der Grund zum
Kirchlein auf dem Lindenberg gelegt wurde. Vom Jahre 1503 schreibt Pater
Gregorius Baumeister:“ Um diese Zeit nahm die Kirche auf dem Lindenberg,
nicht weit von unserem Kloster gelegen, nicht ohne bedeutende Wunder ihren
Anfang und entwickelte sich im Laufe der Zeit, da unsere Väter dort das heilige
Opfer darbrachten, zu einer berühmten Wallfahrt.“
Die
Zeiten der Bauernkrieg gingen nicht spurlos an dem Heiligtum vorbei. Die
Bewegung entsprang ja nicht bloß wirtschaftlichen Verhältnissen. Der religiöse
Abfall erklärt es, daß alle Pilger, die daher kamen, über verschmäht und
verspottet worden sind, wie die „Urkundschrift“ berichtet. Man nannte den
Wallfahrtsgottesdienst, „ein Abgötterei und Götzendienst“. Man fiel „in
das Bildhäuslein oder Kapelle ein; die Bildnis Maria und das Kruzifix wurden
abgerissen, in den Kot gedrückt und getreten“.
Von
den mannigfachen Schicksalen im weiteren Verlauf der Jahrhunderte will ich
nichts mehr erzählen. Wer sich dafür weiter interessiert, der verschaffe sich
das Wallfahrtsgebetbuch des ehemaligen apostolischen Missionars Wilhelm Störk.
Es ist bei Herder in Freiburg 1892 herausgekommen. Mir kommt es hier nur darauf
an, die Wallfahrtskirche auf dem Lindenberg vorzustellen, um dann so von dem
doppelten Unrecht, das an ihr verübt wurde, etwas ausführlicher erzählen zu können.
2.
Ein aufgeklärter Kaiser.
Gegen
Ende des 18. Jahrhunderts lebte und regierte in Wien ein aufgeklärter Kaiser.
Er hieß Josef II. Diesem unterstanden damals auch die Lande im Breisgau.
Wenn
ich nun von diesem aufgeklärtem Kaiser allerlei Unrecht erzählen soll, so muß
ich dem die eine oder andere Vorbemerkung vorausschicken. Fürs erste muß ich
sagen, daß er eben auch ein Kind seiner Zeit war; diese war aber arg „aufgeklärt“
und sah im Wallfahren, Rosenkranzbeten, im Exerzitienhalten und in vielen
anderen religiösen Gebräuchen Verirrungen und Auswüchse. Von dem Geist war
der Kaiser Josef II. nun auch angesteckt. Fürs zweite muß ich sagen, daß
der genannte Fürst auch gute Eigenschaften hatte und es auch bei diesen
verkehrten Maßregeln immer noch gut meinte. Als er z.B. am 20. Juli 1777 in
Freiburg weilte, wohnte er im Münster dem hl. Meßopfer bei und kniete während
der hl. Wandlung auf die bloße Erde nieder und ließ den Prunkstuhl daneben
stehen. Wir anerkennen das heute. Allein der gute Wille macht die verkehrten Maßnahmen
noch lange nicht zu klugen und berechtigten Regierungshandlungen.
Der
damalige Preußenkönig hat den Kaiser Josef II., weil dieser bis in die
Sakristei hinein regierte, spottend „den Bruder Sakristan“ genannt. Wor
allem hatte es der Kaiser auf die beschaulichen Klöster abgesehen. Im Beten und
Büßen allein sah der Kaiser keine Lebensaufgabe; dafür war er eben zu aufgeklärt.
Darum hob er in seinen vorderösterreichischen Landen allein 22 solcher Klöster
auf. Die Güter wurden zumeist in einen Religionsfond getan und hier wohltätigen
und religiösen Zwecken zugewandt. Mehr wie eine Pfarrei wurde auf diesem Weg
errichtet. Bei diesem Vorgehen fragte der Kaiser nach den Kirchengesetzen, nach
dem Papst und nach den Bischöfen so gut wie gar nichts. Die Mahnungen Pius
VI. nützen bei ihm nichts. Als der hl. Vater selbst nach Wien reiste,
richtete er so gut wie nichts aus.
Die
alten Bruderschaften lies der Kaiser aufheben und dafür die allgemeine
Bruderschaft „tätiger Nächstenliebe“ einführen. Kirchliche Feiertage
fielen dem Reformeifer des Kaisers ebenfalls zum Opfer. Sogar die Zahl der
Kerzen beim Gottesdienst wurden vorgeschrieben. Die Ehe wurde der staatlichen
Gesetzgebung unterworfen, wie wenn sie eine rein weltliche Sache wäre. Die
Ehescheidung wurde erleichtert; und das aus eigener Machtvollkommenheit des
Kaisers.
Besonders
auf die Wallfahrtsorte und das Wallfahren hat es der aufgeklärte Monarch
abgesehen. Er erblickte darin Aberglauben, Zeitverschwendung und Müßiggang. Er
ließ darum ein Verzeichnis aller Wallfahrtsorte, auch der vorderösterreichischen
Lande, anfertigen. Viele von ihnen wurden auf Befehl des Kaisers einfach
aufgehoben. Das Vermögen kam ebenfalls in den Religionsfond. Diese Verordnungen
trafen nun auch die Wallfahrt auf dem Lindenberg und brachten das erste große
Unrecht. Davon will ich aber erst später Näheres erzählen.
Kaiser
Josef II. ist am 20. Februar 1790 gestorben. Er
hat seine Grabschrift selbst verfaßt. Sie lautet; „Hier liegt ein Fürst,
dessen Absichten rein waren, der aber das Unglück hatte, alle seine Entwürfe
gescheitert zu sehen.“ Als man in seiner Todeskrankheit öffentliche Gebete für
ihn abhielt, bemerkte der sterbende Kaiser dazu: „Man hat öffentliche Gebet für
die Wiederherstellung meiner Gesundheit angeordnet. Ich weiß es; aber ich weiß
auch, daß mich der größte Teil meiner Untertanen nicht liebt. Wozu können
somit Gebete nützen, welche das Herz nicht fühlt, welche es sogar Lügen
straft?“
Die
letzten Worte und die Grabschrift sagen es laut und deutlich: In Josef II.
starb ein unglücklicher Kaiser. Was hat im hauptsächlich dieses Los bereitet?
Er hat sich an der Kirche, am religiösen des katholischen Volkes vergriffen.
Diese Wege hat er eingeschlagen, weil er auf die „Apostel der Aufklärung“ hörte
und nach ihrem Evangelium handelte. Die Wurzeln liegen aber noch tiefer. Seine
Erziehung war verfehlt. Das natürliche Naturell, sein früh entwickeltes
Herrsein, seine Spottsucht und Anmaßungen wurden, statt niedergehalten,
geradezu großgezogen. Zweifelsucht und Mangel an Ehrfurcht vor dem Heiligen ergänzten
die unglücklichen Eigenschaften und machten es leicht, den Sinn für die
Staatsallmacht und den uneingeschränkten Herrscherwillen rasch zu entwickeln.
Eine unglückliche Ehe vollendete das Mißgeschick Josefs II. Kaiserein
Maria Theresia, seine Mutter, war eine ausgezeichnete Frau. Ihr Einfluß auf
ihren Soh war indes gering. Die Erziehung ging fehl. So entwickelte sich der
„Bruder Sakristan“ auf dem Thron.
Es
ist nicht notwendig, aus dem Erzählen besondere Nutzanwendungen herauszugreifen
und festzustellen. Sie stehen schon zwischen den Zeilen drin. Man braucht nur
ein bißchen darnach zu sehen und man kann sie dort lesen. Sie betreffen die
Erziehung der Kinder, sie betreffen das Volksleben und die Religion im Volk.
Fehler, die hier passieren, rächen sich; darum heißt es da besonders
aufpassen! Diese Lehren gelten auch heute und gelten für jeden.
3.
Des Kaisers rauhe Hand.
Auf
dem Verzeichnis des Kaisers über die Wallfahrtsorte in Vorderösterreich stand
auch der Lindenberg. Unter dem 30. September 1786 befahl Wien, daß das Ibental
mit dem Lindenberg der neu errichteten Pfarrei Buchenbach zugewiesen werden
solle; bisher gehörten beide pfarrlich nach Kirchzarten. Das Kloster von
St.Peter bekam den Auftrag, es solle in Eschbach eine Pfarrkirche bauen und eine
Pfarrei daselbst gründen. Zum Bau einer Kirche gehören Baumaterialien. In Wien
hatte man dies sofort parat. Die erst vor 25 Jahren neu erbaute Wallfahrtskirche
auf dem Lindenberg sollte abgebrochen werden; das so gewonnene Baumaterial
sollten die Eschbacher Bauern fronweise vom Berg ins Tal hinabführen. Für Abt
Steyrer, der die Wallfahrtskirche gebaut hatte, war der Begehr aus Wien eine
böse Aufgabe. Allein, was konnte er gegen die gewaltigen Bürokraten in Wien
machen! Sie hatten ja die Gnade gehabt, seinem Kloster „ewigen Bestand“
zuzusichern. Dieses Versprechen war schon etwas wert, denn die beschaulichen Klöster
verfielen ja der Aufhebung. Den nächsten Schritt konnte man sich denken. Die
Wallfahrtskirche wurde tatsächlich niedergerissen; die Baumaterialien kamen
unter vielen Anstrengungen zu Tal; in Eschbach aber entstand die etwas vergrößerte
Wallfahrtskirche als Pfarrkirche. Das Gnadenbild fand darin seine Aufstellung.
Auf Befehl von Wien war die Pfarrkirche auf einmal eine Wallfahrtskirche. Nach
den Wiener Bürokraten war damit alles in schönster Ordnung.
Es
fragt sich nur, ob auch das gläubige Volk auf Kommando von Staatsbürokraten
marschiert. Einstweilen meinte der aufgeklärte Rektor des Generalseminars in
Freiburg: „Sobald das Wallfahrtsbild in die neue Pfarrkirche übertragen
worden, dürfte sie auch von fremden Wallfahrern stark besucht werden.“ Der
letzte Abt von St.Peter, Ignaz Speckle, berichtet das Gegenteil. Er
schreibt: „Seitdem die Kirche auf dem Lindenberg abgebrochen und das
Marienbild nach Eschbach übersetzt worden ist, erhält sich noch immer das
Zutrauen des Volkes an den Ort. In Menge fahren sie dahin und verrichten ihr
Gebet an den Ruinen der Kirche und behaupten, der Ort wäre ein Gnadenort; das
Bild wäre nie ein mirakulöses Bild gewesen. Es läßt sich das Volk seine
Meinung nicht nehmen.“ So schrieb Abt Ignaz Speckle am 9. November (richtig
ist der 6.November sic) 1796 in sein Tagebuch. Es ist herzergreifend, wie das
katholische Volk trotz der Hofdekrete von Wien an dem Wallfahrtsort hing und
treu blieb. Ohne es vollauf zu wissen, bildete das Volk in seiner Glaubenstreue
den stärksten Damm gegen die Fluten der Aufklärung und ihrer Zerstörungsarbeit.
Ich
habe immer zu denen gehört, die das religiöse Volksempfinden zu den starken Mächten
zählen. Ginge hier etwas verloren, würde der Schaden leicht ungeheuer groß
sein. Darum gilt es, diese gesunden Sitten in den Familien, in den verschiedenen
Gegenden heilig zu halten, sie zu hegen und zu pflegen. Die Oberflächlichkeit
unserer Zeitrichtung, der große Hang zu Sport und Spiel, zu allerlei Tand
bilden ohnehin eine Gefahr für unser Volk.
Der
Kaiser Josef II. war sehr übel beraten, als er gegen die Wallfahrt auf dem
Lindenberg mit so rauher Hand losging. Er zerstörte damit vor allem viel
Vertrauen im Volk. Zu spät hat er es eingesehen und beklagt. Allein die Gemüter
waren durch die Eingriffe in das religiöse Leben dem Kaiser tatsächlich
entfremdet. Das Volk haßte den Polizeistock im religiösen Leben, das es von
den Eltern als kostbares Erbe übernommen hatte. So sehr das Vertrauen gegen den
Kaiser im Volke verwüstet war, die pflichtmäßige Treue wahrte es trotzdem.
Diese Haltung ehrte die Bevölkerung des Breisgaus.
Die
Salpeterer-Bewegung im Hauensteinischen am Oberrhein war in ihrer ersten Periode
eine mehr politische. Als aber die Aufklärung an den Rosenkranz, an die
Wallfahrten und andere religiösen Gebräuche des katholischen Volkes ging, da
erhob sich der Widerstand im Volk, ein Widerstand, der durch den Uebergang vom
Hause Oesterreich an Baden noch einen politischen Einschlag bekam. Das Volk
berief sich auf seine alten Freiheiten; darnach sollten sie für „ewige
Zeiten“ zu Oesterreich gehören. Dem Großherzog von Baden verweigerten sie
deshalb Huldigung, Steuern und Militärdienst. Ihre Parole lautete: „Treue dem
römisch-katholischen Glauben und dem Kaiser von Oesterreich!“ Politisch
konnte der Widerstand gebrochen werden; religiös feierten sie die abgeschafften
Feiertage, beteten den verspotteten Rosenkranz, machten ihre Wallfahrten und mißtrauten
den liberalen, aufgeklärten Pfarrern. Als 1831 der beim Volke so hochverehrte
Katechismus des hl. Kanisus aus den Schulen verbannt wurde, da gaben die
Waldleute dieses Büchlein ihren Kindern doch in die Schule mit und sagten: aus
dem und aus keinem andern Buch sollten die Kinder die katholische Religion
lernen. Der regelrechte Schulstreik war ihre Zuflucht. Strafe und Kerkerhaft nützten
nichts. Sie gingen zur Erfüllung ihrer religiösen Pflichten in die Schweiz und
dort bevorzugten sie Klöster und Wallfahrtsorte. Die Bewegung hat noch manches
Jahr angedauert, bis es gelang, wieder Ruhe und Ordnung zu schaffen; die Rückkehr
zum katholischen Verständnis der althergebrachten katholischen Religionsübungen
im Volk, die bewährte Treue zum Hl. Vater in Rom, von Erzbischof und
Geistlichkeit schlugen die Brücken zum Herzen dieses urkatholischen Volkes und
brachten nach und nach das alte Vertrauen wieder.
Diese
geschichtlichen Erinnerungen verkünden es deutlich und ernst: Man unterschätze
das religiöse Volksempfinden nicht! Diese Wahrheit geht die geistliche und die
weltliche Obrigkeit an, geht vor allem aber die Männer des öffentlichen
Lebens, die Presse und die Parlamente an! Das große Gesetz hat auch heute noch
seine Geltung.
4.
Die kalte Ruine auf dem Lindenberg.
Die
Aufklärung war damals nun auch ins Heiligtum der Kirche eingedrungen. Ihre
Apostel saßen in der Kirchenbehörde so gut wie in manchen Pfarrhäusern. Das
bekam nicht bloß das brave Volk der Hotzen zu verspüren. Der Lindenberg und
seine Wallfahrer haben auch manche Probe davon erlebt.
Das
Jahr 1796 brachte zu den Kriegsleiden noch Seuchen in den spärlichen
Viehbestand. Das gläubige Volk wandte sich in seinen Bedrängnissen an die
Hilfe von oben. Man nahm so die Wallfahrten auf den Lindenberg wieder auf,
wiewohl dort nur noch Mauerreste der abgebrochenen Kapelle standen. Die
Gemeinden, wie Ibental und andere aus
der Nachbarschaft, wollten feierliche Prozessionen dahin halten. Man bestürmte
den Abt. von St.Peter. Allein er kannte die Hofdekrete und noch mehr die Aufklärung
in der Kirchenregierung; darum hielt er arg zurück.
Es
war nun an Martini 1796. Die arg heimgesuchten Leute hatten die Betstunde in der
Kirche zu St.Peter besucht; dann aber
bildeten sie selbst eine Prozession auf den Lindenberg. das Tagebuch des Abtes
berichtet: „So viele Leute waren gewiß noch nie bei einem öffentlichen
Kreuzgange; das Volk wünscht wieder eine Kapelle auf dem Lindenberg zu haben,
und sehr viele erbieten sich, dazu beizutragen!“
Die
braven Katholiken von Unteribental ließen
die Sache nicht beruhen. Am 9. August 1800 teilten ein Vogt und noch ein Bauer
dem in Freiburg weilenden Abt mit, die Gemeinde habe ein Gelübde gemacht, die
Kapelle wieder zu erbauen. Sie baten um Rat und Unterstützung. Der Abt war aus
den bekannten Gründen zurückhaltend und verwies sie ans Amt und die österreichische
Regierung und dann an die geistliche Kurie. Die Verhandlung mit dieser übernahm
der Abt selbst.
So
sprachen die Männer bei der Gräfin Maria Franziska von Kageneck und dem
Amtmann Dr. Ruf vor. Sie fanden ein geneigtes Ohr. Als Abt und Amtmann am
29. August den Lindenberg besichtigten, da fanden sie, „daß schon angefangen
war, den Platz zu räumen, schon Kalk und Bretter beigeschafft und Sand gerädert
worden war.“ Man einigte sich, die Kapelle solle unter „herrschaftlicher
Direktion“ ausgeführt werden.
Nun
mußte die Kirchenregierung noch verständigt und ihre Erlaubnis eingeholt
werden. Man tat die entsprechenden Schritte. Zwei Jahre warteten die Leute zu.
Da machten die Gemeinden Ibental und Rechtenbach
eine herzergreifende Eingabe, um die Kapelle auf dem Lindenberg aufbauen zu dürfen.
Die Bittschrift mußte durch die Hand des bischöflichen Kommissärs in Freiburg
gehen. Es war der Stadtpfarrer von St.Martin, Dr. Johann Baptist Ignaz Häberlin.
Dieser Apostel der Aufklärung machte am 3. Juli 1802 einen Beibericht an die
Kurie in Konstanz. Darin war er ganz
und gar gegen die Wiedererrichtung einer Wallfahrtskirche auf dem Lindenberg. Er
sprach sich vielmehr dafür aus, man solle die Ruine der alten Kapelle noch wegräumen;
den „die Leute gingen aus Irrwahn, der an Aberglauben grenze, lieber auf den
Berg und knieten vor die Steine hin!“
|
So
kam es, daß Generalvikar Freiherr von Wessenberg schon am 17. Juli
die Bitten der Gemeinden ablehnte. Am 4. August 1802 übergab der genannte
Stadtpfarrer und bischöfl. Kommissär dem Kageneckschen Amte den
geistlichen Entscheid mit dem Anfügen, die Gemeinden zur Darnachhaltung
zu verständigen! Nun verwendete sich die Gräfin persönlich um die
Erlaubnis bei dem Generalvikar. Allein die Antwort bleib bei der
Ablehnung. Jetzt griff die Dame zu einem Auskunftsmittel. Sie erklärte,
es sei ihr Wille, mit der neuen Wallfahrtskirche eine neue Lokalkaplanei
zu verbinden. Das Kloster von St.Peter solle sie von dort aus versehen. Wessenberg
ging scheinbar bei und verwies auf die Verhandlung mit dem Abt zu St.Peter.
Die Bauern bekamen so günstigen Bescheid und fingen am 18. Juli 1803 den
Bau an und zwar den Chor. Der Eifer war allerseits groß. Am 13. Oktober
konnte der Dachfirst aufgerichtet werden. Nun mußte man aber doch an die
regelrechte Erlaubnis von Konstanz und an die Errichtung der Lokalkaplanei
denken. Jetzt kam das dicke Ende. Das Generalvikariat verlangte von der
Regierung, daß der Bau eingestellt und alles wieder in den Stand zurückgesetzt
werde, wie es das Jahr 1786 erfordert habe! Wenn die Herrschaft eine
eigene Pfarrei dotieren wolle, werde dazu die Einwilligung gegeben; man
sei aber fest entschlossen, eine bloße Wallfahrt auf dem Lindenberg nicht
zu dulden! Die Regierung verkündete dies Hiobspost und forderte dazu auf,
die Leute sollten nach Eschbach wallfahren gehen. Allein das Volk wollte
davon nichts wissen. Im Frühjahr 1805 stellten die Bauern einen Altar in
der halbausgebauten Kapelle auf eigene Kosten auf. Am 24. Mai aber zogen
sie in Prozession ohne Priester, Kreuz und Fahne, aber betend, nach dem
Lindenberg.
|

|
Als
der Generalvikar von Wessenberg das Vorgehen erfuhr, „legte er auf die
neue Kapelle sowohl als auf den neuerrichteten Altar ein kanonisches Interdikt
und verbot allen und jeden Priestern des Säkular- und Regularklerus unter
Strafe der Suspension, in der Kapelle Lindenberg ein Messe zu lesen oder andere
gottesdienstliche Handlungen, Predigt, öffentliches Gebet u. dergl.,
vorzunehmen.“ Dr. Häberlin bekam als bischöflicher Kommissär die
Ausführung und die Ueberwachung der harten Anordnung übertragen. Das genügte.
Abt Speckle sah von einer Gegenvorstellung ab; denn solch ein Schritt
konnte, wie sein Tagebuch meldet, „ den unbesonnenen und eigensinnigen Generalvikar
von Wessenberg nur noch hitziger machen“.
Das
so dem Lindenberg bereitete Los war hart und dem katholischen Volk unverständlich.
Durch viele hundert Jahre hatten Tausende von gläubigen Katholiken ihre Sorgen
zur Wallfahrt hinaufgetragen und von dort Mut, Kraft und Ergebung geholt; Trost
und Hilfe hatten sie dort gefunden in den mannigfachen Nöten des Leibes und der
Seele. Nun lag das Interdikt auf der heiligen Stätte. Die treuen Katholiken
verstanden das Los nicht. Sie sagten sich nur, es müsse da etwas nicht in
Ordnung sein, und es war tatsächlich etwas nicht in Ordnung. Die glaubensarme
Aufklärung war mit Herrn von Wessenberg in die Konstanzer
Kirchenregierung eingezogen. Sie hatte in Dr. Häberlin ihren eifrigsten
Sachwalter im Breisgau erhalten. Sinn und Verständnis für das schlichte und
echte Glaubensleben des katholischen Volkes ging ihr ab. So kam es zu dem
Unrecht auf dem Lindenberg!
Nun
könnte man an den aufgeklärten Herrn von Konstanz und Freiburg Kritik üben.
An Stoff dazu fehlte es nicht. Allein der Geist des Christentums rät uns etwas
anderes an. Beten wir, daß Gottes Vorsehung uns stets würdige, vom Geist des
Glaubens geleitete Priester erwecke und sende, und fernhalte jedes Verderbnis
aus dem Heiligtum. Die Wallfahrtskirche auf dem Lindenberg grüßt heute ins Tal
hinab und lädt zum Beten ein. Drinnen aber glüht das ewige Licht und der
Heiland spricht: „Kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid; ich
will euch erquicken!“ Wie glücklich wären die Katholiken der Wessenbergzeit
gewesen, wenn sie die Möglichkeit von uns gehabt hätten! Der beste Dank für
unsere Freiheit ist der fromme Gebrauch der Wallfahrt.
Das
Unrecht von damals ist vorbei: Es ist auch gesühnt. Gottes Barmherzigkeit möge
denen verzeihen, die es verschuldet haben! Wenn wir aber droben stehen und nach
stiller Andacht im Heiligtum ins Land hinausschauen, dann wollen wir nicht
vergessen des treukatholischen Volkes, das durch kein Unrecht von seinem
Wallfahrtsort abwendig gemacht werden konnte. Sein Beispiel gilt unseren Tagen
mit den vielen und großen Gefahren für das Glaubensleben im Volk!
5.
Neues Leben blüht aus den Ruinen.
Zeiten
gehen; Zeiten kommen. Das alte Bistum Konstanz wurde 1821 vom Papst regelrecht
aufgehoben und das Erzbistum Freiburg gegründet. Anfangs der vierziger Jahre
zog das Priesterseminar in die Klosterräume zu St.Peter ein. Die Kapelle auf
dem Lindenberg wurde ausgebaut und die Pilger kamen wieder zur Wallfahrt.
Es
war nun im Jahre 1854. Fromme Jungfrauen siedelten sich in der Nähe der Kapelle
an. Sie bildeten einen religiösen Verein nach der dritten Ordensregel des hl.
Franziskus. Veronika Benitz war die Gründerin dieser frommen
Vereinigung. Sie war 1853 mit ihrer Mutter aus Breitnau nach St.Peter
gekommen. Jedermann weiß, daß die Mitglieder des III. Ordens zumeist in der
Welt leben. Auch wenn sie in Gemeinschaft wohnen, fehlt noch viel zu einem
Ordenskloster. Darum hatte man es bei den frommen Jungfrauen auf dem Lindenberg
auch gar nicht mit einem Nonnenkloster zu tun. Das ist wichtig; denn wir werden
es bald hören, daß die Kirchenfeinde in dem frommen Verein ein Kloster sahen
und dagegen losgingen und so dem Lindenberg ein neues, arges Unrecht antaten.
Schon
damals hat sich die Regierung darum interessiert, ob auf dem Lindenberg etwa ein
Frauenkloster entstehen wolle. Oberamtmann von Chrismar war 1854 gekommen
und ein Jahr darauf Regierungsrat Föhrenbach. Ebenso erschien Regierungsrat
Oberkircher in St.Peter und auf dem Lindenberg, um Untersuchungen und Verhöre
vorzunehmen. All die Erhebungen blieben „erfolglos“. Niemand untersagte
damals den Jungfrauen das Zusammenwohnen, doch wohl aus dem einfachen Grund,
weil man in dem ganz unbescholtenen und privatrechtlichen Zusammenleben der
Jungfrauen nicht Polizei- und Gesetzwidriges oder gar Staatsgefährliches
entdecken konnte. So berichtete das „Freiburger Katholische Kirchenblatt“
von 1869 Seite 33.
Veronika
Benitz und ihre Freundin Katharina Wangler kauften nun das ehemalige Wirtshaus
an der Kapelle. Die Jungfrauen wollten so mit dem Heiland unter einem Dach
wohnen und ihm in Treue dienen. Veronika Benitz besaß von ihren Mutter in
Breitnau einen eigenen Bauernhof. Den tauschte sie 1858 gegen den nahen, auf er
Gemarkung Eschbach gelegenen Renzenhof ein. Das Gut wurde im Laufe der nächsten
Jahre noch vervollständigt. Damit hatten die Jungfrauen ihr Arbeits- und Ernährungsgebiet.
Im
Jahre 1856 baute man einen eigenen Betsaal für die frommen Frauen und eine
Wohnung für einen Seelsorger. Nachdem sie soweit waren, führten sie die
„ewige Anbetung“ ein, und zwar öffentlich in der Wallfahrtskirche. Mit dem
8. Oktober 1858 beteten je zwei der frommen Jungfrauen laut Stunde für Stunde
vor dem Allerheiligsten. Da das Kommen und Gehen der Pilger störte, schuf man
einen gesonderten Raum für die hl. Uebungen der Anbetung.
Die
Pilger fanden, da zumeist ein Wallfahrtspriester auf dem Lindenberg wohnte, täglich
Gelegenheit zum Gottesdienst und zum Empfang der heiligen Sakramente. So kamen
sie aus Freiburg wie aus den Ortschaften ringsum mit ihren Anliegen, um bei der
Muttergottes auf dem Lindenberg Hilfe, Trost und Kraft zu holen. Die Wallfahrt
sah ihre Blütezeit.
Die
Wallfahrer spendeten ihre Opfergaben; man sammelte sie zum Ausschmücken der
Wallfahrtskirche. Jahrtagsstiftungen stärkten den neugegründeten Kapellenfond.
Die Seminarherren von St.Peter setzten die wohlwollende Fürsorge der
Benediktineräbte fort. Regens Dr. Kössing und Subregens Knittel
förderten das fromme Leben auf dem Lindenberg unter den Jungfrauen wie bei den
Pilgern.
Die
Familie der Tertiarinnen war im Laufe der Jahre über die Zahl 40 gestiegen. Die
Jungfrauen entsammten „alle dem Bauernstand“ und „führten ein rauhes,
lediglich der Arbeit und der Andacht gewidmetes Leben zur Erbauung der
benachbarten Gemeinden, deren Achtung sie sich erfreuten. Das Hofgut, dessen
Felder sie bestellten und dessen Haus sie bewohnten, war Privateigentum. Ihre
Existenz war notorisch und in den Regierungsakten schon längst konstatiert;
doch blieben sie bislang unbehelligt. Das Recht selbstständiger Personen,
freiwillig in Gemeinschaft zu leben, ohne Störung der öffentlichen Ordnung,
selbst ohne die Gefährdung der Interessen anderer, schien unanfechtbar“. So
schrieb Dr. W. von Wänker am 6. Januar 1869 an die badische Regierung.
Der
Gemeinderat von Unteribental aber
stellte den Jungfrauen vom Lindenberg folgendes Zeugnis aus:
„Dieselben
bebauen ihr Grundeigentum selbst miteinander, und zwar mit solchem Fleiß und
Umsicht, mit Vorteil in jeder Hinsicht, saß ein jeder Mann ihnen das Zeugnis
als tüchtige Oekonomisten und Beförderer der Landwirtschaft in vollstem maß
geben muß. Hinsichtlich ihres Betragen gegen die Umgebung und als Gemeindeangehörige
gegen ihre Mitbürger sind sämtliche Bewohner des Lindenbergs friedsam,
zuvorkommen, uneigennützig, dienstfertig und bescheiden, pünktlich und
Gehorsam in ihren Pflichten gegen die Gemeindeordnung und gegen Erteilung
obrigkeitlicher Befehle. Gegenseitig dieses Betragens haben dieselben die
allgemeine Gunst in der Umgebung sich erworben, und hauptsächlich die Gemeinde Unteribental
hat durch ihre Gegenwart eine Begünstigung erworben, welche darin liegt, daß
in Unteribental in der Nahe der Einwohnerschaft selbst täglich ein
Gottesdienst abgehalten wird und somit der Einwohnerschaft Gelegenheit gegeben
ist, in christlicher Beziehung ihre Andacht zu verrichten....“
Der
Gemeinderat von St.Peter und Eschbach
stellte den Jungfrauen vom Lindenberg ein ähnliches Zeugnis aus. Dem Volk
gefiel besonders der Gottesdienst in der Wallfahrtskirche. Der Gemeinderat von
Eschbach schrieb darum:
„In
der Kapelle beten sie laut, und zwar zu zweien Tag und Nacht. Zuerst taten sie
das hinter dem Hochaltar und jetzt in der Kapelle auf einer vergitterten Emporbühne.
Von Zeit zu Zeit singen sie auch, so z.B. bei der hl. Messe.“ Das religiöse
Leben veredelte Arbeit und Umgang. Darum schreibt der Gemeinderat von Eschbach
weiter: „Wegen ihres fleißigen und fröhlichen Arbeitens und beim Verkehren
wegen ihres freundlichen Betragens, sowie wegen ihres ganz untadelhaften Lebens
sind sie in der ganzen Umgebung beliebt.“
So
lauten die Zeugnisse, welche die umliegenden Gemeinden den frommen Jungfrauen
vom Lindenberg ausstellten, und zwar auf Grund jahrelanger eigener Erfahrung.
Man hätte glauben sollen, der Staat müßte froh sein, solch ein Beispiel
inmitten des Volkes zu haben; jedenfalls konnte er keinen annehmbaren Grund
finden, dieses Beispiel christlichen Tugendlebens zu zerstören. Allein es kam
doch anders.
6.
Das Gewitter zieht herauf.
In
Karlsruhe war von Großherzog
Friedrich I. ein neues Ministerium berufen worden. An der Spitz stand Dr.
Jolly. Damit waren allein liberale Führer unzufrieden. Warum sie so
gestimmt waren, braucht hier nicht erzählt werden. Die Unzufriedenen kamen bald
in Offenburg zusammen und bereiteten
einen Feldzug gegen Minister Jolly vor. Die Hauptführer dabei waren die
nationalliberalen Abg. Lamey, Bluntschli und Kiefer. Unter den
Anklagen, die sie gegen den Staatsminister vorbrachten, ging nun eine dahin, er
sei gegen die katholische Kirche zu entgegenkommend; er sei „Mühlerischer
Neigung“ verdächtig. Mühler war ein preußischer Minister der die
dortigen Katholiken anständig behandelte, daher stammt also der Ausdruck, den
man gebrauchte.
Minister
Jolly war mit der Offenburger Revolution bald
fertig. Er versetzte den Ministerialrat Kiefer aus dem Ministerium
hinaus; dieser aber antwortete mit dem Austritt aus dem Staatsdienst. Die
anderen gaben bald klein bei. Der Oberbürgermeister Fauler von Freiburg,
der in Offenburg auch mitgemacht
hatte, sprach von einer „Blamage“ und bedauerte, „mit gefangen zu sein“.
Im Karlsruher Theater aber verhöhnte der Schauspieler
Devrient in der Rolle eines Hausierers die „Offenburger“, indem
er unter dem lauten Beifall der Theaterbesucher „Offenburger Blech“ feil
bot. Jolly war also Sieger geblieben.
Nun
lag ihm aber doch sehr am Herzen, zu beweisen, daß bei ihm „mühlerische
Neigungen“ nicht zu finden seien. Dazu bot sich eine willkommene Gelegenheit,
als vom „zuständigen Bezirksamt Anzeige erstattet wurde“, auf dem
Lindenberg habe sich ein Frauenkloster festgesetzt, ja daß „46
Ordensschwestern nach der dritten Regel des hl. Franziskus zusammenlebten und
also ein Kloster in vollem Sinn des Wortes bildeten.“ Hier wollte also der
Minister ein Exempel statuieren und zeigen, daß er gegen die katholische Kirche
um kein Haar besser gesinnt sei wie ein Kiefer und ein Bluntschli. Derlei
Beweise erbrachte Jolly von da ab noch manche, so daß er den Ruhm des schärfsten
Kulturkampfministers im Lande Baden
vor dem Richterstuhl der Geschichte wie im Volksbewußtsein besitzt. Unter ihm
kam ja 1874 auch das Gesetz, nach dem die jungen Geistlichen ins Gefängnis
wanderten, das andere Gesetz, nach dem es Ordenspriestern unter Strafe untersagt
war, auch nur die Sterbesakramente in Notfällen zu spenden, das weitere Gesetz,
dem das Schwarze Kloster in Freiburg
zum Opfer fiel. Das erste Brandopfer aber der anhebenden Kulturkämpferei waren
doch die Schwestern auf dem Lindenberg.
Vielleicht
fragt jemand: Ja, wo blieben denn da unsere Abgeordneten? Die Antwort darauf ist
sehr einfach: Sie lautet: Unter den 63 Abgeordneten der zweiten badischen Kammer
waren 1869 nur vier, die für die Rechte des katholischen Volkes eintraten. Das
war aber so, weil es am Wahltag so kam. Die Zeitungen waren damals fast durchweg
in den Händen der anderen. Wohl hatten wir damals in Freiburg
den „Boten“; dagegen aber stand die „Freiburger Zeitung“ und die
„Breisgauer Zeitung“. Diese führten dazumal eine Sprache, die geradezu
unerhört war. Als 1880 Dekan Förderer auf dem Katholikentag zu Konstanz
über die Presse sprach, stellte er fest, daß in Baden
73 liberale Blätter nur sechs katholische entgegenstanden. Diese Verhältnisse
erklären alles!
So
konnte der Staatsminister Jolly den Kampf ohne Bedenken wagen. Er begann
ihn mit den Schwestern auf dem Lindenberg und begann ihn ohne Nachsicht.
7.
Der Sturm bricht los.
Nun
bestand seit 1860 ein Gesetz in Baden
und nach diesem Gesetz und seinem Paragraphen 11 durfte von dem Erzbischof
„kein religiöser Orden und keine einzelne Anstalt eines eingeführten Ordens
errichtet werden - ohne Genehmigung der Staatsregierung!“ Dieses Gesetz fand
auf die Jungfrauen vom Lindenberg gar keine Anwendung; denn fürs erste waren
sie schon lange vor dem Gesetz da, und fürs zweite waren sie keine
Ordensanstalt, sondern nur ein freier religiöser Verein. Daran änderte auch
ihr gemeinsames Kleid gar nichts. Es war übrigens gar kein Ordenskleid.
Allein
in Karlsruhe hatten sie sich es nun
einmal in den Kopf gesetzt, auf dem Lindenberg sei eine Ordensniederlassung und
die habe keine Staatsgenehmigung, und darum müsse die Staatsgewalt
einschreiten, und sie schritt ein.
„Am
18. Dezember 1868 fand sich der Vorstand des Großherzoglichen Bezirksamts Freiburg
in dem Hause ein; nachdem er zu Ibental
die Eigentums- und Heimatsurkunden erhoben, erklärte er der Eigentümerin und
Vorsteherin, daß er mit einer Untersuchung beauftragt sei, und zog die ihm nötig
erscheinenden Erkundigungen ein. Jede Auskunft wurde bereitwillig gegeben und
ihm auf Verlangen alle Räume des Hauses geöffnet.“
Das
war der erste Akt von dem nun anhebenden Trauerspiel. Daß man gerade die
Vortage vor Weihnachten dazu gewählt hatte, zeigt die ganze Rücksichtslosigkeit
der Kulturkämpferei! Man arbeitete rasch, gleich als ob der Staat in Gefahr wäre.
„Am Weihnachtsabend, den 24. Dezember 1868, kam der genannte Beamte wieder und
verkündete den bestürzten Jungfrauen das Erkenntnis des Großherzoglichen
Ministeriums des Innern vom 22. Dezember.“
|
Wie
lautet nun das Weihnachtsgeschenk, das Minister Jolly auf den
Lindenberg zu senden für recht und gut befunden hatte? Da dieses
Christkindle in Form eines Befehles es verdient, nicht in Vergessenheit zu
geraten, soll es in der Hauptsache hier folgen. Der Minister schrieb:
„Da die nach § 11 des Gesetzes vom 9. Oktober 1860 vorgeschriebene
Staatsgenehmigung des in Frage stehenden religiösen Ordens nicht erwirkt
wurde, wird im Hinblick auf § 4 des Gesetzes vom 21. November 1867 der
auf dem Lindenberg, Gemarkung Unteribental, gebildete religiöse Verein katholischer Frauen als
den Staatsgesetzen zuwiderlaufend verboten.“
Derselbe Erlaß beauftragte dann den Beamten, sich zur Publikation
„sofort nach dem Kloster Lindenberg zu begeben“, die Mitglieder des
Vereins auf die Bestimmungen der Paragraphen 4 und 13 des Vereinsgesetzes
hinzuweisen, und ihnen zu eröffnen, daß sie mit Ausnahme der Katharina
Wangler und spätestens bis zum 10. Januar die bisher
gemeinschaftliche Wohnung zu verlassen haben und bis auf weiteres nicht
zurückkehren dürfen!! So geschehen am Vorabend vor Weihnachten 1868 auf
dem Lindenberg.
Unter dem 6. Januar 1869 wandte sich der Rechtsbeistand der verfolgten
Jungfrauen, Dr. von Wänker, an das Staatsmisterium und wies nach,
daß der berufene § 11 des Gesetzes vom 9. Oktober 1860 gar keine
Anwendung auf den Lindenberg finde; denn was dort existiere, sei kein
Kloster, sondern bloß ein religiöser Verein. Außerdem habe dieser schon
vor dem Gesetz von 1860 bestanden. „Die Bildung religiöser Vereine sei
aber gestattet.“ So stellte Dr. von Wänker „die ehrerbietige
Bitte an Großherzogliches Staatsministerium: 1) das Erkenntnis Großh.
Ministeriums des Innern vom 22. Dezember 1868 aufheben zu wollen. Fürsorglich:
2) den auf dem Lindenberg bestehenden religiösen Verein in Erwägung, daß
er ein unverkennbares Bedürfnis befriedigt, niemand beschuldigt, niemals
zu einer Klage oder Beschwerde Veranlassung gegeben hat und dessen
Fortexistenz von den benachbarten Gemeinden als heilsam und vorteilhaft
gewünscht wird - genehmigen zu wollen. 3) Wenigstens hochgefällig zu
bestimmen. welche Verordnungen einzutreten haben und was zu unterlassen
sei, damit der Verein bestehen könne. 4) auch wenn der Verein auch nicht
mehr bestehen soll: höchsteventuell: der Eigentümerin des Hauses nicht
zu untersagen, wen sie will, in ihrem Hause zu belassen.“ |
 |
Herr
von Wänker kannte die damalige badische
Regierung; darum seine mannigfaltigen Anträge. Allein sie halfen alle
miteinander nichts. Das angerufene Staatsministerium bestand durch Beschluß vom
28. Januar 1869 auf der Vernichtung des religiösen Vereins und setzte den
Aschermittwoch - es war der 10. Februar - als letzten Termin zum Verlassen des
Hauses fest!
Man
sollte es nicht für möglich halten, daß solch ein brutales Vorgehen gegen
brave und unbescholtene Jungfrauen noch eine Verteidigung finden würde. Die
„Breisgauer Zeitung“ vom 27. Dezember 1868 und vom 7. Januar 1869 fand den
traurigen Mut, in zwei von vielen Unrichtigkeiten strotzenden Artikeln, die
Schandtat von Lindenberg noch zu verteidigen. Das „Freiburger Katholische
Kirchenblatt“ gab am 27. Januar die entsprechende Antwort darauf. Darin ist
unter anderem auch gesagt,: „Es ist eine schauerliche Verläumdung, wenn die
Jungfrauen vor aller Welt so ziemlich unverblümt als frömmelnde Faulenzerinnen
hingestellt werden, „ eine schändliche“ Verläumdung, wenn ihnen
„beschauliches Nichtstun“ und eine „angelernte Frömmelei“ vorgeworfen
wird.“ Der Volksschriftsteller Hägele aber ließ alsbald eine Broschüre
über die Gewalttat auf dem Lindenberg erscheinen. Sie führt den originellen
Titel: Das erste Brandopfer der Offenburgerei oder die Treibjagd auf dem
Lindenberg. Sie ist 1869 bei Dilger in Freiburg erschienen. Er meinet mit Recht:
„Wenn die Schwestern für gut finden, mehr zu beten als andere Leute, so
schadet dieses Niemand. Die Regierung hat in das Gebet nicht hineinzuregieren.
Sie schreitet ja gegen das Nichtbeten und das Nichtstun auch nicht ein!“
8.
Was ein Augenzeuge davon erzählt.
Das
Urteil war in Karlsruhe gefällt. Von Freiburg aus sollte es vollzogen werden.
Im „Katholischen Kirchenblatt“ Nr. 9 und 10 hat ein Augenzeuge den Vorgang
eingehend also geschildert:
Die
Austreibung der Lindenberger Jungfrauen.
Ich
bin in der Lage, Ihren Lesern über die bei Beginn dieser hl. Fastenzeit
vollzogene polizeiliche Austreibung der Tertiarier-Schwestern auf dem Lindenberg
genauen und wahrheitsgetreuen Bericht zu erstatten. Mit dem 10. Februar, d.i.
mit dem Aschermittwoch, war die den Lindenberger Jungfrauen gewährte
allerletzte Frist abgelaufen. Da die von Herrn Hofgerichtsadvokaten v. Wänker
meisterhaft ausgeführte Rekursschrift einfach als „unbegründet“ zurückgewiesen
oder erklärt wurde, so blieb diesen 50 Jungfrauen nichts anderes übrig, als
Herz und Hände verdoppeltem Eifer zu Gott und unserer makellosen Himmelskönigin
zu erheben. Schon seit dem Sonntag vor Dreikönig beteten und opferten dieselben
in ihrer einfachen, aber ansprechenden und schöngeschmückten Gnadenkapelle
alle Tage vor dem ausgesetzten hochwürdigen Gut. Um 1/2 8 Uhr begann das Amt
mit Erteilung des sakramentalen Segens, wobei die Schwestern tagtäglich mit den
hl. Meß- und Segensgesängen sich beteiligten, die sie, einfache,
kunstloseBauernmädchen, seit 11-12 Jahren mühsam erlernt hatten und an Sonn-
und Festtagen nach Kräften auszuführen pflegten, unterstützt von einem ganz
neuen Orgelwerke.
Je
nach dem Amte sangen sie ein gar liebliches Muttergotteslied nach einer in Rom
üblichen, ganz einfachen und volkstümlichen Melodie. Sofort beteten je vier
Schwestern von Stunde zu Stunde wechselnd vor dem Allerheiligsten ihre üblichen
Stundengebete, ganz besonders aber solche, die ihrer bedrängten Lage am
angemessensten waren, bis abends nach dem Komplet, die von ihnen gleichfalls
immer frischer und munterer gesungen und mit dem feierlichen Segen geschlossen
wurde. Ganz besonders kräftig respondierten die jungfräulichen Sängerinnenauf
das vom Priesterje einen Ton höher angestimmte: Defensor noster, aspice ["Gott
der du unser Schirmer bist, sieh an den Feind und seine List"Sic.] mit
den Worten: Insidiantes reprime, guberna tuos famulos, quos sanguine mercatus es
- und ließen sie zum Schluß dieser ihrer eucharistischen Tagesandacht abermals
freudig das erwähnte „Lied zu Maria von der immerwährenden Hilfe“ ertönen.
Je drohender die Gefahr wurde, desto mehr steigerte sich der Eifer dieser
Schlachtopfer des hl. Altarsakraments, so daß es sogar nötig wurde, ihnen
Schranken zu setzen. Die war besonders der fall während der letzten
Fastnachtstage.
Der
Aschermittwoch war bei wesentlich gleicher Gottesdienstordnung ungestört vorüber.
Die Gendrmen und Brigadiers, die vorher in der näheren und entfernteren
Umgebung häufiger und zahlreicher als gewöhnliche sich zeigten, vermutlich um
zu erkunden, ob die Schwestern vor der verhängnisvollen Frist ihr Heiligtum
verließen, wurden an diesem Tage nicht mehr sichtbar. Am 11. ds. Mts., also am
verflossenen Donnerstage, hatte der Gottesdienst in der eben beschriebenen Weise
vor dem Sanctissimum kaum begonnen, da wurde die Hofbesitzerin aus ihrem Chore
an die Pforte gerufen. In aller Frühe hatten sich nämlich die mit dieser ungewöhnlichen
Exekution beauftragten obrigkeitlichen Behörden auf den Weg gemacht, fuhren,
wie man sagt, bei Nacht und Nebel in einem Omnibus bis nach Rechtenbach, an den
Fuß des Lindenbergs, und erstiegen sofort, den bequemeren Weg über St.Peter
umgehend, von da aus die Höhe des Lindenberges. Wie es beim Oeffnen der Pforte
der Haupteigentümerin zu Mut war, wird jeder fühlen, der nicht bereits ganz
empfindungslos geworden. Augenblicklich sollte das Haus von den Schwestern (mit
Ausnahme der zwei Hausbesitzerinnen und 6-7 weltlich gekleideten Jungfrauen,
sog. Lehr- und Kosttöchtern) geräumt werden. So lautete der Befeht. Sturm und
Regen wetteiferten mit der Eile der Exekution, überboten noch das gleichfalls
stürmische Wetter vom 18. Dez., wo die erste und einzige Untersuchung
stattfand, und vom Vorabend der hl. Weihnachtsfestes, wo die erste Sentenz vom
Bezirksamtsmann Haas in mehr als energischer Weise den beiden Vorsteherinnen eröffnet
worden war. Aus dem Munde der Wälder im Tal hörte man die Aeußerung fallen:
keinen Hund bei solchem Wetter jemand aus dem Hause jagen. Selbst die Diener der
Obrigkeit, abgehärtete, ausgediente Krieger sah man gerührt, mit Tränen in
den Augen. Die Leute geben die Zahl des auf dem Lindenberg und in St.Peter
selbst erschienenen Polizeipersonals auf 12-15 Mann an. Ich kann dies nicht
genau verbürgen. Nur soviel ist gewiß, daß von Gendarmen oder Brigadiers
nicht nur M.-Lindenberg selbst ganz umstellt war, sondern daß auch ihr etwa
8-10 Minuten von der Kapelle in der Gemarkung Eschbach gelegenes Hofgebäude,
sowie die in St.Peter ihnen eigentümliche Wohnung besetzt wurde, um die überall
etwas Ein- und Ausgehenden zu überwachen und zu inquirieren. Man ist es der
Wahrheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit schuldig, hier öffentliche zu
bezeugen, daß der mit dem Vollzug so gemessener Befehle beauftragte
Polizeikommissär mit sichtbarer Teilnahme und möglichster Schonung auftrat.
Auf die dringende Bitte der haus- und Hofbesitzerin, der Veronika Benitz aus
Breitnau, gestattete derselbe, daß der begonnene Gottesdienst noch vollendet
werden durfte. Der Priester selbst, der, vor dem Allerheiligsten stehend und das
hl. Kreuzopfer in unblutiger Weise erneuernd, von all diesen äußeren Vorgängen
nichts wußte, ließ wie bisher nach Vollendung des beiderseits mit ungewöhnlicher
Kraft und Festigkeit gesungenen Amtes das hochwürdigste Gut noch ausgesetzt, mußte
aber dann diesmal seinen recessus, die
übliche Danksagung nach dem hl. Opfer, in ähnlicher Weise beschleunigen, wie
einst die Kinder Israels am Tage der Flucht aus Aegypten. Bis auf 12 Uhr, so
lautete das äußerste Ultimatum, sollte keine der genannten Jungfrauen mehr im
Hause sein, widrigenfalls hätte es beiderseits herzzerreißende Auftritte geben
müssen. Sie dankten Gott und der göttlichen Mutter, doch noch diese
allerletzte Frist und die Möglichkeit erlangt zu haben, mit der allernötigsten
Kleidung etc. sich zu versehen und das letzte Mal am so lieb gewordenen
gemeinsamen, schwesterlichen Tische auch dem Leibe die nötige Kraft zu geben,
so gut es unter solchen Umständen gehen mochte; wie sie an diesem Donnerstage
(dem allwöchentlichen Gedächtnistag der Einsetzung des heil. Altarsakraments)
und wie sie bereits seit dem Sonntage vor Dreikönig alle ihre Seele zu diesem
harten und so heiligen Kampfe mit dem Leib des Herrn, mit dem Brot der Starken
gekräftigt hatten.
Inzwischen
eilte der Priester, der den Gottesdienst abgehalten hatte, eiligen Laufs über
die Höhen zwischen M.-Lindenberg und St.Peter durch Kot, Sturm und Regen, um
teils unterwegs, teils in St.Peter selbst an den Türen christlicher und
barmherziger Familien anzuklopfen und um Aufnahme der verjagten Schwestern zu
bitten. Das Hofgut selbst liegt, wie gesagt, in der Gemarkung Eschbach, während
die von den Jungfrauen seit 1855 gemeinschaftlich bewohnten Gebäulichkeiten
neben der Lindenbergkapelle in die Gemeinde Unteribental gehören. Auch in jenes
alte, ganz baufällige Oekonomiegebäude wurde ihnen die Zuflucht untersagt. In
dem eine starke halbe Stunde vom Lindenberg gelegenen St.Peter, wohin dieser
eingepfarrt ist, besitzt eine der Jungfrauen, Katharina Ruf, gebürtig aus
St.Peter selbst, ein niedliches Wohnhaus mit kleinem Oekonomiegebäude. Kraft
zweier in das Grundbuch eingetragener Verträge haben in demselben außer der
genannten Eigentümerin selbst noch acht andere Personen auf 20 Jahre Wohnrecht.
Aber auch in dieses Haus wurde ihnen der Eintritt gewaltsam verwehrt, mit
Ausnahme der Eigentümerin und ihrer ältesten Gefährtin, der Magdalena Pfändler
von Zarten.
Als
der obengenannte Priester, Wilhelm Thummel, Spiritual des Priesterseminars,
wieder auf den Lindenberg zurückgekehrt war, begab er sich in die
Wallfahrtskapelle, um das noch immer ausgesetzte Allerheiligste zu reponierne
und vorher den auf ihrem neuen Chor versammelten Schwestern (für jetzt) das
allerletzte Mal den sakramentalen Segen zu erteilen. Das war das letzte „Genitori“
und das letzte „Gelobt und gebetet sei ohne End´ das allerheiligste
Altarssakrament!“ - das seit 11 Jahren so oftmals die aus Nah und Fern
herbeiströmenden Pilgern erbaut hat. Orgel, Gesang und Gebt der Schwestern. das
Tag und Nacht ohne Unterlaß aus Herz und Mund aus mehr als einem halben Hundert
katholischer Jungfrauen für Fürst und Vaterland, für Weltliche und
Geistliche, für Zeitliches und Ewiges, für Lebendige und Abgestorbene,
insbesondere für das so nahegelegene Priesterseminar der großen, schon so
lange und immer härter bedrängten Erzdiözese wie ein lieblicher Wohlgeruch
vor der geheimnisvollen Bundeslade des neuen Bundes aufstieg, - sie müssen
jetzt alle weichen, wie einst das Kind Jesus mit Maria und Joseph sich genötigt
sah, in der Fremde einen Zufluchtsort zu suchen. Unterdessen waren die in aller
Eile zubereiteten Leiterwägen herbeigeschafft worden. Es waren drei, bestimmt,
diese unschuldige Schlachtopfer unter Sturm und Regen nach St.Peter zu
verbringen. Die Schwestern, diese jungfräulichen Bräute des gekreuzigten
Welterlösers im hhl. Altarssakramente, nachdem sie mit der allernötigsten
Kleidung und mit P. Iso Walsers „Buch der Ewigen Anbetung“ sich versehen und
im Geiste ihrem Schöpfer und Erlöser dieses harte Opfer dargebracht und dem
Schutze ihrer schmerzhaften himmlischen Mutter sich empfohlen hatten, -
erschienen nacheinander an der Pforte des Hauses, über welcher das liebliche
Bild der jungfräulichen Himmelskönigin glänzt, vor dem Herrn Polizeikommissär,
wurden nach dem obrigkeitlich aufgenommenen Verzeichnisse sorgfältig
kontrolliert und bestiegen sofort schweigend wie Lämmer, die zur Schlachtbank
geführt werden, die bereit gehaltenen Leiterwägen, eingedenk des makellosen
Lammes, das seinen Mund nicht auftat, als es auf Kalvaria zur Schlachtbank geführt
wurde. Was sie Einzelnen dachten und fühlten beim Austritt aus ihrem so
stillen, friedlichen Schwesternhause, beim Besteigen der Wägen und bei deren
Abfahrt, und als die ihnen und allen aufrichtigen Christenseelen aus nah und
Fern so lieb gewordene Gnadenkapelle immer mehr aus den Augen schwand und dann
auf demselben Wege, auf dem sie so oftmals paarweise bei Hitze und Kälte frohen
Herzens, gestärkt durch Gebet, Betrachtung der hl. Kommunion und Opfer, auf den
Feldern ihres sichtbarlich so gesegneten Hofgutes zur mühsamen Tagesarbeit sich
verteilten - was sie auf diesem Wege fühlen mußten, auf welchem sie kaum
einige Wochen zuvor die Leiche ihrer ältesten Mitschwester, einer 68 jährigen
Witwe aus Breitnau, die der göttliche Bräutigam noch zur rechten Stunde in
eine bessere Heimat zu sich geholt, zum Friedhof nach St.Peter geleitet hatten -
das ist nur Gott dem Allwissenden bekannt. Einst wird es offenbar werden, an
jenem Tage nämlich, wo Fürsten und Völker, Regenten und Regierte, Schwache
und Mächtige vor dem Richterstuhle des lebendigen, dreieinigen Gottes
erscheinen werden.