Vorwort
Als vor etwa einem Vierteljahr von Herrn Architekten Ruch der Gedanke
aufgeworfen wurde, in den Schlussstein des neuen Schulgebäudes doch
wenigstens die Namen der Bürgermeister und Lehrer zu geben, die hier in
den letzten 150 Jahren wirkten, wurde diese Anregung von Herrn
Ratschreiber Schwär und mir dankbar angenommen. Doch war es uns von
Anfang an klar, dass die Gelegenheit günstig sein könnte, etwas
entstehen zu lassen, dessen Fehlen von beiden schon zu verschiedenen
Malen schmerzlich empfunden wurde. Gemeint war, eine, wenn auch
bescheidene Chronik unseres Heimatdorfes Eschbach. Mindestens der
Lehrer hat in seinem Heimatkundeunterricht schon des öfteren diese
Lücke erfahren müssen, hält er doch dafür, dass die Frucht dieses
Unterrichtes nicht nur das Wissen um die Heimat, sondern vielmehr die
wissende Liebe zur Heimat sein soll. Wem sollte diese wissende Liebe
aber mehr gelten, als den Generationen von Menschen, die vor uns in
diesem Tale lebten, litten und lachten, deren aus viel mühsamer Arbeit
erwachsene Erfolge und deren Versagen das Tal zu dem gemacht haben, was
es heute ist. Dass in dieser bescheidenen Chronik diese Menschen aus
der Vergangenheit auftauchen und nicht stumm auftauchen, sondern laut
und vernehmlich sprechen, und oft auch als die Väter und Mütter seiner
sonst vor ihm sitzenden Kinder, dies alles macht sie dem Lehrer so
wertvoll für seine kommende Arbeit.
So gilt es denn Dank zu sagen, allen, die ihre Arbeitskraft und ihre
Kenntnisse zum Gelingen dieser Chronik eingesetzt haben: unserm H.H.
Pfarrer Dr. Meisner für seine Pfarrgeschichte, Herrn Ratschreiber
Schwär für die Gemeindegeschichte seit Beginn des 19. Jahrhunderts,
sowie für die Überarbeitung der Teile 1, 2, und 7. Besonderer Dank aber
gilt zwei Herren, die, obwohl nicht Eschbacher, sich für den Plan
erwärmen liessen und uns ihre Mitarbeit nicht versagten: Herrn W.
Stülpnagel vom statistischen Landesamt Freiburg für die Überlassung von
Material und die Ausarbeitung der Teile 1, 2 und 7, sowie Herrn
Ratschreiber Weber aus St.Peter, der seit vielen Jahren in stiller,
gründlicher Arbeit die Vergangenheit unserer näheren Heimat
durchforscht, und sich wie kein zweiter in der Hof- und
Familiengeschichte auch unseres Tales auskennt. Es ist keine Frage,
dass ohne seine gelegentlich in der Badischen Zeitung erschienenen
Zeitungsartikel wohl auch die vorliegende kleine Chronik nicht
entstanden wäre, denn dieselben wirkten als Denkanstoss und hoben die
ersten Schleier über dem geschichtlichen Dunkel des Tales und weckten
die Lust zu neuen Entdeckungen. Ihm sei herzlich für Teil 3 gedankt.
Wenn Teil 6 meine eigene Arbeit über die Schulgeschichte etwas
umfangreicher wurde als die übrigen, möchte ich mich hierfür
entschuldigen. Schuld daran ist nicht die bestimmt falsche Ansicht, sie
müsste in der Dorfchronik den wichtigsten Platz beanspruchen, sondern
viel mehr der Anlass zur Entstehung des folgenden, die
Schlusssteinsetzung des neuen Schulhauses, lenkte zunächst, vielleicht
etwas zu einseitig, die Aufmerksamkeit auf diesen Teil. Doch ist
Schulgeschichte immer ja auch ein Stück Dorfgeschichte, die dahinter
nicht zu kurz kommen soll.
Eschbach, am 30. Dezember 1966
Norbert Graf, Oberlehrer
Inhaltsübersicht
Vorwort
I. Markung und Siedlung (W. Stülpnagel)
II. Bevölkerung (W. Stülpnagel)
III. Frühere Herrschafts und Grundbesitzverhältnisse (K.Weber)
IV. Gemeindegeschichte seit 1811 (H. Schwär)
V. Aus der Geschichte der Pfarrei Eschbach (Dr. H. Meisner)
VI. Schulgeschichte der Gemeinde Eschbach (N. Graf)
1. Anfänge des Schulwesens überhaupt
2. Anfänge des Schulunterrichtes im Dorf in schwerer Zeit
3. Der erste Schulhausbau in Eschbach
4. Schulisches Leben
5. Die Lehrer von Eschbach
6. Schule heute und morgen
VII. Entwicklung von Landwirtschaft, Gewerbe und Handel (W. Stülpnagel)
Quellennachweis
I. Markung und Siedlung
Die Gemarkung umfaßt einen großen Teil des vom Zartener Becken nach
Nordosten zur Mulde von St.Peter ziehenden Eschbachtals mit seinen bis
zu 300 m über des Talboden ansteigenden Hängen. Das 200 - 250 m breite
Tal erweitert sich gegen die Talmündung hin beträchtlich. Von beiden
Seiten münden Nebentäler ein; die von Norden kommenden greifen
besonders tief in die benachbarten Hänge ein und gliedern sie stark
auf. Die größten sind der Scherlenzendobel, der Wolfsgrundbach mit dem
Langenbach und das Steurental.
Die Markung zeigt fast quadratische Form, doch mit unruhigem Verlauf
der Grenzlinien. Im Norden zieht die Markungsgrenze vom Flaunser (866
m), dem höchsten Punkt der Markung, auf dem das Eschbachtal vom
Glottertal trennenden Kamm über den Brombeerkopf (864 m) zum Langeck
(848 m). Von dort fällt die Ostgrenze nach Süden zum Eschbach und
steigt auf der gegenüberliegenden Seite zum Lindenberg auf rund 800 m
an. Die Grenze verläuft weiterhin nach Südwesten auf der Höhe zwischen
Eschbachtal und Unteribental, bis sie schließlich in gewundenem Verlauf
über den Grätlewald zum Reckeneck (488 m) abfällt. Im Süden überquert
sie das hier breite Eschbachtal und erreicht dabei ihren tiefsten Punkt
mit 390 m. Dann steigt sie in vielen Windungen über Schererseck (515 m)
und Waseck (641 m) zum Flaunser an.
In geologischer Hinsicht liegt die gesamte Gemarkung im Grundgebirge.
Die landwirtschaftliche Nutzfläche hat von 763 ha im Jahre 1949 auf 598 ha im Jahre 1966 abgenommen. Von diesen letzteren waren
Ackerland 116 ha, das sind 16% der LN
Wiesen 226 ha, ıı
ıı 32% ıı ıı
Weiden 356 ha, das sind 51% der LN
Das Grünland nimmt demnach über fünf Sechstel der landwirtschaftlichen
Nutzfläche ein. Das Ackerland hat dagegen schon seit Ende des vorigen
Jahrhunderts anteilmäßig allmählich abgenommen.
In steilen Hanglagen trat oft eine Abschwemmung der Ackerkrume ein: die
Erde mußte immer wieder hinaufgeschafft werden. Dem Wald kommt hier
eine große Schutzwirkung gegen die Abschwemmung zu. Es ist Mischwald
der unteren Bergwaldstufe des Schwarzwalds. 53% des Waldes auf der
Markung sind Tanne, 25% Fichte mit Douglasie und 17% Buche. Der Wald
nimmt 45% der Markung ein. Eschbach gehört zum Einzelhofsiedlungsgebiet
des Schwarzwalds. Die Höfe reihen sich dem Bach entlang auf beiden
Seiten auf, öfters sind sie etwas am Hang hinaufgerückt. Ihre Abstände
wechseln stark und betragen zwischen 150 bis gegen 700 m. Weitere Höfe
liegen in den Nebentälern. Ein kleiner Siedlungskern hat sich im Zinken
Untertal bei der barocken Kirche mit angebautem Pfarrhof, Rathaus mit
alter Schule ausgebildet. In der Nähe liegen eine Wirtschaft, zwei
Warengeschäfte, das neue Schulgebäude und ein in Erweiterung
begriffenes junges Wohngebiet.
Die Zahl der Wohngebäude wuchs demzufolge von 86 im Jahre 1950 auf 98
im Jahre 1961, 129 im Jahr 1966. Außer dem Neubaugebiet bei der Kirche
entsteht ein zweites im Untertal-Reckenberg.
Das Wohnplatzverzeichnis von 1961 führt die Zinken und einen Teil der
Einzelhöfe an. Die wichtigsten Wohnplätze sind von oben nach unten :
Obertal und Untertal - hier steht die Kirche im Eschbachtal selbst; es
folgen auf der rechten Bachseite Engelberg, Reckenberg und Steurental,
auf der linken Berlachen; Hintereschbach liegt nördlich der Kirche.
Die alten Höfe, ganz aus Holz erbaut, sind mit ihrem Hofland in
rechtlicher Beziehung geschlossene Hofgüter. Im Jahr 1900 wurden in der
Gemeinde deren 51 gezählt, im Jahr 1964 noch 46. Der zu den Höfen gehörende Grundbesitz kann in schmalen Streifen über
das ganze Tal von Kamm zu Kamm reichen. Im Obertal liegt er jedoch nur
zwischen dem südlichen Grenzkamm und dem langgestreckten Rücken des
Langeck bei etwas breiteren Granzabständen. Im Untertal grenzen die
Besitzungen an die Grundstücke der Höfe in den Nebentälern. Infolge der
heutigen intensiveren Wirtschaftsmethoden bewirtschaften die Hofbauern
nur noch einen Teil ihres früheren Besitzstandes.
Nach ihrer Bauart gehören die alten Hofgebäude zu den Heidenhäusern.
Der Hugmichelhof wurde im 16.Jh. errichtet und 1754 versetzt. Bei ihm
steht eine steinerne Backküche. Zu den Höfen gehören auch
Speicherbauten, wie beim hinteren Bauernhof im Steurental, und
Kapellen, so beim Mooshof (erbaut 1737). Auf den angrenzenden Höhen
liegen Viehhütten und Berghäusle, wie die des-Maierhofs und des
Gasthofs "zum Löwen". Das Berghäusle des oberen Bauern stammt von 1648.
Die Neuzeit brachte manche Umbauten.
Der Hof Berlachen erscheint bereits um 1200, er geht damals aus dem
Besitz Walters von Falkenstein an das Kloster St.Peter über. Dinghof
des ritterschaftlichen Anteils von Eschbach war der Gitzenhof (heute
Schwabenhof), der 1311 unter dem Namen Gitzenhofen erscheint, damals
vielleicht noch eine umfangreichere Siedlung, wo auch das Kloster
Oberried begütert war. Seit dem 15.Jh. wurde der Gitzenhof von den
Schnewlin von Landeck zu Wiesneck, danach von der Herrschaft Sickingen
in Ebnet als Erblehen vergeben. Das Steuerntal, seit 1342 genannt, war
ein Bestandteil der Klosterherrschaft St.Peter. Dort lagen zu Anfang
des 15.Jh. 7 Höfe, zu Ende desselben sind nur noch 4 genannt. Eine
Kumulierung der ursprünglichen Lehen auf eine geringere Zahl von Höfen
wurde auch beim Hauptwohnplatz des Talgebiets, in Vordereschbach,
festgestellt. Hier trugen 16 Höfe 28 Lehen. Ob hier eine allgemeine
Tendenz zur Vergrößerung der Bauerngüter wirksam war, läßt sich noch
nicht ohne weiteres entscheiden. Der große Hof Reckenberg, 1514
genannt, der eine eigene Gemarkung bildete, wurde wohl erst im 18.Jh.
zerschlagen. 1827 wohnten 6 Familien auf diesem Gut. Bis 1890 gehörte
Reckenberg zur Herrschaft Kageneck in Schloß Weiler bzw. zur Gemeinde
Stegen, und kam erst in diesem Jahre zur Gemeinde Eschbach, während
dafür die fünf ehemals sanktpeterschen Höfe in Rechtenbach nach Stegen
eingemeindet wurden.
II. Bevölkerung
Im sanktpeterschen Teil von Eschbach (einschließlich Rechtenbach; jetzt
Gem. Stegen, dagegen ohne Reckenberg, damals Vogtei Stegen, das aber
die Einwohnerzahl von Rechtenbach nicht ganz erreichte), wohnten 1789
in 49 Häusern 457 Einwohner, im sickingischen Anteil in 14 Häusern 109
Einwohner, zusammen also 566, in berichtigtem Ansatz rund 550. Dazu
müßte ein Teil von Wiesneck (damals selbständige Vogtei) mit
schätzungsweise 40 Einwohnern gerechnet werden, um den heutigen
Gebietsstand zugrunde zu legen; das ergäbe insgesamt rund 590
Einwohner. Um diese Zahl herum hat sich der Bevölkerungsstand auch des
ganze 19.Jh. hindurch bewegt. Für 1809 lassen sich auf heutigen
Gebietsstand rund 600 Personen berechnen, 1852 werden 627 gezählt. Man
unterschied im ehemals sanktpeterschen Eschbach zwischen Bauern (34),
Viertelsbauern (7), Taglöhnern in eigenen Häusern (15) und Hintersassen
in Berghäusern (16); das ergab zusammen 70 Familien (1827).
Weiterhin bleibt die Einwohnerzahl meist unter 600. 1890, nachdem der
heutige Gebietsstand hergestellt wer, betrug sie 575 und unterlag von
da an bis 1939 (587 Einwohner) nur geringfügigen Schwankungen. Eine
merkliche Zunahme erfolgte erst in neuester Zeit : von 627 im Jahre
1950 auf 644 (darunter 26 Heimatvertriebene) im Jahre 1961 auf 775 am
50.6.1966.
Von der Gesamtzahl der Erwerbspersonen waren tätig in :
| 1895 | 1950 | 1961 | |
| Land-und Forstwirtschaft | 80,4% | 73,0% | 54,4% |
| Produzierendem Gewerbe | 8,5% | 17,9% | 24,9% |
| Handel und Verkehr | ---- | 3,1% | 11,0% |
Von den i. J. 1966 gezählten 163 Berufspendlern gingen 102 nach
Freiburg, 43 nach Kirchzarten. Die Zahl der Einpendler aus anderen
Gemeinden beträgt 18.
Die Zahl der katholischen Einwohner betrug 1961 609 (94,6%). Gab es
1925 nur 4 Evangelische am Ort, so war deren Zahl infolge
vorübergehender Unterbringung von Flüchtlingen auf 52 im Jahre 1950
gestiegen. 1961 wurden 35 (5,4%) Evangelische gezählt, die nach
Kirchzarten eingepfarrt sind.
III. Frühere Herrschafts - und Grundbesitzverhältnisse
In den königlichen Besitzbestätigungen für das Kloster Einsiedeln seit
dem Jahre 969 wird unter den Örtlichkeiten mit Klostergütern auch
Zarten aufgeführt. Hierbei handelt es sich um Besitz, z.T. wohl auch
früheren Reichsbesitz, der dem Grafen Guntram, als er sich gegen König
Otto I. empört hatte, entzogen worden war. Bei Zarten kann es sich
nicht um den späteren Ort; sondern nur um Güter in der Mark Zarten
bezw. Kirchzarten gehandelt haben, deren Umfang dem Kirchspiel
entsprach; das im Mittelalter das gesamte Talgebiet mit Ausnahme von
Kappel umfasste. Erst aus dem Einsiedler Urbar vom Anfang des 13.Jhı
erfahren wir näheres über die in der alten Mark Zarten gelegenen Güter
des Klosters; Es sind die Dinghöfe von Ebnet und Eschbach. In Eschbach
bestand außerdem ein weiterer Dinghof, der dem Kloster St.Peter gehörte.
Der größere Teil von Eschbach gehörte bereits zur Gründungsausstattung
des Klosters St.Peter. Die erste Grenzbeschreibung im Rotulus
Sanpetrinus führte um das Jahr 1112 folgende Punkte als westliche
Grenze des Klostergebiets an: Wisinegga (Wiesneck) Sconeberg -
Staffilegga. Etwas ausführlicher ist die zweite Grenzliste aus der Zeit
um 1200: Wisenegge (Burg Wiesneck) - Staphelegge oder Wasenegge
(Waseck) - Flansen (Flaunser) Wipphi (Lindlehöhe).
Der erste Grenzbeschreibung begann mit der Bezeichnung einer Örtlichkeit
"Acelinisbach". Ob damit Eschbach gemeint ist? Im gleichen Rodel wird
von der Schenkung einer Mühle im "Asschebach“ berichtet, womit wohl Eschbach gemeint ist. Spätere
Schreibweisen sind Eschebach (1273) und vor allem Espach (1526). Früh
wird Berlachen genannt, denn schon vor 1122 schenkt Walter von
Falkenstein sein Eigentum bei Weiler (Stegen) und Berlachen an das
Kloster St.Peter.
a) Die weltliche Obrigkeit
Im Jahre 1218 erloschen im Mannesstamm mit Bertold V. die Zähringer
Herzöge, die Gründer und Kastvögte von St.Peter. Ihr Erbe im Breisgau
wurde Graf Egon von Urach. Er und seine Nachkommen, die Grafen von
Freiburg, waren nun die Kastvögte des Klosters. Ohne auf das
Grundeigentum des Klosters Rücksicht zu nehmen, verbot um 1300 einer
der Grafen als Kastvogt den Bewohnern von Eschbach bei schwerer Buße,
fernerhin Mühlen in ihrem Tale zu bauen und in ihnen mahlen zu lassen.
Als die Stadt Freiburg im Jahre 1368 sich von der Herrschaft dieser
Grafen loskaufte und diese als Entschädigung Burg und Herrschaft
Badenweiler bekamen, behielten die Grafen dennoch die Kastvogtei über
das Kloster St.Peter bei. Graf Konrad verpfändete 1393 für seine
Schulden die klösterlichen Gebiete zu Rohr, Eschbach und Ibental. Zwei
Jahre später erfolgte für 600 Goldgulden an den Ritter Hans von
Blumeneck eine dauernde Verpfändung, die erst 1421 wieder eingelöst
wurde.
Im Jahre 1444 kam die Kastvogtei des Klosters von den Grafen von
Freiburg an die Markgrafen von Hachberg auf Schloß Badenweiler. Die
Kastvögte hatten in Gerichtssachen zu entscheiden, bei denen es um das
Leben des Angeklagten ging, und bezogen die sogenannte Vogtsteuer. Nach
jahrzehntelangen Reibereien zwischen Abt und Markgraf, der 1522 das
Kloster besetzte, erfolgte im Jahre 1528 der Übergang der Kastvogtei
des Klosters von den Markgrafen von Hachberg an das Haus Habsburg bezw.
Österreich, damit ein langgehegter Wunsch des Klosters erfüllt. Die
Bauern mußten der neuen Regierung schwören. Freiburg stand bereits seit
1368 unter österreichischer Herrschaft. Eschbach blieb österreichisch,
bis es 1806 badisch.wurde.
b) Vom Dingrecht des Klosters
Das Kloster St.Peter war im größten Teil von Eschbach Grundherr und
Lehensherr und bezog aus diesen Rechten verschiedene Abgaben, wie
Martinizins, Fähle, Erschatz (bei Besitzänderung usw. Hinsichtlich der
Wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bewohner gab es wie in anderen
Klostervogteien auch in Eschbach einen Dinghof (Meierhof), dem die
Erblehenhöfe zugeordnet waren.
Politischer und wirtschaftlicher Mittelpunkt eines jeden Tales oder
jeder Vogtei war der Dinghof (Meierhof), der besondere Rechte genoß. Im
Rechte des Dinghofs zu Eschbach bestimmt, daß der Zaun von Haus und Hof
"so weit sein soll, daß ein jeglicher Mann mit einem Stein von einem
anderen werfen möge". Im Eschbacher Hofrecht aus der 15. Jahrhundert
heißt es, er sei gefreit von Königen und Kaisern, und wer dort Frevel
verübte, zahle 100 Mark Goldes, zur Hälfte dem Abt und zur Hälfte dem
Kaiser. Dreimal jährlich kamen die Bauern zur Rechtsprechung auf dem
Dinghof zusammen. Wer unentschuldigt fehlte, mußte eine Geldbuße
bezahlen. Der wichtigste Dingtag war Mitte Februar. Dabei wurde der
Dingrodel vorgelesen, Kaufverträge abgeschloßen und Streitigkeiten
geschlichtet. Dinggerichte fanden noch bis gegen 1700 statt. Im Jahre
1720 verkaufte das Kloster den Maierhof, der bisher von einem Pächter
("Maier") bewirtschaftet wurde, als Erblehenhof in Privatbesitz.
Zu dem Eschbacher Dinggericht gehörten auch vier Höfe in Neuhäuser. Die
sanktpeterschen Rechte über diese wurden 1566 an das Kloster Günterstal
verkauft.
Das älteste Dingrecht geht bis in die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts
zurück. Es wurde 1326 erneuert. Eine wichtige Rechtsweisung ist das
Weisthum vom Jahre 1416, das die Rechte zwischen dem Kloster als
Grundeigentümer und dem Kastvogt abgrenzte. Erneute Streitigkeiten
zwischen dem Markgrafen von Hachberg und dem Kloster führten im Jahre
1456 zur Abfassung des großen Dingrodels, eines der vollständigsten
Bauernrechte, die erhalten sind. Es trägt den Titel: Dink-Recht zu
Espach, Ywa (Oberibental), Rohr und Luterbach (Glotterbad).
Der Dingrodel, der viele Rechtsfälle im bäuerlichen Leben regelte,
schuf die Grundlagen für das Gewohnheitsrecht, wie die Unteilbarkeit
der Höfe und das Erbrecht des jüngsten Sohnes.
Er hatte im wesentlichen Gültigkeit solange das Kloster bestand, also bis 1806.
Während der Dingrodel von 1456 sozusagen auf demokratische Art in
Zusammenarbeit zwischen Bauernschaft und Kloster entstand, erließ der
Abt 1582 einseitig eine sogenannt Polizeiordnung, die viele einengende
Bestimmungen brachte und gleichen Rang wie der Dingrodel erhielt. Die
Auslegung der alten Bestimmungen führte gelegentlich zu langwierigen
Prozessen zwischen den Vogteien und dem Kloster.
Der Grundbesitz der 19 Höfe, die zum Kloster gehörten, umfaßte 1773
insgesamt 2761 Juchert Feld und Wald. Auf diesem Gebiet standen damals
47 Häuser. Gleichzeitig zählten zum Sickingischen Eschbach 14 Häuser,
davon fünf Berghäusle.
c) Von Jagdrecht und Waldnutzung
Mit den Herren von Reischach auf dem Schloß zu Weier(Stegen) führten
die Äbte einen langjährigen Prozeß, den die vorderöstereichische
Regierung 1593 dahingehend entschied, daß dem Kloster das Hege- und
Jagdrecht im Steurental und in Eschbach zugesprochen wurde. Im Jahre
1602 erließ der Abt eine Wildordnung, in der das Eintreiben von Vieh,
das Holzfällen und die nieder Jagd geregelt wurde. Da die Eschbacher
Gemeinde "schon von geraumer Zeit wider alle oberkaitliche befelch mit
schädlichen Holzhauen gar excessive gehandelt in daßigem_Allmendt...,
daß hieraus schon etlich Jahr nicht das geringste Wildpräth geliefert
wurde", erließ der Abt im Juni 1683 für die Untertanen in Eschbach und
Ibental eine neue Ordnung über das Holzfällen, Jagen und Fischen.
Auf Antrag der Bauern von Eschbach, die statt der jährlichen Holzabgabe
für jeden Hof sieben Juchert Waldfläche erbaten, wurde der Eschbacher
Allmendwald aufgeteilt. Der Vertrag wurde am 16. Herbstmonat 1797
abgeschlossen. Von den 159 Juchert großen Allmendwald behielt das
Kloster seinen Anteil mit 40 Juchert, während jedem der 17 Bauern
sieben Juchert zugewiesen wurden. Die Regierung in Freiburg genehmigt
den Vertrag erst nach langen Verhandlungen im Jahre 1800.
d) Das sickingische Eschbach
Der Dinghof des Klosters Einsiedeln (Gitzenhof - Schwabenhof) stand
zunächst unter üsenbergischer, in deren Nachfolge unter
hohengeroldseckischer Vogtei. 1428 wurde Hans Adam von Falkenstein zu
Dachswangen durch Walter von Hohengeroldeck mit dem Tal zu Eschbach,
d.h. mit der Vogtei des Einsiedler Maierhofs und zugehöriger sieben
Höfe belehnt. Seit 1444 besaß die Straßburger Familie Bock das Lehen.
Gangolf von Hohengeroldseck verkaufte 1504 das sogen. Finsterwalder
Gericht zu Eschbach, also den wesentlichen Inhalt der Vogtei, an David
von Landeck, Herrn der Herrschaft Ebnet. Der Dinghof kam, nachdem er im
15. Jahrhundert von Einsiedeln an das Kloster Ettenheimmünster
übergegangen war, im Jahre 1505 durch Weiterverkauf gleichfalls in den
Besitz Davids von Landeck, und um 1600 zusammen mit dem übrigen
Landecker Erbe im Kirchzartener Talgebiet an die Herren von
Sickingen-Hohenburg. Zum wisneckischen oder sickingischen Eschbach
gehörten folgende Höfe: Berlacherhof, Schwabenhof (davon der
Breunlisberg in die Herrschaft St.Peter), Gasthaus "Zum Engel",
Peterbauernhof, Berjörgenhof, Mathislehof, Scherpeterhof,
Scherthomashof, sowie die von diesen Höfen abgetrennten kleineren
Güter. Einer dieser Bauern war jeweils Vogt im sickingischen Eschbach.
Die Herrschaft Sickingen mit Sitz auf dem Schloß zu Ebnet umfasste im
Dreisamtal die Gemarkung Ebnet, die vier Höfe zu Wiesneck (Buchenbach),
den Hansmüllerhof im Rechtenbach und den genannten Anteil von Eschbach.
Die Grundherrschaft Sickingen wurde 1808 an den badischen Staat
verkauft.
e) Notzeiten durch Krieg und Seuchen
Die äußere Geschichte der Gemeinde wurde vor allem durch Kriege und
Seuchen bestimmt. Schon um 1550 wird von einer pestartigen Krankheit
berichtet, die in vielen Ortschaften die Mehrzahl der Bevölkerung
wegraffte, sodaß weite Grundstücke unbebaut liegen blieben. Hundert
Jahre später fielen der Pest, dem sogenannten schwarzen Tod, Opfer.
Dies führte zu einer Entwertung des Grundbesitzes und zur Verödung
zahlreicher Höfe.
In großen Bauernkrieg von 1525 scheint sich Eschbach nicht besonders
hervorgetan zu haben, denn es heißt von Eschbach und Rechtenbach "will
der Apt von St.Peter verantworten".
Auch 1553 herrschte die Pest im Breisgau und 1610/1611 raffte sie nochmals viele Einwohner hinweg.
Viel Unglück und Not brachte der Dreißigjährige Krieg. 1652 wurde
Freiburg von den Schweden eingenommen. Die umliegenden Ortschaften
wurden geplündert, das Vieh fortgetrieben und die Häuser angezunden.
Als dann die kaiserlichen Truppen in den Breisgau eindrangen, hausten
sie in ähnlicher Weise. 1658 nahm der Herzog von Weimar Freiburg ein,
das 1644 von der kaiserlichen zurückerobert wurde. Bei den Kämpfen
wurde im gleichen Jahr Kirche und Kloster zu St.Peter niedergebrannt.
In dieser Zeit ist auch die Kirche zu Eschbach zerstört worden.
Schwere Kriegszeiten entstanden für den Breisgau durch die Raubzüge des
Französischen Königs Ludwigs XIV. In September 1676 plünderten zunächst
kaiserliche Soldaten tagelang das Klostergebiet. Im folgenden Jahr
belagerte und eroberte eine französische Armee Freiburg. Auf ihren
Streifzügen richteten die Franzosen so viel Unheil an, daß man es eher
"mit Tränen als mit Tinte“ beschreiben sollte. Auch über das Jahr 1678
ist "nichts zu berichten als Elend". Die Leute waren mit dem Vieh in
die Wälder geflohen. Bei Kämpfen zwischen Französischen und
Kaiserlichen brannte 1678 das Kloster St.Peter nieder. 1688 begannen
neue Kriegsunruhen, zumal die Franzosen noch immer Freiburg besetzt und
die Kaiserlichen sich auf dem Hohlen Graben (beim Turner) verschanzt
hatten. Auch Eschbach im Spannungsfeld zwischen zwei feindlichen Heeren
litt unter Plünderungen und schweren Abgaben an Geld und Naturalien.
Erst 1697 wurde Friede geschlossen.
Auch der spanische Erbfolgekrieg (1701-1714) brachte Not und Elend. Die
schlimmsten Drangsale und Plünderungen geschahen 1713 als ein
französischer Marschall Freiburg belagerte und einnahm. Hunger, eine
Viehseuche und eine Epidemie, das sogen. Ungarische Fieber,
verschlimmerten die Not. 1714 kam der langersehnte Friede.
Auch die Kriege Friedrichs des Großen machten den Breisgau zum
Kriegsschauplatz. 1744 belagerte und eroberte eine französische Armee
Freiburg. Während der Belagerung wurde ein Bauer von Eschbach auf
offener Straße von den Franzosen umgebracht. Das Kloster schätzte den
Wert der Naturalien, die es in diesem Krieg leisten musste, auf 14.000
Gulden. Davon mussten die Untertanen 6000 Gulden vergüten, von denen
wiederum ein Anteil auf Eschbach entfiel.
Viel Kriegselend brachte die Zeit Napoleons. Nachdem die Franzosen 1796
Freiburg erobert hatten, hausten die feindlichen Truppen gar schlimm
auch in Eschbach, wo die Bewohner schwer misshandelt wurden. Der Abt
schreibt dazu: "Die Untertanen in Eschbach sind entsetzlich ruiniert,
ausgezehrt und ausgeplündert." Erst das Ende der Befreiungskriege 1814
leitete eine langandauernde Friedenszeit ein.
IV. Gemeindegeschichte seit 1811
Schon im 15 Jh. gab es zwischen der Gemeinde Eschbach und der
Klosterherrschaft St. Peter Streitigkeiten wegen der Pflug- und
Jagdfronen, wegen Heuzehnten, Abzugsgeldes, Holzbezugs und freien
Viehverkaufs. Wie anderwärts wurde endlich die vorderösterreichische
Regierung eingeschaltet, die 1628 eine vermittelnde Entscheidung traf.
Auch die Frage der Leibeigenschaft über deren "Einführung" die
Untertanen sich beklagten (1694), spielte zu dieser Zeit eine Rolle.
Die Gemeinde des sanktpeterschen Anteils verfügte über Waldbesitz, wie
der Verkauf einer Strecke Wald an das Kloster im Jahre 1588 zeigt. Im
18. Jh. besaßen fast alle Bauern in Eschbach eigene sogenannte
Lehenswaldungen im Gesamtumfang von über 500 Jauchert. Daneben bestand
eine herrschaftliche Allmendwaldung von rund 160 Jauchert. Zwischen dem
Abt und 17 Hofbesitzern kam 1797 ein Aufteilungsvertrag zustande, der
dem Kloster 40 Jauchert zu freiem Eigentum überließ, während das übrige
den einzelnen Erblehenshöfen zugeteilt wurde. Die Regierung jedoch
verweigerte die Bestätigung des Vertrags, da die Abteilung der
Forstwirtschaft schädlich sei, auch für neu aufzunehmende Ortsbürger -
ein wichtiges Moment ! - nicht mehr gesorgt werden könne. Die
Interessenten aber ließen nicht locker, und im Jahre 1800 wurde die
erforderliche Genehmigung erteilt.
Auch die sickingischen Höfe besaßen eine Allmende. Sie lag in der
Gegend des Scherlenzendobels und Fußgrundes. Zeitpunkt und Umstände
ihrer Aufteilung müßten noch festgestellt werden.
Die frühere Klostervogtei Eschbach, sowie die ehemals sanktpetersche
Vogtei Rechtenbach, nunmehr dem Stabsamt St.Peter zugehörig, wurde 1811
mit der früher sickingischen Vogtei zu einer Gemeinde vereinigt, die
dem Landamt Freiburg unterstellt wurde. Damals kamen jedoch die ehemals
sickingischen Güter Schwabenhof und Berlachenhof nicht zur Gemeinde
Eschbach, sondern verblieben bei der Gemeinde Wiesneck. 1827 begannen
Verhandlungen wegen Aufhebung und Einteilung der Gemeinde Wiesneck und
Einverleibung der an Eschbach anstoßenden Höfe. Die Hofgrenzen von
Eschbach, Rechtenbach, Stegen und Wiesneck lagen in starker
Verzahnung durcheinander. 1837 wurde die Eingemeindung dreier
Wiesnecker Höfe, darunter des Sehwabenhofes und des Berlacherhofes nach
Eschbach verfügt und die Einsprache dieser Gemeinde abgewiesen. Mit dem
Austausch von Rechtenbach gegen den Reckenberg wurde das gegenwärtige
Gemeindegebiet im wesentlichen hergestellt.
1847 wurde von den Rechtenbachern der erste Antrag auf Abtrennung
gestellt, weil diese sich nicht an den Kosten für die Herstellung und
Unterhaltung der Straße durch das Eschbachtal beteiligen wollten.
1888 wurde anläßlich einer Ortsbereisung durch das Bezirksamt ein
Austausch von Gemarkungsteilen zwischen Eschbach und Stegen
vorgeschlagen. Der Gemeinderat willigte unter der Bedingung ein, daß
der Gemeinde Eschbach hierdurch keinerlei Nachteile erwachsen.
1890 erfolgte dann die endgültige Grenzänderung, der Plan hierfür wurde jedoch erst in den Jahren 1891 und 1892 hergestellt.
Eschbach gab an Stegen die 5 Rechtenbacher Höfe, nämlich den Rummishof,
Fußenthomashof, Gerbershof (jetzt Gasthaus Rößle), Similihof und
Thomashof mit dem damals dazugehörenden Berghäusle (jetzt oberer
Klingelehof) .
Eschbach erhielt von Stegen den Reckenberg, der bis dahin zu Stegen
gehörte. Das war das ganze Gelände zwischen der Landstraße und
Steurentäler Weg, einschließlich dem Berg am Reckenberg und Pfarracker.
Hierzu gehörten 6 Häuser, nämlich Unterwagners, das damalige Doppelhaus
am Reckenberg, Untermesners das anfangs des Jahrhundert abgerissene
Vogelhäusle und das damalige Doppelhaus am Bach, das im ersten
Weltkrieg durch einen Fliegerabsturz in Brand geriet und zerstört
wurde. Das letztere wurde dann getrennt rechts und links der Straße
aufgebaut. Ebenfalls erhielt Eschbach die zum Reichlehof gehörende
Moosmatte und den Nietenberg.
Eschbach hatte damit flächenmäßig einen schlechten Tausch gemacht, da
rd. 205 ha an Stegen abgegeben wurde, während nur 18,74 ha von 2 Stegen
an Eschbach kam. Das bedeutete nicht nur einen Einwohnerverlust, was
damals nicht viel ausgemacht hätte, sondern vor allem einen bedeutenden
Steuerausfall für die Gemeinde. Als Ausgleich für diesen Steuerausfall
mußte Stegen an Eschbach eine jährliche Entschädigung von 273 Mark
bezahlen. Nach langen zähen Verhandlungen löste Stegen diese
Entschädigungspflicht im Jahre 1907 gegen eine Abfindungssumme von 7000
Mark ab.
Der erste gemeinsame Vogt nach der Vereinigung der Eschbacher Vogteien
im Jahre l8ll war der Scherthomasbauer Thomas Steyert, der bis dahin
sickingischer Vogt war.
1814 - 1816 war der vom Kreuzhof in St.Peter stammende Pfisterbauer Josef Saum Vogt von Eschbach.
1819 - 1821 ist wieder Scherthomasbauer Thomas Steiert als Vogt zu
finden. Er machte die ersten Vorarbeiten für den ersten Schulhausbau in
Eschbach.
1821 wurde er wieder von Josef Saum, Pfisterbauer abgelöst. Während
seiner Amtszeit wurde im Jahre 1822 das Schulhaus am Bach erbaut. An
der Stelle, wo heute das Rathaus steht, wurde die Schulscheuer
errichtet. Im Dachzimmer des Schulhauses wurde die erste Gemeindestube
(Ratszimmer) eingerichtet, in der auch die Gemeindeschriften aufbewahrt
wurden.
Vogt Saum bat 1824 um seine Entlassung. In der Niederschrift über das
Ruggericht (Ortbesichtigung durch das Landamt) im Jahre 1824 steht:
"Der Vogt Saum ist ein rechtschaffener ehrlicher Mann, der guten Willen
aber wenig Kraft, weswegen ihm die gesuchte Entlassung gerne ertheilt
wird".
Von 1824 bis 1827 war Andreas Gremmelspacher, Hummelbauer Vogt von Eschbach;
1827 wurde er von Maierbauer Andreas Rombach abgelöst, der zuerst Vogt
und dann von 1832 bis 1834 Bürgermeister der Gemeinde war. Während bis
dahin der Bürgermeister , bzw. der Vogt allen Schriftverkehr selbst
erledigte, wurde beim Ruggericht im Jahre 1855 der Gemeinde empfohlen,
einen Ratschreiber einzustellen. Peterbauer Josef Ruh versah dann
diesen Dienst bis zu seiner Bestellung zum Bürgermeister im Jahre 1850.
Da um diese Zeit noch keine Archiv vorhanden war, mußten wichtige
Gemeindeschriften in der Sakristei aufbewahrt werden.
Von 1834 – 1840 war wieder der oben genannte Hummelbauer Andreas Gremmelspacher Bürgermeister.
Ihm folgte von 1840 - 1845 wieder sein Amtsvorgänger Andreas Rombach, Maierbauer.
Er wurde 1845 wieder von Hummelbauer Andreas Gremmelspacher abgelöst.
Ihm folgte 1849 Heinibauer Georg Salenbacher, der im April 1851 vom
Großherzoglichen Landamt in Freiburg des Amtes enthoben wurde. Zum
Amtmann, der ihn absetzte, habe er ungefähr gesagt: "Wenn ich auch des
Amtes enthoben werde, bin ich immer noch der Heinibauer, wenn aber Sie
(oder Du) des Amtes enthoben werden, sind sie gar nichts mehr".
Bammetbauer Josef Kirner wurde daraufhin "provisorisch " als
Bürgermeister eingesetzt. Als er im Juni desselben Jahres starb, mußte
Ratschreiber Josef Ruh, Peterbauer, den Dienst übernehmen. Als
daraufhin die Bürgermeisterwahl öffentlich bekanntgemacht wurde, ist
das amtliche Wahlplakat abgerissen worden. Auf Anordnung des
Großherzoglichen Landamtes mußte die Bürgerschaft versammelt und ihr
mitgeteilt werden, daß bei nochmaligem Abreißen des Wahlplakates
unverzüglich eine militärische Exekution zur Ermittlung und Bestrafung
der Täter in die Gemeinde entsendet werde. Im Dezember 1851 wurde dann
Johann Georg Gremmelspacher, Martinsbauer zum Bürgermeister gewählt,
der bis 1855 im Amt war.
1855 wurde Andreas Vogt Bürgermeister. Er wohnte im sogenannten
Posterhäusle (später Heinihansen) und war lange Jahre Acciser
(staatlicher Steuererheber).
1858 löste ihn Hummelbauer Andreas Gremmelspacher ab.
Von 1861 - 1866 war wieder Johann Georg Gremmelspacher im Amt, dem von 1866 bis 1871 wieder Andreas Vogt folgte.
1870 nahmen 9 Mann von Eschbach am Feldzug in Frankreich teil. Sie
erhielten beim Friedensfest am 18. Juni 1871 je 2 Gulden von der
Gemeinde.
1871 wurde Hummelbauer Johann Gremmelspacher als Bürgermeister gewählt.
Er war zuerst Bergbauernbetrieb in Unteribental. Nach seines Vaters Tod
im Jahre 1867 übernahm er den väterlichen Hummelhof. 1874 stellte er an
das Großherzogliche Bezirksamt den Antrag auf Entlassung. Er sei von
1845 bis 1849 und dann wieder von 1851 bis 1867 in Unteribental
Bürgermeister gewesen. 1871 sei er in Eschbach gewählt worden und habe
somit nahezu 24 Jahre Dienst getan. Er sei jetzt schwerhörig geworden
(oft gut für den Bürgermeister) und habe eine große Familie. Bei der
letzten Ortsbereisung durch das Bezirksamt sei ihm in Anwesenheit des
Gemeinderates der Vorwurf gemacht worden, daß er angezeigte Personen
nicht bestraft habe. Er könne deshalb nicht mehr länger den Dienst
bekleiden und bitte deshalb um Entlassung. Die Gemeindeversammlung hat
jedoch die Entlassung nicht genehmigt. Da er nicht gezwungen werden
konnte, länger im Amt zu bleiben, wurde Schmiedmeister Feser mit der
Besorgung der laufenden Dienstgeschäfte beauftragt.
1875 wurde Schmiedmeister Hermann Feser als Bürgermeister gewählt. Da
er die Wahl nicht annahm, mußte er an die Armenfondkasse eine Strafe
zahlen. Bei der darauffolgenden Wahl wurde Moosbauer Hermann Rombach
gewählt, der ebenfalls ablehnte und sich bereit erklärte, eher die
gesetzliche Strafe zu entrichten. Als junger Landwirt müsse er alle
Kräfte aufbieten, um sich durchzubringen. Scheinbar war in der
damaligen Zeit das Amt des Bürgermeisters nicht sehr begehrt, was bei
einem jährlichen Gehalt von 85 Gulden bis 1875 und 257 Mark von da an
nicht verwunderlich war. Nachdem Peterbauer Josef Ihringer einige Zeit
Amtsverweser war, wurde 1875 der bisherige Ratschreiber Georg Strecker,
Bergjörgenhof zum Bürgermeister gewählt. Ratschreiber wurde Friedrich
Hug, der diese 50 Jahre bis 1926 innehatte. Alte Grund- und
Standesbücher geben Zeugnis von seinem Können, seiner Genauigkeit und
Pflichtbewußtsein, das er bei kärglichem Gehalt so lange in den Dienst
der Gemeinde stellte.
In den Jahren 1874 und 1875 wurde die Landstraße nach St. Peter verlegt
und ausgebaut. Die Gemeinde mußte hierzu das erforderliche Gelände
stellen. 1875 wurde in der bisherigen Schulscheuer ein Ratszimmer
gebaut, das allerdings viel zu klein war. Ein Archiv war inzwischen im
alten Schulhaus eingerichtet worden.
1877 wurde wieder Johann Gremmelspacher, Hummelbauer zum Bürgermeister
gewählt. Er legte l879 das Amt in Folge "staatsbeamtlicher Fuchserei"
nieder (Kulturkampf). Hierauf wurde viermal vergeblich gewählt. Jeder
der Gewählten zahlte eher die 200 Mark Strafe, als daß er das Amt
annahm. Es waren dies Roman Gremmelspacher, Martinsbauer, Eduard
Rombach, Maierbauer und Johann Hummel, Scherpeterbauer. Der ebenfalls
gewählte Pfisterbauer Bernhard Steiert wurde mit Rücksicht auf seine
Entschuldigungsgründe nur um 120 Mark bestraft. Nun wurde amtlich
gedreht, man werde einen Unteroffizier setzen mit 1200 Mark jährlichem
Gehalt. Daraufhin nahm 1880 Schwabenbauer Anton Läufer die auf ihn
gefallene Wahl an. Er stammte von Prechtal und hatte 1875 den
Schwabenhof gekauft. Er ist der Ahnherr von 114 heute in Eschbach
wohnenden Einwohnern, das ist 1/7 der heutigen Bevölkerung.
Bei der Neuwahl im Jahre 1886 trat auch Ratschreiber Friedrich Hug als
Kandidat auf. Er kam jedoch nicht durch, weil er, wie berichtet wird,
"einen zu kleinen Viehstall hatte". Es wurde auch befürchtet, daß er
das Amt zu gewissenhaft verwalten würde.
Der Altbürgermeister Johann Gremmelspacher, Hummelbauer wurde 1886
wieder gewählt. 1888 stellte er im Hinblick auf sein Alter an das
Bezirksamt die Bitte um Entlassung.
1889 übernahm wieder Sehwabenbauer Anton Läufer das Amt, das er bis
1895 innehatte und sich dann mit Altersgebrechlichkeit und üblem Gehör
entschuldigte.
1895 wurde Johann Gremmelspacher, Hummelbauer, ein Sohn des 1890
verstorbenen Altbürgermeisters, gewählt; Er mußte im Mai 1901 das Amt
wegen Krankheit abgeben und starb im Juni desselben Jahr. In die
Amtszeit dieser beiden letztgenannten fiel der Austausch der
Rechtenbacher Höfe gegen den Reckenberg und Nietenberg.
1897 wurde für die Korrektur des Hintereschbach- und Steurentalweges 4940 Mark ausgegeben.
Im Juli 1901 wurde Pius Rombach, Löwenwirt zum Bürgermeister gewählt.
Er diente der Gemeinde 30 Jahre lang. In seiner Amtszeit wurde 1903 das
Schul- und Rathaus gebaut. 1910 kaufte die Gemeinde vom Scherlenzenhof
den Hinterwald und den hinteren Teil des Vorderwaldes mit einem
Wiesenanteil mit insgesamt 22,50 ha zum Preis von 20.500 Mark. Im Jahre
1927 wurde vom selben Hof der vordere Teil des heutigen Gemeindewaldes
mit Wiesenanteil mit insgesamt 6,20 ha für 6000 Mark gekauft. 1913
wurde die erste Wasserversorgung der Gemeinde gebaut. Sie war zuerst
nur als Schulbrunnen gedacht, doch nach und nach haben 15 Häuser
angeschlossen.
Der erste Weltkrieg forderte auch von der Gemeinde Eschbach seine
Blutopfer. 22 Söhne der Gemeinde mußten auf den Schlachtfeldern T?
das Leben lassen.
1931, in dieser politisch wirren Zeit, wurde Wilhelm Läufer, Peterbauer zum Bürgermeister gewählt.
Der zweite Weltkrieg und die damit verbundene Zwangsbewirtschaftung
stellte an die Gemeindeverwaltung schwierige Aufgaben. Bürgermeister
Läufer und sein Ratschreiber Josef Helmle, der 30 Jahre lang von 1926
bis 1956 im Dienst war, bemühten sich, ihre Aufgaben gerecht zu lösen.
28 Gefallene des zweiten Weltkrieges hat die Gemeinde zu beklagen. 13 Kriegsteilnehmer sind heute noch vermißt.
Von Fliegerschäden ist die Gemeinde zum Glück verschont geblieben. Die
Häuser waren von Ausgebombten überfüllt, die vor allem nach der
Bombardierung von Freiburg in das Tal kamen. Ein Teil der Bevölkerung
der Gemeinde Gündlingen, die 1944 vor dem französischen Artl. Feuer mit
dem Vieh und dem nötigsten Bedarf in Sicherheit brachte, war in der
Gemeinde einquartiert. Außer den sonstigen Einquartierungen war das
Schulhaus und Bürgersaal mit 16jährigen „Volkssturmmännern" belegt.
Der verstorbene Hochw. Herr Pfarrer Wiederkehr schreibfi über das
Kriegsende „Es brachte die kritischsten Stunden, Stunden sorgenvollen
Bangens und wirklich ernste Gefahr. Die erste und wohl größte kam durch
die seit ein paar Tagen aus dem Elsaß und der Ebene zurückfluten
eigenen Truppen. Übrigens ein Anblick zum Heulen, diese müd sich
hinschleppenden, lange auseinander gezogenen Kolonnen, diese das ganze
Tal hindurch weg-geworfene Unmenge von Kriegsmaterial - lange noch
haben die Kinder mit einem aus dem Bach gezogenen Flackgerät Karussell
gefahren! Diese Truppen sollten im letzten Augenblick das Tal bis zur
letzten Möglichkeit verteidigen.
Sonntag, 22.April war es, wie an der Investitur 10 Jahre zuvor, wieder
am Schutzfest des hl. Josef. Am Samstag hatten die Franzosen bereits in
Freiburg vorgefühlt, am Sonntag zogen sie ein. Bis Montag früh waren
sie im Tal zu erwarten. Die Pfarrei bereitete sich darauf vor, daß sie
sich im bezw. nach dem Amt nochmals dem hl. Josef weihte und seinem
besonderen Schutz empfahl. Nicht umsonst! Abends beim Eindämmern
rückten deutsche Truppen von St.Peter herab, um mit MG-Nestern auf den
Höhen das Tal zu sperren; eine Vorkehrung, die, militärisch gesehen,
umso notwendiger und selbstverständlicher war, als das Höllental
bereits durch Sprengungen gesperrt war und das Nachrücken der Franzosen
dadurch notwendig durch unser Tal über St.Peter und St.Märgen erfolgen
mußte. Spät abends kamen die deutschen Truppen; noch vor Ende des
Schutzfestes, nachts l/2 12 Uhr rief höherer Befehl sie zurück zu
überstürztem Rückzug nach Osten, zum Versuch, die durch Vorstoß zur
Schweizergrenze bereits geschlossene Sperre zu durchbrechen, bevor sie
zu dicht und zu stark war. Das Dorf war damit gerettet. Als die
Franzosen am andern Vormittag, zunächst noch vorsichtig mit Panzern
vorfühlend und abtastend, durch das Tal gen St.Peter fuhren, fiel kein
Schuß."
Einige Zeit hielten sich in den Wäldern beim Pfisterhäuslehof
Angehörige des "Werwolf" auf und bedrohten einige Einwohner der
Gemeinde. Sie hatten dort ein Verpflegungslager eingerichtet und als
dieses ausgehoben war, ist auch diese Partisanengruppe verschwunden. Da
das Höllental durch Sprengungen gesperrt war, flutete der ganze Verkehr
durch die Seitentäler und somit auch durch das Eschbach.
Das brachte laufende kleinere Plünderungen und Räubereien mit sich. Zum Glück sind jedoch keine Vergewaltigungen vorgekommen.
Im Juni 1946 trat der bisherige Bürgermeister Wilhelm Läufer zurück
Jakob Kult, Scherlebauer wurde daraufhin mit Zustimmung des
Gemeinderates eingesetzt und in der darauffolgenden Wahl von der
Gemeinde gewählt. Er hatte die letzten zwei Jahre der
Zwangsbewirtschaftung zu bewältigen. 1952 zwang ihn ein Leiden vom
Dienst zurückzutreten. 1953 wurde wieder Peterbauer Wilhelm Läufer
gewählt.
Im Sommer 1956 wurde er krank und starb im Oktober desselben Jahres.
Max Spitz, Landwirt, der bisher Stellvertreter war, übernahm nun den
Dienst. Im März 1957 wurde er auf 8 Jahre und im Januar 1965 auf
weitere 12 Jahre zum Bürgermeister gewählt.
Inzwischen sind die Gemeinden wieder finanziell besser bestellt, durch
den Finanzausgleich durch den Staat. Diese Mitbeteiligung am
allgemeinen Wohlstand ist auch der Gemeinde Eschbach zugute gekommen.
Allerdings galt es auch hier, die gegebenen Möglichten zu nutzen und
die vorhandenen Quellen richtig anzuzapfen.
1957 wurde der Schul- und öffentliche Abort gebaut.
In den folgenden Jahren wurden die Hintereschbachstraße und die
Steurentalstraße verbreitert und geteert. Hierzu gab es entsprechende
Staatszuschüsse und zinsverbilligte Darlehen, die jedoch heute getilgt
sind.
1958 hat die Gemeinde eine neue Kirchturmuhr angeschafft.
1959 wurde die obere Friedhofmauer, die zum Teil eingefallen war, neu
gebaut. Ein alter Wunsch aller Eschbacher, die Erstellung eines
würdigen Ehrenmales für unsere Gefallenen und Vermißten der beiden
Weltkriege wurde im Jahre 1960 verwirklicht. In der Mitte des
Friedenhofes fand diese schöne Gedenkstätte einen Platz.
In den darauf folgenden Jahren wurde die untere Friedhofsreihe
begradigt und die Grabdenkmale zum Teil etwas angehoben. Im oberen Teil
des Friedhofs wurde eine Terrassenmauer erstellt und damit diese oberen
bisher steilen Gräberreihen etwas ebener gestaltet. Am westlichen
Friedhofseingang wurde ein Gerätehaus gebaut und der Friedhof mit
jungen Birken bepflanzt.
1964 wurde auf dem vom Hummelhof gekauften Grundstück ein schönes Feuerwehrgerätehaus gebaut.
Im Scherlenzendobel ist zusammen mit den dortigen Waldbesitzern ein
Waldweg mit einem Kostenaufwand von rd 90 000 DM gebaut worden. Hierzu
gab der Staat einen Zuschuß aus Mitteln des "Grünen Planes", 1963
wurden im Hummelberg mehrere Quellen gefaßt und einem dort im Jahre
1964 erstellten Hochbehälter zugeleitet. Zugleich wurde durch das ganze
Tal vom Reckenberg bis zu den Neubauten beim Scherlenzenhof das
Wasserleitungsnetz verlegt, 1965 wurde auf dem Hugmichelhof eine
weitere gute Quelle gefaßt und dem Ortsnetz zugeleitet, 1966 wurde die
Wasserleitung in das Steurental verlegt. Die Gesamtkosten für den
Ausbau der Wasserversorgung kamen auf rd. 440.000 DM. Die
Wasserversorgung dürfte für die Gemeinde auf lange Zeit gesichert sein.
Um ein weiteres Bauen in der Gemeinde zu ermöglichen, wurde der Ausbau
der Ortskanalisation in Planung gegeben. Der erste Teilabschnitt wurde
in diesem Jahr im Zuge des Straßenausbaues im Untertal gebaut. Die
Gemeinde hat in diesem Jahr den Beitritt zum Abwasserverband
"Breisgauer Bucht" erklärt. Die Aufgabe dieses 46 Gemeinden und die
Stadt Freiburg umfassenden Verbandes ist es, das gesamte Abwasser aus
diesem Gebiet zu sammeln und in einer Großkläranlage zu klären und das
geklärte Abwasser dem Rhein zuzuleiten. Nachdem ein kleiner
Bebauungsplan beim Friedhof zur Zeit verwirklicht wird, wurde in diesem
Jahr ein Entwurf für einen Bebauungsplan für das Untertal und
Reckenberg aufgestellt. Bis er verwirklicht werden kann, wird noch
geraume Zeit vergehen.
Gemeindewappen
Die Gemeinde Eschbach besaß bis zum Jahre 1961 kein Wappen. Das
bisherige Dienstsiegel, das zwei Bäume (wohl Eschen) darstellte, wurde
schon im 19. Jahrhundert geführt. Im Jahre 1898 wurde der Gemeinde vom
Generallandesarchiv vorgeschlagen, das Wappen der Herren von Eschbach
anzunehmen, das ein Gabelkreuz zeigt. Die Gemeinde hat damals den
Vorschlag abgelehnt und damit recht getan. Es stellte sich nämlich
später heraus, daß es die Herren von Eschbach, Kreis Müllheim gab. Im
Jahre 1927 hatte die Gemeinde den Wunsch geäußert, ein redendes Wappen
(einen Bach zwischen zwei Eschen) zu erhalten. Warum ein weiterer
Entwurf, der der Tatsache, daß Eschbach eine ausgesprochene Talgemeinde
ist, heraldischen Ausdruck verleihen sollte, abgelehnt wurde, kann
nicht mehr festgestellt werden. Nachdem ein „eifriger Graveur“ diesen
zweiten Entwurf in die Bürgermeistermedaille eingraviert hatte, sollte
dieser Entwurf (zwei Eschen) als angenommenes Wappen gelten, obwohl es
nicht vom Staat verliehen worden ist, 1961 hat die Gemeinde an das
Innenministerium den Antrag auf Verleihung eines Wappens gestellt.
Daraufhin hat das Innenministerium von Baden-Württemberg mit Erlaß vom
23.1.1962 der Gemeinde Eschbach das Recht verliehen, eine Flagge in den
Farben "Grün-Weiß (Grün-Silber)" und ein wie folgt beschriebenes Wappen
zu führen:
In Silber (Weiß) auf grünem Dreiberg eine grüne Esche mit schwarzem Stamm, dahinter ein erniedrigter blauer Wellenbalken.
Dieses Wappen symbolisiert den Ortsnamen in einer für jeden Beschauer verständlichen Weise.
Freiwillige Feuerwehr
Die freiwillige Feuerwehr Eschbach wurde 1944 gegründet. Zwar gab es
zuvor eine Löschmannschaft, die jährlich eine oder zwei Proben hatte,
doch von einer Feuerwehr konnte noch nicht gesprochen werden. Bei
diesen Proben hatten alle wehrfähigen Männer zu erscheinen, um zu
erfahren, was sie im Brandfall zu tun hatten.
Wegen der steigenden Brandgefahr wurde 1943 durch das Landratsamt die
Gründung einer freiwilligen Feuerwehr angeregt. Eine Feuerspritze, die
allerdings nicht den Anforderungen entsprach, konnte angeschafft
werden. 1944 war es dann soweit, daß die Feuerwehr einsatzfähig war.
Kurz nach dem Kriege war die Wehr 29 Mann stark. Für die
Besatzungsmacht war das nicht erfreulich und so wurde verlangt, daß die
Wehr auf 9 Mann verkleinert wurde. Später wurde sie auf 20 Mann erhöht
und diesen Stand hat sie heute noch.
Erster Kommandant war Schmiedmeister Wilhelm Feser. Ihm folgte von 1948
bis 1962 Wagnermeister Karl Scherer, der heute Ehrenkommandant ist.
Seit 1962 ist Erich Hensler Feuerwehrkommandant.
Nach und nach wurde die Ausrüstung der Feuerwehr vervollständigt.
1961 wurde eine neue Tragekraftspritze und eine neues Feuerwehrfahrzeug
angeschafft. Die alte Feuerspritze war in der gemeindeeigenen
Spritzenremise in der Nähe des heutigen Feuerwehrhauses untergebracht.
Nachdem viele Jahre für das Feuerwehrfahrzeug eine
Unterstellmöglichkeit gemietet war, konnte 1964 in das beim Hummel
erstellte Feuerwehrhaus eingezogen werden.
Deutsches Rotes Kreuz
Seit 1953 besteht in der Gemeinde Eschbach eine Bereitschaftsgruppe des
Deutschen Roten Kreuzes, der z. Zt. ca 15 Helferinnen und Helfer
angehören. 1961 wurde ein Ortsverein des DRK gegründet. Vorsitzender
ist Pius Rombach, Mathislebauer, Bereitschaftsführer ist Christian
Riesterer.
Musikverein
Der Musikverein Eschbach wurde 1905 gegründet. Durch eine größere
Stiftung des damaligen Ortsgeistlichen und der Gemeinde, sowie durch
Beiträge der Bevölkerung konnten damals die Instrumente beschafft
werden. Seit 34 Jahren steht die heutige Musikkapelle unter Leitung des
Dirigenten Herrn Karl Schuler, Kirchzarten. Sie hat unter seiner
Stabsführung einen beachtlichen Leistungsstand erreicht. Seit 1947 ist
Bürgermeister Spitz 1.Vorsitzender.
V. Aus der Geschichte der Pfarrei Eschbach
Eschbach war bis zum Jahre 1789 keine selbständige Pfarrei. Es gehörte
pfarrlich mit Buchenbach, Falkensteig, Gürsperg, Himmelreich,
Lindenberg, Oberried, Wagensteig, Weiler und Zarten zu Kirchzarten. Von
dort aus wurde seit 700 die Seelsorge durch Mönche des Klosters
St.Gallen ausgeübt. Nachdem 1091 durch Berthold II. von Zähringen das
Kloster St.Peter gegründet war, kamen häufig von dort aus Patres ins
Eschbachtal und hielten Gottesdienst. Es gab deshalb
Auseinandersetzungen mit den Pfarrern von Kirchzarten. Diese
untersagten den Mönchen die Sakramentenspendung in Eschbach, konnte
aber nicht verhindern, daß sie dort predigten und die hl. Messe
feierten.
Eschbach besaß schon früh eine eigene Kapelle. Es ist nicht bekannt,
wann sie errichtet wurde. Abt Philipp Jakob Steyrer von St.Peter
(1749-1795) vermutet, daß sie von der Abtei errichtet wurde. Wohl ist
nachgewiesen, daß sie im Jahre 1585 durch Abt Gallus von St.Peter wegen
Baufälligkeit renoviert wurde. Damals erhielt sie ein Bild des Apostel
Jakobus des Älteren. Bischof Balthasar weihte die neuhergestellte
Kapelle am 28. August 1590 ein, und bezeichnete sie dabei als eine
Filialkirche von St.Peter. Sie besass Reliquien des Apostels, des
Märtyrers Pelagrus und der elftausend Jungfrauen. Die Konventualen der
Abtei predigten in der folgenden Zeit dort zweimal jährlich, und zwar
am Jakobus-Fest und am Jahrestag der Einweihung. Außerdem feierten sie
in der Eschbacher Kapelle zweimal wöchentlich die heilige Hesse. Am
Montag nach dem Bittsonntag zog die Bittprozession von St.Peter ins Tal
herab. Nach dem Dreißigjährigen Krieg mußte die Kapelle 1649 wiederum
ausgebessert werden.
Im Jahre 1758 wurde sie niedergerissen und durch einen Neubau ersetzt.
Der Abt Philipp Jakob beauftragte damit den Klosterarchitekten Johannes
Willam, der für seine Arbeiten Maurer aus Bregenz herübergeholt hatte.
Die Abtei stellte die nötigen Bretter, Ziegel und Bausteine, ohne dazu
verpflichtet zu sein. Außerdem schenkte sie eine Kirchenmatte von 48
ar, die seit 1800 zum Hummelhof gehört. Die Eschbacher halfen beim Bau
eifrig mit. Aus Dank für die großzügige Hilfe der Äbte versprachen sie,
jeden Sommer in der Kapelle eine hl. Messe für den Abt und den Konvent
feiern zu lassen. Prior P. Hildbrand weihte die Kapelle am 18. Juli
1758. Bischöflich konsekriert wurde sie am 30. April 1775 durch
Weihbischof von Hornstein.
Wiederholt hatte die Eschbacher Bevölkerung die Errichtung einer
eigenen Pfarrei bei der vorderösterreichischen Regierung erbeten. Sie
kaufte 1783 einen Bauplatz vom Engelwirt Lorenz Bank für 200 fl. Doch
die Regierung lehnte erneut den Wunsch nach einer eigenen Pfarrei ab.
Sehr bald schwenkte sie um und suchte nach einer entbehrlichen Kapelle,
die als Pfarrkirche verwendet werden könnte. Graf Heinrich Hermann von
Kageneck bot die Kapelle von Lindenberg an. Diese war erst 1761 von dem
Klosterbaumeister Willam und dem Freiburger Architekten Dominik
Hirschbühl an der Stelle der zu kleinen alten Lindenbergkapelle
errichtet worden. Damals hatte Freiherr Johann Friedrich von Kageneck
den Bau einer ziemlich großen und schönen Kirche mit einer angebauten
Mesnerwohnung angeordnet. Die Innenausstattung übernahm nach
Anweisungen des Abtes Philipp Jakob, der Maler Georg Saum. Die drei
Altäre und die Kanzel fertigte der Bildhauer Matthias Faller von
St.Peter an. Sie wurden von Wittmer aus Donaueschingen vergoldet und
marmoriert.
Begreiflicherweise war man in der Abtei St.Peter sehr bestürzt, als am
30. Dezember 1786 ein Regierungsdekret aus Wien eintraf, das den
Abbruch der Kapelle und den Neubau einer Pfarrkirche in Eschbach aus
den brauchbaren Materialien anordnete.
Nach längeren Zögern entschloß sich Philipp Jakob Steyrer den Abbruch
durchzuführen. Er hoffte, damit seine Abtei von der Aufhebung zu
retten. Die Regierung sicherte daraufhin dieser auch "ewigen Bestand"
zu.
Für die Pfarrkirche in Eschbach durften von der Lindenberg-Kapelle nur
die Altäre, Kirchenbänke, Beichtstühle und Baumaterialien verwendet
werden. Die Paramente, die heiligen Gefäße und die Kirchengerätschaften
erhielt die Depositionskommission in Freiburg. Die Liegenschaften
wurden zugunsten des Staates versteigert. Als Bauplatz wurde nicht der
von der Gemeinde Eschbach bereits erworbene Platz genommen. Eine
Regierungskommission, die aus dem Universitätsprofessor Will, aus Dekan
Binz von Kirchzarten und Generalbaumeister Zängerle bestand, wählte ein
anderes Gelände. Dort wurde im Frühjahr 1788 der Grundstein gelegt. Ihm
wurde eine Bleiplatte eingefügt, auf der der Name des Abtes von
St.Peter sowie die Namen der 24 Patres und zwei Brüder eingraviert sind.
Kirche und Pfarrhaus wurden vom Abt besser und geräumiger erbaut, als
es verlangt war. Man hielt sich an die Bauweise der Lindenbergkapelle,
die nur um ein Fenster im Schiff verlängert wurde. Simon Gösser
schmückte die Kirche mit fünfzehn größeren und kleineren Fresken aus
dem Leben der Gottesmutter. Alle Statuen stammen aus der Werkstatt von
Mathias Faller. Bei der großen Anlage des Pfarrhauses dachte der Abt
vermutlich an ein Ausweichquartier in Katastrophenzeiten.
Die Bewohner von Eschbach mußten harte Hand- und Zugfronden leisten.
Die Steine und Platten der Lindenberg-Kapelle hatten die Steinhauer und
Maurer vor dem Abtransport mit Nummern versehen, um sie leichter wieder
zusammensetzen zu können. Anderes Baumaterial wurde aus dem Steinbruch
der Gemeinde Pfaffenweiler geholt. Es sollen 8000 zweispännige Fuhren
nötig gewesen sein. Wegen dieser Dienste entstanden Streitigkeiten, die
bis zur Kaiserlichen Regierung nach Wien getragen wurden. Der Zwist
endete mit einem Vergleich. Die Abtei erstattete 540 fl. zurück und
stiftete 100 fl. zur Anlage eines Friedhofs. Am Tage vor der
Konsekration der neuen Pfarrkirche wurde das Gnadenbild vom Lindenberg,
das drei Jahre lang auf dem Hochaltar der Ursula-Kapelle in St.Peter
gestanden hatte, in feierlicher Prozession von den Eschbacher
Pfarrkindern abgeholt und von den Mitgliedern der Gemeinde St.Peter
begleitet. Beim Weggang wehrten sich die Frauen von Ibental gegen die
Übertragung nach Eschbach. Die Konsekration der Kirche nahm der
Weihbischof Wilhelm Josef von Baden am 9. September 1791 vor.
Am darauf folgenden Tage spendete er mehr als 700 Buben und Mädchen die Firmung.
Die Errichtung der selbständigen Pfarrei erfolgte durch Kaiserliche
Hofdekret vom 15. Oktober 1789. Zur neuen Pfarrei gehörten die Häuser
der Gemeinde Eschbach mit Ausnahme einiger auf dem Berg gelegener Höfe,
die Häuser vom Reckenhof einschließlich dem Taglöhner-Häusle gegen den
Rechtenberg bis hinab zum „Waldweber" gegen Attental. Erster Pfarrer
wurde der Konventuale P. Franz Steyrer, Neffe des Abtes Philipp Jakob.
Laut Urkunde von 1787 war für Eschbach auch eine Vikarstelle dotiert.
Sie fiel 1821 weg, als das Großherzogliche Ärar die Dotation übernahm.
Pfarrer P. Franz Steyrer wurde bekannt durch eine Schrift über die
Schwarzwälder Uhrenkunst. Er kam 1799 nach Pfaffenweiler und starb dort
1831.
Sein Nachfolger war gleichfalls ein Konventuale von St.Peter P. Othmar
Brogli (1799-1821). Er blieb auch nach Aufhebung der Abtei in Eschbach.
In seinen letzten fünf Lebensjahren hatte er einen Vikar namens Joseph
Erndle.
Es folgten die Pfarrer:
Xistus Armbruster (1822-1833), Martin (1833-1834), Dischler
(1834-1837). Von diesem wird überliefert, er sei dem katholischen Ritus
wenig hold gewesen. Pfarrverweser Ackermann (1837-1858), Felician
Engler (1838-1853), der äußerst tätig in der bürokratischen kirchlichen
Schreiberei gewesen sei.
Pfarrverweser Feldher (1854-1956), Pfarrverweser Anton Gäss
(1856-1859), Pfarrer Johann Blank (1859-1880), der sehr eifrig in der
Seelsorge und sehr nachläßig in den kirchlichen Schreibereien gewesen
sei.
Pfarrer Wilhelm Gustenhofer (1880-1908). Unter ihm wurde die Kirche
gründlich renoviert. Dabei wurden eine Reihe einschneidender
Veränderungen vorgenommen, vor allem an den Altären. Der sogenannte
Kreuzaltar, der im Chor stand, wurde ganz entfernt. Nachdem
vorübergehend in Stegen Gengenbacher Schwestern durch den Grafen
Kageneck unterhalten worden waren, holte Pfarrer Gustenhofer nach
anfänglichem Widerstreben Gengenbacher Schwestern nach Eschbach und
baute für sie und den Mesner ein eigenes Haus. Er schrieb die erste
Chronik über die Pfarrei Eschbach. Pfarrer Josef Mattes (1908-1935).
Während seiner Amtszeit feierte P. Hugo Salenbacher vom Heinihof 1933
seine Primiz. 1921 wurde eine kleinere Renovierung der Kirche
vorgenommen.
Pfarrer Arnold Wiederkehr (1935-1947). Wie schon Pfarrer Mattes war er
Beichtvater im Priesterseminar zu St.Peter. Er hatte ernste
Auseinandersetzungen mit den Nationalsozialisten und machte mit der
Gemeinde die schweren Kriegsjahre durch.
Aus Dank für die Bewahrung vor Fliegerschäden und größeren Plünderungen
versprach er mit der Gemeinde das Joseph-Fest besonders festlich zu
begehen. 1945 feierte er sein silbernes Priesterjubiläum.
Von (1947-1949), war Pfarrer Kieser Pfarrverweser, von (1949 1950), war
Pater Schoppman vom Missionsinstitut Stegen zur Aushilfe in der Pfarrei
Eschbach tätig. Pfarrer Wilhelm Gärtner (1950-1965). Unter seiner
Leitung erholte sich die Gemeinde von den Kriegsschrecken. Viele
besuchten Exerzitienkurse auf dem Lindenberg. Vergeblich bemühte sich
Pfarrer Gärtner immer wieder um eine gründliche Renovierung der
Pfarrkirche. Er konnte aber nur erreichen, daß sie außen instandgesetzt
wurde. Durch eine neue Kirchenordnung regelte er den würdigen Ablauf
des Gottesdienstes.
Seit April 1965 ist Dr. Helmut Meisner Pfarrverweser in Eschbach

Kirchplatz mit Schule und Rathaus 1966
VI. Schulgeschichte der Gemeinde Eschbach
1. Anfänge des Schulwesens überhaupt
Schule ist notwendig. Die Gesellschaft sucht mittels der Schule eine
Not zu wenden. Manchmal macht sie sie damit auch grösser. Jede
Gesellschaft schafft sich ihre Schule mit ihren Lehrern und ihren
Lehrplänen.
Solange diese Gesellschaft ständisch gegliedert ist, sind es die
einzelnen Glieder der Gesellschaft, die sich ihre Schulen einrichten,
gemäss ihrem je verschiedenen Bildungsideal. Im christlichen Abendland
ist es zunächst die Kirche, die sich über Dom- und Klosterschulen ihren
Nachwuchs an gebildeten Klerikern verschaffen will. Da sie aber im
allgemeinen ihre Tore vor niemandem verschliesst, und somit diese
Kloster- und Domschulen von jedem ernsthaft interessierten und begabten
Jungen besucht werden konnten, sind es gerade diese Schulen, die auf
den Bänken Knaben des verschiedensten Herkommens sitzen haben, und
somit von hier her langsam der Weg freigemacht wird für ein Phänomen,
das uns heute selbstverständlich dünkt, und das heute den Namen
Volksschule trägt. Jene Schule gab es natürlich zunächst in der Stadt;
so entstand in Freiburg Unterlinden durch das Aufblühen des
Dominikanerordens ein Mittelpunkt der Gelehrsamkeit, der durch den
Aufenthalt des Albertus Magnus zwischen 1237 und 1268 besonderen Glanz
erhielt.
Daneben gab es aber mehr handwerksmässig von Privatlehrern betriebene
deutsche Schulen, sogenannte "Winkelschulen", die ihre Dienste mit
Werbeschildern anpriesen, auf denen oft ein Lehrer zu sehen war, der
gerade mit der Rute einen Hosenboden bearbeitete. In diesen Schulen
liessen meist die Handwerker ihre Kinder gegen Entgelt in den
Anfangsgründen des Lesens und Schreibens unterrichten, welche
Fertigkeiten dann in den Zunftschulen ergänzt und auf die jeweiligen
Bedürfnisse abgestimmt wurden.
Ausserhalb der Städte waren es dann nur die Klosterorte, die in so
früher Zeit Schulen, zumeist natürlich Lateinsohulen, aufzuweisen
hatten. Interessant aber ist, dass im Ausstrahlungebereich dieser
Lateinschulen selbst auf dem Lande, ein von ihnen verschiedenes
Schulwesen sich langsam aufbaute. In unserer näheren Heimat zeigte sich
dies zuerst in St.Peter. Neben der Klosterschule wird schon im Jahre
1346 ein "Schulmeister von St.Peter" mit Namen Berchtold von
Reichenbach erwähnt. Derselbe besass ein halbes Bauerngut und konnte
deshalb also nicht Mitglied des Konvents gewesen sein. Noch 1483 wird
dieses "Schulmeisterlehen" erwähnt.
Fragen wir also, wo für die Bewohner unseres Tales zu so früher Zeit
die Möglichkeit bestand, ihre Kinder, falls überhaupt, in die Schule zu
schicken, so dürfte die Antwort hierauf St.Peter lauten.
Dort finden wir lange bevor Schulen in anderen Nachbarorten
eingerichtet wurden zwei solche, Eine Klosterschule, die z.B. im 18.
Jahrhundert im Durchschnitt von zwanzig Schülern besucht wurde und die
insbesonders dem eigenen Nachwuchs diente, aber auch den
Auswärtigen.(2) Daneben aber verfügte St.Peter schon ab 1340 über einen
Schulmeister, der die Kinder der Handwerker und Bauern unterrichtete.
Erst viel später tauchen im übrigen vorderösterreichischen Gebiet die
ersten Schulen auf, meist gegen Ende des l6.Jahrhunderts. In
Kirchzarten wird ein Schulmeister im Jahre 1629 erstmals und dann 1641
und 1659 erwähnt.(3)
Infolge der Nähe des herrschaftlichen Schlosses entsteht auch in Stegen
früher als in Eschbach eine Schule, 1699 bis 1714 befindet sich das
Schullokal im herrschaftlichen Schloss. Im Jahre 1714 aber kauft der
Zimmermann und "Spanmeister" Johann Janz aus "Birchen" einen Teil des
herrschaftlichen Gebäudes mit dem Wirtshausschild "Zur Krone" und
richtet die untere Stube zur “Trivialschule" für Stegen gegen Bezahlung
ein. Ab 1778 befindet sich dann das Schullokal von Weyler neben
dem gräflichen Schloss, an der Stelle, an der dann später, nach dem Bau
des neuen Schulhauses 1843, die ledigen Gräfinnen sich ein neues Haus
bauten. Dieses Haus wurde um 1900 der Witwensitz der manchen Bewohnern
unseres Tales noch bekannten Gräfin Frieda. Erst in jüngster Zeit wurde
dieses Haus aus dem Kageneckschen Besitz veräussert. Der langjährige
Stegener Lehrer jener Zeit aber, Johann Göhr, wohnte im Hause
unmittelbar neben dem Schullokal.
Unterrichtsfächer an diesen Schulen sind bis zu den Reformen Maria
Theresias in der Hauptsache Lesen, Schreiben und Katechismus. Rechnen
kommt vor 1700 überhaupt nicht, danach bis 1773 selten vor.
Auch scheint der Schulerfolg nicht immer glänzend gewesen zu sein. In
Mengen lernten 1699 von 36 Knaben nur 24 und von 34 Mädchen nur 4 das
Schreiben.(6) Beim Bau des ersten Eschbacher Schulhauses lagen von
manchem Handwerker noch keine geschriebenen Rechnungen vor, man
handelte mit ihm jeweils eine Pauschale aus. Die von der
Gemeindeverwaltung dann dem Handwerker vorgelegten Quittungen lassen
erkennen, dass dieselben oft nur mit Mühe mit dem Namen unterzeichnet
werden konnten. Noch im Jahre 1880 klagte ein Pfarrer; “Der Rechner des
Kirchenfonds.., konnte nur einzig seinen Namen schreiben, sonst
nichts."(7)
Wen will dies aber wundernehmen, wenn man bedenkt, dass in diesen
Schulen nur im Winter unterrichtet wurde, oft nur von Allerheiligen bis
Ostern, und der Schulbesuch, wie später noch zu ersehen sein wird, sehr
unregelmässig war.
Ein amtlicher Bericht von 1807 sagt uns das Übrige: "Vor Errichtung des
Normalschulwesens (1773) bestunden auf dem ganzen Schwarzwald mit
Inbegriff der noch dazugehörenden Täler keine fixierten Schulen oder
öffentlich angestellten Schullehrer, sondern einzelne Bauern, welche
mehr zu verstehen glaubten als die Gemeindegenossen, wanderten in den
Sommermonaten von Ort zu Ort und von Bauernhof zu Bauernhof, und
unterrichteten die Kinder in dem Wenigen, was sie selber wussten.
Lehrer Franz Josef Reber aus Kirchzarten berichtet, dass bis zum Jahre
1773 keine förmliche, unter öffentlicher Aufsicht stehende Schule
bestanden habe. Seine und seines Vaters Schule sei dagegen mehr eine
Privatspekulation gewesen und es sei der Willkür der Bauern überlassen
gewesen, ob er seine Kinder gegen Bezahlung zu dem einen oder dem
anderen Lehrer schicken wollte oder nicht. "Daher werden auch die
Schüler meistens abwechselnd in Privathäusern und nach Willkür von
Leuten gehalten, welche sich den Lohn selbst mit den Eltern der
Schulkinder zu bedingen pflegten.”(9)
Einzige Ausnahme in diesen allgemeinen Zuständen in unserer
vorderösterreichischen Heimat war wieder St.Peter. In diesem Ort, der
wie bereits erwähnt, schon 1346 einen Schulmeister besass, rückte man
schon 1754 von der Tradition ab, in irgend einem Privathaus ein
Schullokal einzurichten und baute 1754 "auf kräftiges Zusprechen" des
Abtes Steyrer ein zweistöckiges Schulhaus, um "die so copiose Jugend"
zu unterrichten. Der Abt stiftete zu diesem "so heilsamen Werk" das
Bauholz und stellte den Bauplatz zur Verfügung. Das Schulhaus selbst
wurde von den Vogteien St.Peters gebaut, zu welchen auch Eschbach
gehörte. Mindestens die Kinder der oberen Höfe Eschbachs werden dieses
Schulhaus besucht haben. Wie der Schulbetrieb finanziert wurde,
erfahren wir aus einem Brief von Pater Willam Reiche: Hochzeiter
mussten 2 fl. entrichten, Taglöhner 1 fl., Wirte bei
Tanzveranstaltungen 40 Kreuzer.
Zusammen mit dem Amtmann hielt der Abt gelegentlich Schulinspektion und
verteilte an die fleissigen Kinder Geschenke. Die Schulordnung der
Schule St.Peter aber diente in den siebziger Jahren anderen Schulen als
Vorbild (10)
Mit dem Jahre 1770 begannen dann in den ganzen vorderösterreichischen
Landen energische Reformbestrebungen auf dem Gebiet des Schulwesens.
Die staatliche Verwaltung übernahm durch Verfügung Maria Theresias das
gesamte Schulwesen, das sehr bald danach für einige Zeit als musterhaft
von allen süddeutschen, katholischen Regierungen angesehen wurde.
Als wichtigste Reform wurde 1773 in Freiburg die Normalschule für die
vorderösterreichischen Länder eingeführt. Sie fand ihren Platz in der
bisherigen städtischen Schule Ecke Herrenstrasse - Engelstrasse. In ihr
sollten die künftigen Lehrer ausgebildet werden. Auch im Dienst bereits
tätige Lehrer sollten dort Kurse besuchen und die "neue Lehrmethode"
erlernen. Die Kosten dafür mussten die Gemeinden tragen. Gemäss der
neuen Methode trat an die Stelle der bisherigen Einzelunterweisung, wo
der Lehrer von Schüler zu Schüler ging, der Klassenunterricht. Lesen,
Schreiben und Rechnen wurden als selbständige Fächer vom
Religionsunterricht getrennt, den nunmehr der Pfarrer oder Vikar zu
geben hatte. Die Lehrmittel, Bücher und Wandtafeln wurden einheitlich
in Wien hergestellt und für den Breisgau durch Buchhändler Anton Wagner
in Freiburg vertrieben.
Gleichzeitig zeigten sich in jener Zeit deutliche Tendenzen
Mittelpunktschulen einzurichten. Um Kirchzarten wollte man 1773 alle
kleineren Nebenschulen eingehen lassen. So wurden der Schule
Kirchzarten zugeteilt: Geroldstal, Schlempenfeld, Dietenbach, Neuhauser
und Höfen. Die Aufwendungen für die neue Mittelpunktschule sollten dann
aus einer gemeinsamen Kasse getragen werden.
2. Anfänge des Schulunterrichts im Dorf in schwerer Zeit .
Dies ist nun die Zeit, in der uns das Bild eines Mannes auftaucht; der
für viele Jahrzehnte der erste offizielle Lehrer der Gemeinde Eschbach
sein wird: Michael Winkler .
1747 wird er als Sohn eines Taglöhners in Blasiwald geboren. In seinen
ersten Jugendjahren arbeitet auch er wie alle seine Altersgenossen bei
heimatlichen Dienstherren. Doch Winkler findet keine volle Befriedigung
hierbei. Zwanzig Jahre alt entfernt er sich aus Blasiwald und wird
Holzhauer im Höllental. Nebenher vervollkommnet er seine Fertigkeiten
im Schreiben, Lesen und Rechnen und, gut bewandert in den "Trivialien",
nennt er sich ab 1769 "Schulmeister" in Falkensteig.
Viel tat sich in jenem Jahr in der "Hölle". Auf landesherrlichen Befehl
wurde die Fernverbindung Innsbruck - Freiburg durch dieses Tal gebaut.
Wie alle Bewohner des Tales stand Lehrer Winkler dann an jenen
prächtigen Maimorgen des Jahres 1770 an der neugerichteten Strasse zum
befohlenen Spalier. Geschwindreiter und Kanonenschüsse verkünden den
Vortrupp von 450 Pferden. Und dann kommen die 21 Prachtwagen, jeder von
6 rassigen Pferden gezogen. Im schönsten sitzt die Kaisertochter Maria
Antoinette. Diese stolzen Kavaliere und eleganten Reiter! Lehrer,
Schulkinder, alle Bewohner des Tales sinken in die Knie.
1771 versucht Winkler, wie auch heute noch alle Lehrer, näher an
Freiburg zu kommen. Neuhauser braucht einen Schulmeister, Winkler nimmt
an und wirkt dort bis 1774. Die Regierung aber plant seit dem Vorjahr
sämtliche kleinen Nebenschulen eingehen zu lassen. Winkler wird der
Boden zu heiss, auch sind ihm 25 Schulkinder zu wenig, und er weicht
nach Buchenbach aus. Dort ist eher die umgekehrte Tendenz. Die
Gemeindevorsteher Buchenbachs versuchen immer wieder pfarrlich von
Kirchzarten loszukommen. Doch erst 1796 gelingt ihnen dies. Fünf Jahre
lang bis 1779 bleibt Winkler in Buchenbach.
Im selben Jahr ergibt sich für ihn die Gelegenheit im Eschbachtale ein
Haus aufzukaufen, das Häusle vom "Behnhof", später "Schnieders"
genannt, abgerissen 1967. Dort errichtet Winkler 1779 sein Schullokal,
und damit beginnt ein geregelter Schulunterricht im Tal.
Behenhäusle vor dem Abbruch 1966
Vögte und Untertane müssen mit ihm zufrieden gewesen sein, denn 1780
schicken die Gemeindevorsteher, der Vogt der Klosterherrschaft und der
siggingische, (der kagenecksche verlangt den Schulbesuch für die
kageneckschen Untertanen in Weyler) Winkler auf ihre Kosten nach
Freiburg auf die Normal-Schule. Nach seiner Rückkehr wird er als
Schulmeister von Eschbach offiziell bestätigt.
Es tut sich manches im folgenden Jahrzehnt im Eschbachtal. Nach der
eigenen Schule wollten die Talbewohner nun auch eine eigene Pfarrei
haben. Die Bestrebungen Joseph II, die praktische Seelsorgtätigkeit zu
intensivieren, kommen dem Wunsch der Bevölkerung entgegen. Obwohl die
St. Jakobus Kapelle erst 1758 gebaut (heute Haus Gimbel) und 1775
konsekriert wurde, bezeichnen die Gemeindevorsteher, (diesmal auch der
kagenecksche Vogt) schon 1783 dem Kloster St.Peter einen Bauplatz für
den Bau einer Pfarrkirche auf dem Gelände des Engelwirts Lorenz Bank.
Am 30.12.1786 bestimmt ein Dekret aus Wien den Abbruch der
Lindenberg-Kapelle, die erst vor 25 Jahren von Abt Steyrer erbaut
worden war.
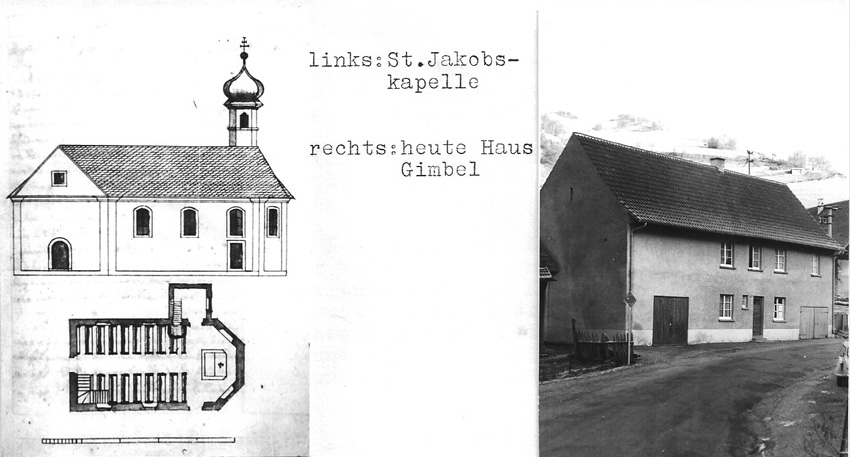
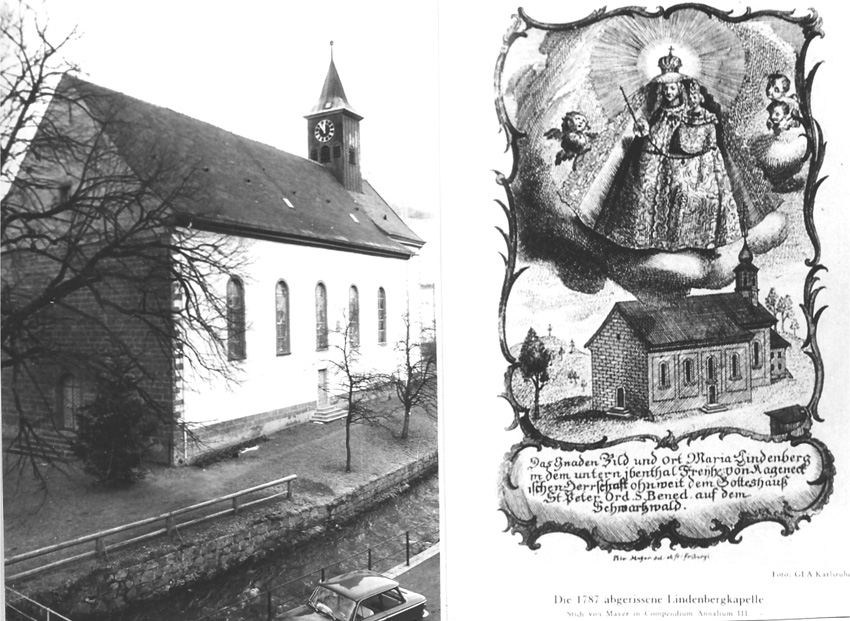
Schon Anfang Juni des folgenden Jahres fuhren die Wagen mit
Abbruchmaterial vom Lindenberg ins Tal. Das übrige Baumaterial wurde
von unten herangebracht, insgesamt 8000 Fuhren. Drei Jahre lang waren
Lehrer und Schüler Zeugen des Kirchenbaues. 1790 sind auch die
Deckengemälde fertig, nachdem schon 1789 durch "Kaiserliches Hofdekret
vom 15.10." die Pfarrei Eschbach errichtet worden war.
Damit erfolgte auch die Loslösung von Kirchzarten. Noch wenige Wochen
zuvor hatte der Kirchzartner Kaplan Hay sich bei der Regierung in
Freiburg über das Kloster St.Peter beschwert “...Es hielt in unserer,
der Pfarrei Kirchzarten zugehörenden Filialkirche Eschbach den 29.Juli
(l789) das Fest der Kirchweihe mit Predigt und hl. Hesse“. Eschbach im
Spannungsfeld zwischen St.Peter und den Dreisamtalgemeinden damals wie
heute!
Inzwischen stritten die Eschbacher mit dem Kloster, das den gesamten
Kirchenbau getragen hatte, auch um Rückvergütung der von ihnen
geleisteten Frohndfuhren. Das Kloster gab schliesslich dafür 540 fl.
und 100 fl. für die Anlage des Friedhofs, da bisher die Toten in
Kirchzarten beerdigt werden mussten. Der Vergleich wurde geschlossen am
26.12.1789. Es unterzeichneten neben dem Kloster und dem Oberamtmann
Mercy die Vögte der Vogteien St.Peter - Eschbach (Hug Michel), der Vogt
des sickingischen Eschbach, der Vogt von Stegen und der Vogt der Vogtei
St.Peter - Rechtenbach. Doch am 9.10.1791 weihte Joseph Leopold
Freiherr von Baden die Pfarrkirche ein und spendete tags darauf 70
Personen die hl. Firmung. Winkler ist an diesem grossen Tag natürlich
mit dabei, und vielleicht erinnerte sich an ihn auch sein damals
dreijähriger Sohn Matthias, der spätere zweite Lehrer von Eschbach.
Schule und Pfarrkirche bestanden, eine einheitliche Gemeindeverwaltung
allerdings fehlte noch. Bei obengenanntem Vergleich mit dem Kloster
unterschrieben noch vier verschiedene Vogteien.
Für die folgenden fünf Jahre wurde es kaum ruhiger im Tal. Das Gerede
von der Aufhebung des Klosters St.Peters durch die Regierung in Wien
flaute zwar ab. Dafür wurde Kriegslärm laut, erneut brachen
Feindseligkeiten mit Frankreich auf. In den Breisgau kam das auf
österreichischer Seite kämpfende Emigranten Corps der Armée de Condé.
Schon im Mai 1792 beschlagnahmten kaiserliche Kommissare im Kloster
St.Peter die ganzen äusseren Gebäude, Platz für 250 Mann. Lazarett soll
es werden. Am 17.0ktober sah Winkler 50 verwundete österreichische
Soldaten auf Leiterwagen an seinem Haus vorbeifahren, kein erfreulicher
Anblick.
Der Abt schickte einen Teil seiner Conventualen in das Pfarrhaus nach
Eschbach. Er hatte dieses Pfarrhaus für Katastrophenfälle so gross
bauen lassen, und schon 2 Jahre nach seiner Erbauung sollte es seinen
Zweck erfüllen müssen.
1795 stirbt Abt Philipp Jakob Steyrer, der Erbauer unserer Pfarrkirche
und Pater Ignaz Speckle wird zu seinem Nachfolger gewählt.
Gleich nach seiner Wahl vom 23.November, nämlich schon am 15.Dezember,
besuchte er die Schule St.Peter, um damit zu zeigen, dass es ihm ernst
sei das Schulwesen in allen Vogteien zu fördern. Pater Prior und Pater
Peter bestellte er zur Schulvisitation, die Wöchentlich zweimal
stattfinden sollte. Die Woche darauf, 22.12., ist Schulvisitation in
Eschbach: "Der Schulmeister (Winkler) ist ein wackerer, tauglicher
Mann. Die Kinder sind munter und gelehrig, werden aber sehr schlecht
zur Schule geschickt, weswegen den nachlässigen Eltern fürs erste Mal
zwar nur eine geringe Strafe angesetzt wurde und diese sogleich
eingezogen und dem Schulinspektor übergeben worden.“ Dieser zeitlich
früheste Bericht über eine Schulvisitation in Eschbach stellt Schülern
und Lehrer ein gutes Zeugnis aus, zeigt uns aber auch, dass es in jener
Zeit mit dem Interesse der Eltern an der Schule gehapert haben muss,
ein Zustand der leider noch viele Jahrzehnte bis ins 20. Jahrhundert
hinein anhalten sollte, wie später exakte Zahlen noch beweisen sollen.
Das Kloster aber, so viel wird auch deutlich, betrachtete die Schule
Eschbach nicht als Privat- oder Winkelschule, sondern als seine eigene
und förderte sie nach Kräften.
Mitte des folgenden Januars (1796) ist der Abt schon wieder auf
Visitation in St.Ulrich, Sölden, Zähringen und Eschbach. So bezeugte
er, dass es ihm sehr ernst mit den Schulen sei, und er gab dem Amtmann
die Weisung, die Nachlässigkeiten zum Besten der Schule zu strafen. "In
Eschbach ging die Sache seit meinem ersten Besuch besser, doch betrieb
ich die Sache auch bei dem siggingschen Vormund, Herrn von Hornstein".
Doch sind es in diesem Jahre leider die Kriegsereignisse, die in den
Vordergrund treten und ihre Aufmerksamkeit von allen erheischen. Am 24.
Juli rücken die Franzosen, von Kehl kommend, in den Breisgau ein. Der
Landsturm soll aufgeboten werden. Die Vögte baten den Abt um
Unterstützung. Zuerst sprach der Abt in Eschbach. "Ich tats mit
einigem, nicht grossem Erfolg... Ich sprach ihnen zu mit der
Versicherung, dass sie in wenigen Tagen wieder würden entlassen werden,
welches ihnen das angenehmste war".
Aber am frühen Morgen des 14. Juli überschritten die Franzosen auch bei
Breisach den Rhein. Überall bange Erwartung. Im ganzen Land beginnt das
Auswandern. Viele verlassen Freiburg. Als die Franzosen in die Stadt
kommen, rufen die Freiburger: Vive la nation, la republic!, ohne dass
mans verlangt hätte."
Am 18. Juli ist Abt Ignaz in Eschbach und versammelt die Eschbacher im
Pfarrhaus. Der Hof ist gesteckt voll. "Ich ermahnte alle bei ihren
Häusern zu bleiben .... machte ihnen Vorschläge, tröstete sie, so gut
ich konnte und kündigte ihnen an, dass heute vermutlich Truppen kommen
würden.“
Doch sie kamen schon abends. Mehrere Kompanien werden ins Eschbach
verlegt, "gerade der Vortrab, der nicht am besten diszipliniert ist."
Das Brot der Bauern ist den Franzosen zu schlecht, im Pfarrhof vermuten
sie besseres. Dieser wird vollständig ausgeplündert. Einige hundert
Liter Wein im Keller tun das übrige. Möbel und Einrichtungsgegenstände
werden zerschlagen, Bücher und Akten zerstreut. Bald singt und tanzt
alles. Von den Bauern holt man Schweine und Rinder.
Zwei Tage danach muss Abt Ignaz schreiben: "Über alle Vorstellungen
traurig ist der Anblick des ausgezehrten Tales, besonders in Eschbach.
Die Bauern essen nun mit den Soldaten. Sie alle sind rein ausgezehret.“
Als die erste Welle vorüber, am 3. August, versammelt sich in Eschbach
die Gemeinde, um den durch die Franzosen erlittenen Schaden zu
berechnen und dafür Entschädigung zu fordern, möglichst vom Kloster.
“Sie äussern hin und wieder, nur um das Kloster zu schonen, wären die
Soldaten ins Tal gelegt worden; sie machen Vorwürfe gegen mich, dass
ich ihnen geraten hatte bei ihren Gütern und Häusern zu bleiben, es
wäre besser gewesen, wenn sie davon geflohen wären." Der Abt klagt
weiter: Der Schaden "ist bei keinem einzelnen so gross, als nur beim
Pfarrer, der von
seiner Pfarrei gar nichts besitzet, und ganz und gar nebst der Kirche vom Kloster muss erhalten werden."
Der Abt macht z.T. die Franzosen verantwortlich für solche Uneinigkeit:
"Der Gemeinsinn verschwindet nun ganz, alle Stände sind getrennt von
einander, nicht einig unter sich. "Entweder suchen die Franzosen selbst
die Trennung, oder die Landeseinwohner sind blind zu glauben, in der
Trennung mehr Glück als in der Einigkeit zu finden...Jeder denkt auf
sich allein... Dies ist vermutlich die Absicht unserer Sieger..."
Auch im übrigen hält der Abt nicht viel von den Siegern. "Die Herren
Franzosen verlangen alles, nur wollen sie es nicht geradezu rauben,
wollen das Anschein haben, als respektierten sie das
Eigentum...requirieren zuerst alles Nötige für die Armee und Einzelne.
Man muss Offiziere und alle Soldaten kleiden, man muss Pferde und
Wagengeräte anschaffen, die Spitäler mit Medizin und Möbeln furieren,
Soldaten und Offiziere verpflegen, alle möglichen Hand- und Fuhrfronen
prästieren. Die Offiziere fordern Brandschatzungen, der gemeine Soldat
erpresst oder raubt. Dann kommen die Kommissare, fordern zuerst ihre
Reisekosten, ihre Verkostung und Bedienung wie die Offiziere, leben
dabei splendid. Alle versprechen Gutes, menschenfreundliche, edle
Behandlung, Schonung des Eigentums und der Personen. Sobald ihre
Geschäfte anfangen, fängt auch das Requirieren an, ungeheuere
Geldsummen als Auslösung der in Beschlag genommenen Gefälle. Sind diese
ausgelöset, so beziehen sie erst noch die Gefälle; und wenn es ihnen
gelang, die Gefälle noch zu beziehen, so folgt das Evakuationsgeschäft.
Man denkt nicht mehr an das Versprechen der Nation, Eigentum und
Personen zu schonen. Man spricht immer nur von den Rechten des Siegers,
ohne einen bestimmten Begriff von diesen Rechten zu geben oder zu
haben. Als ob ein Sieger je das Recht haben könnte, gegen unbewaffnete,
friedliche Bewohner eines Landes, welche dem Sieger gutwillig gehorchen
und alles Mögliche leisten, feindselig zu verfahren .... Es wird auch
bei uns wahr werden, das von der Pfalz gesagt war: Augen zum Weinen
wird man uns endlich noch lassen, wenn nicht der Herr uns Rettung
schickt."
Im Oktober 96 ist die französische Armee unter Moreau wieder auf dem
Rückzug durch das Höllental mit 4000 Mann. Den Hauptzug decken zwei
Flankierungstruppen, deren eine über Hohlen Graben, St.Märgen, St.Peter
zieht, der südliche über Alpiersbaeh - Zastler. So wird auch unser Tal
Kriegsschauplatz. Die Nordflanke der Truppen der Franzosen wird damals
durch das Condésche Corps, (französische Emigranten) attackiert.
Abt Speckle berichtet über Plünderungen, Räubereien und Misshandlungen
von Menschen , Vieh und Häusern, sowie der Schändung der Kirche in
Eschbach. Dreimal wechselt das Herrschaftsgebiet von St. Peter seinen
Besitzer. Vierzehn Tage behält die französische Nachhut Quartier. Ein
Bild der Verwüstung zeigen alle Höfe von Waldau bis Eschbach.
Ein abziehender französischer Offizier warnt die Waldauer, Heu und
Stroh aus dem zurückbleibenden Militärlager zu entnehmen, sie würden
sich Viehseuchen zuziehen. Die Waldauer tun es doch. Jedenfalls bricht
10 Tage nach dem Abzug der Franzosen eine schlimme Viehseuche aus.
Überall fällt Vieh, die Leute kommen oft nicht einmal dazu, die
Gefallenen abzuhäuten. Auf dem Schnerzenhof sind es 43 Stück. Auch aus
Eschbach werden Leute aufgeboten, um dort das Vieh zu verlochern,
insgesamt 30 Mann. Der Abt schlägt den Bauern vor, für jedes gesund
erhaltene Stück Vieh 12 Kreuzer zu opfern, um es an jene zu verteilen,
die am grössten Schaden erlitten. Allein :"Die Bauern erkennen zwar
wohl, wie notwendig ihnen Gottes Hilfe sei, wollten die aber immer nur
durch etwas suchen, das keine Überwindung kostet, nur durch Beten, nur
durch andere gute Werke."
Die Wallfahrt auf den Lindenberg lebt wieder auf. Die Kirche dort ist
zwar abgebrochen und samt Marienbild nach Eschbach verbracht worden,
doch das Volk hält sein Zutrauen an den Ort. "In Menge fahren sie dahin
und verrichten ihr Gebet bei den Ruinen und behaupten, der Ort wäre ein
Gnadenort." Das Volk will wieder eine Kapelle dort haben. Tag für Tag
sind Betstunden und Bittgänge zur Abwendung der Viehseuche. Noch nie
versammelten sich dazu so viele wie jetzt. "Gut dabei ist, dass
jedermann die Abhängigkeit von Gott .... einsehen lernet; aber nicht
gut, dass das Volk rechnet, durch Beten allein könne Gott gleichsam
gezwungen werden."
Gegen Ende des Jahres klingt die Seuche langsam ab. Die Franzosen
besetzen nur noch die Schanzen von Kehl und einen Brückenkopf bei
Hüningen. Es ist ruhiger geworden im Lande. Am 24. Januar 1797 besucht
der Abt wieder die Schule in Eschbach und verteilt dort Geschenke, und
zu Fasnacht wird der Schulmeister Winkler ins Kloster eingeladen zu
einer "mässigen" Tafel. "Man gab Würste, Rindfleisch, Gemüse mit
Fleisch, eingemachtes Fleisch, Pastete, einen Hasen, Braten mit
Kompott, Salat und Torte, Küchle und Apfel. Man spiess in der
Grosskellerei."
Am 20. April treffen der Abt und Winkler wieder zusammen. Der Abt läuft
zu Fuss mit Herrn Oberamtmann Mercy nach Eschbach, Schulvisitation zu
halten. Hierbei teilt er einige Geschenke aus und bestraft wieder die
Saumigen. Wie viele Kinder damals den Unterricht nicht besuchten,
wissen wir nicht, doch erwähnte der Abt anlässlich eines Schulbesuches
in St.Peter - und er scheint damit ziemlich zufrieden gewesen zu sein,
- dass von 170 Kindern ungefähr 130 täglich zur Schule kämen, das sind
doch ca. 75%. So hoch scheint der Prozentsatz in Eschbach nicht gewesen
zu sein.
Wie bescheiden jedoch der Schulerfolg auch in St.Peter war, - nicht
gerade ein Wunder, wenn man bedenkt, dass alle 170 Schüler von einem
einzigen Schulmeister betreut werden - , zeigt folgender Satz: "Unter
diesen (160 - 180) Kindern sind 10 Knaben und 6 Mädchen, die ziemlich
gut schreiben. Viele lesen hinreichend und einige haben auch die
Anfangsgründe vom Rechnen.“
Zum Patrozinium des Jahres 1797 (25.Juli) kommt der Abt, sonst ein
guter Reiter, wieder zu Fuss ins Tal, hält die Prozession und die
Pfarrmesse, Schulvisitator, Pater Petrus predigt. Nach dem Mittagessen
im Pfarrhaus bei dem Conventualen Pater Franz Steyrer, dem Neffen des
grossen Abtes Phil. Jakob Steyrer, besucht Abt Ignaz die alte Kapelle
(jetzt Haus Gimbel) und verordnet, dass drei Statuen aus derselben,
Gallus, Ulrich und Wendelin, weggenommen und in der neuen Kirche
aufgestellt werden sollen.
Für seinen Conventualen, P. Franz, Pfarrer von Eschbach muss sich der
Abt übrigens einige Zeit danach einsetzen. Am Stephanstag 1798
erscheint nämlich die Gräfin Kageneck und beklagt sich über P. Franz,
weil er so undeutlich predige und katechisiere. Die Gräfin hätte ihnen
selbst in der Schule zugehöret, " hätte auch geistliche und weltliche
Zeugen dazugenommen und diese hätten geäussert, dass er nicht gut
katechisiere, er schwätze so viel, erkläre immer und frage nicht, die
Kinder lernen nichts." Der Abt meinte allerdings, es sei die Klage nur
eine„ Racheaktion der Eschbacher Bauern, weil P. Franz zu streng auf
den Schul- und Gottesdienstbesuch halte.
Jedenfalls zeigt uns diese Notiz, wieviele Freiheiten sich die Menschen
jener Zeit herausnehmen konnten, wie mir scheint mehr als wir heutigen
Demokraten, die wir so stolz auf unsere auf dem Papier stehenden
Freiheiten sind und gerne mitleidig vergangene Zeiten belächeln. Man
besuchte einfach den Schulunterricht von Pfarrer und Lehrer, wenn man
sich ein Urteil bilden wollte. Keine weltliche Macht konnte damals
auch, wie in unserem Jahrhundert geschehen, einfach alle Männer zu den
Soldaten stecken, um mit ihnen ganz Europa mit Krieg zu überziehen.
Solches war erst möglich nach der französischen Revolution. Die
Abgaben, die jeder zu entrichten hatte, und die mit dem Namen “Zehnten"
umschrieben waren, handelte man zu jener Zeit mit dem Kloster selbst
aus. Jeder gab, was er selbst als den Zehnten ansah. Meist war der
Zehnte nur ein Zwanzigstel. Der Steingruberbauer wollte von 260
Zentnern nur 6 Zentner an das Kloster abgeben, wollte selbst gar nur 5
Zentner abgeben, lieber liess er sich drei Tage in den Turn sperren.
Wir aber zahlen heute dem Staat nicht ein Zwanzigstel, sondern ein
Fünftel und darüber. Ob die Freiheiten der Menschen nicht von Jahrzehnt
zu Jahrzehnt mehr beschnitten werden?
Am 25.April 1800 überschreiten die Franzosen erneut den Rhein. Tags
darauf stehen sie schon in Ebnet. Die Monate zuvor lagen seit Februar
Truppen im Tal. So kommen am 10. Februar Walachen (Rumänen) nach
Eschbach und bleiben dort Abzug bis zu ihrem Abzug nach Ostern. Danach
erscheint eine Kompanie Wallis, die aber bald vor den anrückenden
Franzos abzieht.
Der Pfarrer von Eschbach, noch voller schlechter Erfahrungen, beschloss
diesmal sich mit Wissen der Vögte im Dorf zu verstecken. Am 3. Mai
rücken die Franzosen dann ein, und neue Leiden kommen über den
Breisgau. Überall wird geplündert und Geld erpresst.
Anfang Juni sind die Franzosen wieder auf dem Rückzug. Eschbach bekommt
Einquartierung der Kaiserlichen, 90 Mann und ca. 40 Pferde. "Man ist im
Breisgau in einer fatalen Lage, alles ist voller Furcht;...heute unter
dem Schutz der kaiserlichen Kommandos, morgen den Einfällen der
Franzosen blossgestellt. Diese kamen auch wieder und rückten am 30.Juli
1800 wieder in Freiburg ein, und hinter ihnen folgte eine Menge nach.
"Es scheint, dass der Franzose alles, was hungerte und dürstete,
herüberschickt, um alles hier speisen zu lassen. Kranke, Blessierte,
kranke Pferde, Weiber und Kinder, alles kommt, um auf Kosten des
erschöpften Breisgaus vollauf zu haben."
Doch im übrigen scherte sich das Volk langsam wenig um dieses ewige Hin
und Her. Am 15. August, zum Fest Mariae Himmelfahrt, kommt der Abt mit
Oberamtmann Mercy und Amtmann Müller ins Eschbach. Es hatte lange
gedauert, aber nun war es so weit. Einige junge Männer und Mädchen
hatten ein paar Lieder gelernt und sangen sie erstmals öffentlich in
der Kirche. Man hatte noch eine kleine tragbare Orgel von St.Peter in
der Kirche, und so wurde an diesem Tag ein Amt gehalten. Die Eschbacher
hatten Gefallen an der grösseren Feierlichkeit, so dass sich viele
freiwillig bereiterklärten, für eine Orgel Geld zu stiften. Die Singer
aber erhielten vom Abt ein Geschenk, das den Eifer mehren sollte.
Bald darauf wird der Abt als Geisel von den Franzosen nach Strassburg
verbracht und verbleibt dort bis Weihnachten. Die Franzosen wollen
damit höhere Zahlungen erreichen. Im April 1801 ziehen starke
französische Truppenverbände durch Freiburg. Da sonst nicht viel mehr
zu holen ist, verlangen die Franzosen jetzt auch Holzlieferungen.
Überall Truppen, Truppen auch in Eschbach, für das ausgeplünderte Land
eine grosse Last.
Trotz aller Besetzung aber findet am 4.Oktober in Freiburger Münster
ein feierliches Pontifikalamt zum Namensfest des Kaisers Franz statt.
"Vielleicht das letzte Mal, dass des Kaisers Namensfest gefeiert wird,"
meint Abt Speckle.
Das drangvolle Jahr 1801 endete mit grossen Überschwemmungen. Am 30.
Dezember brach plötzliches Tauwetter ein, grosse Schneemengen
schmelzen. Dabei regnete es ausserordentlich. “ Die Schwabentorbrücke
war in Gefahr, die in Ebnet, welche vom Kloster mit unterhalten werden
musste, barst, und die in Zarten wurde unbrauchbar. In Falkensteig trat
der Rotbach über die Ufer und überschwemmte und zerriss die
Landstrasse, und 300 Mann aus dem ganzen Dreisambecken wurden
aufgeboten, um den durch das Wasser Bedrängten zu helfen. "Ganze
Gärten, Äcker, Matten wurden weggeschwemmt oder ganz und gar
ruiniert... Die Gegend soll so entstellt sein, dass man sie kaum noch
erkennen kann."
Das neue Jahr begann mit heiterem Himmel, doch auch es brachte Leid
genug über unser Land. Für das Kloster St.Peter verdunkeln sich mehr
und mehr die Aussichten. Die Säkularisation, 1806 dann endlich
durchgeführt, bedrohte schon damals das Kloster. Dazwischen Streit mit
den Untertanen. In Eschbach sollten, 12 Jahre nach dem Bau, die
Kirchenfenster repariert werden. Der Abt meinte, die Gemeinde solle
diese machen lassen. Die Gemeinde wehrte sich: "Man hätte ihnen
versprochen, dass sie gar keine Unkosten wegen der neuen Pfarrei zu
leiden hätten. Ja, die siggingschen und kageneckschen Untertanen
erklärten sogar, sie wollten lieber wieder in die Kirche nach
Kirchzarten gehen, als etwas zu zahlen."
Überhaupt wurden die Verhältnisse zwischen den drei Ständen immer
gespannter. Bisher war der Verkauf eines Hauses in fremde Hand immer
eine Gelegenheit für die Herrschaft, die darauf liegenden Abgaben zu
steigern. Als in Eschbach das ansehnliche Haus auf der Ruckstauden
(Salzhof) Verkauft wurde, steigerte der Abt den Jahreszins nur um 2
Gulden auf 40 Gulden, 25 Kreuzer, aus besonderer Rücksicht, damit die
Eschbacher nicht mit den übrigen abhängigen Vogteien einen Prozess
anstrengten. Im August desselben Jahres werden Reparaturen an Pfarrhaus
und Kirche fällig. Das Kloster befiehlt den Untertanen Fuhr- und
Handfrohnen zu leisten. Die Klostervogtei und die siggingisehe tat's,
der kagenecksche Beamte widersprach und glaubte, das Kloster müsse
alles auf eigene Kosten bezahlen.“
Inzwischen war P. Franz Pfarrer von Neukirch geworden und Pater Otmar
Brogli Pfarrherr von Eschbach. Im September tauscht das Kloster den
Pfisterwald in Eschbach mit den zwei oberen Bauern des Tales gegen
deren Anteil am Allmendwald.
Die letzte Eintragung des Abtes in diesem Jahre 1802, die Eschbach
betrifft, und die auch für uns hier die letzte sein soll, die wir
verfolgen, weil wir nun über die Schulgeschichte handeln wollen und
dennoch nicht glaubten verzichten zu können auf die deutlichere
Herausarbeitung wenigstens einiger Jahre Geschehens im Eschbachtale, -
diese Eintragung berührt uns seltsam und sie gibt doch etwas wieder von
jener etwas düsteren Zeit beginnender Säkularisation: "Nachmittags ging
ich (der Abt) zurück nach St.Peter. In Eschbach fand ich die Kirchentür
offen und ein paar Schweine in der Kirche, im Haus niemand als das
kleine Dienstmädchen, Pfarrer und Häuserin waren abwesend; diese im
Breisgau, jener zu St.Peter. Der Pfarrer begegnete mir unterwegs, da es
starke Abenddämmerung war... Ich gab ihm ein Regierungsdekret, vermöge
dessen die auf dem Lindenberg gestiftet gewesenen Anniversarien... nun
fürderhin in Eschbach sollen gelesen werden. Es sind 12 Anniversarien."
Endlich 1803, nach langer Besetzung ziehen die Franzosen ab. Der Herzog
Herkules von Modena übernimmt den Breisgau, stirbt aber wenige Tage
nach der Entgegennahme der Huldigung. Der Breisgau wird wieder
Österreichisch. Doch drei Jahre danach, durch den Frieden von Pressburg
bekommt den Breisgau der Kurfürst von Baden zugesprochen. "Mit Schmerz
vernahmen die Ständeglieder diese Verkündigung, der...Präsident brach
in Tränen aus, Stimmen des Erstaunens, der Entrüstung... erhoben sich."
Die 500 jährige Verbindung unserer Heimat mit Österreich fand ihr Ende,
die Verbindung mit Preussen bahnte sich über den Hof in Karlsruhe an.
Zwar rückten in unser Gebiet erst einmal die Württemberger, die ihre
Grenzpfähle bis an die Gemarkungsgrenze von Freiburg steckten, doch
mussten sie sich unter französischem Druck nach zwei Monaten
zurückziehen. Der Breisgau wurde badisch. Einer der Grundherren von
Eschbach aber, der Freiherr von Sickingen gab freiwillig seinen
Jahrhunderte alten Adelssitz in Ebnet auf und verzog nach Österreich
Anfangs noch schwer lebte sich der Breisgau in das neugeschaffene
Grossherzogtum ein, umso mehr, als jetzt die grosse Errungenschaft der
französischen Revolution, "das Volksheer" nun auch in Baden geschaffen
wurde. Überall im Tale wurden Soldaten ausgehoben, mussten mit den
Franzosen gegen ihren bisherigen Kaiser Franz kämpfen, wurden zum
Feldzug nach Spanien oder Russland geschickt. Heimkehrer aus Spanien
brachten dabei unser heute so beliebtes Cegospiel mit.
Eine letzte schwere Prüfungszeit wurde für die Bewohner unseres Tales
der Winter und das Frühjahr 1813/14. Die Truppenmassen der Verbündeten
zogen durch das Tal, besetzten alle Lazarette und alte Klöster mit
kranken und yerwundeten Soldaten und brachten auch der Bevölkerung
Epidemien mit.
Nach dieser Zeit aber versucht man innerhalb der Gemeinden zu einem
Lastenausgleich zu kommen. Dies auch auf dem Gebiet der bisherigen
Klostervogteien St.Peter. Die vom Krieg weit weniger hergenommenen
Gemeindeteile Rohr, Hinterstrass und Guttach müssen an die stark
hergenommene bisher prälatische Vogtei Eschbach eine
Entschädigungssumme von 678 fl. bezahlen. Dieses Geld aus dem
Lastenausgleich wird dann der finanzielle Grundstock zum Schulhausbau
in Eschbach. Genau anteilig dem Steuerkapital jeden Bürgers wird ein
bestimmter Betrag von dem jeden treffenden Zuschuss zum Schulhausbau
abgerechnet.
Schon bald nach der Übernahme des Tales durch die badische Verwaltung
wurde die Notwendigkeit eines Schulhausbaues in Eschbach erkannt, wo ja
noch immer fast 90 Kinder im "Schniederhäusle" unterrichtet wurden. Im
Jahre 1813 wurde ein erster Plan hierfür verfertigt, der aber wegen der
Wirren dieses und des folgenden Jahres nicht zur Ausführung gelangte.
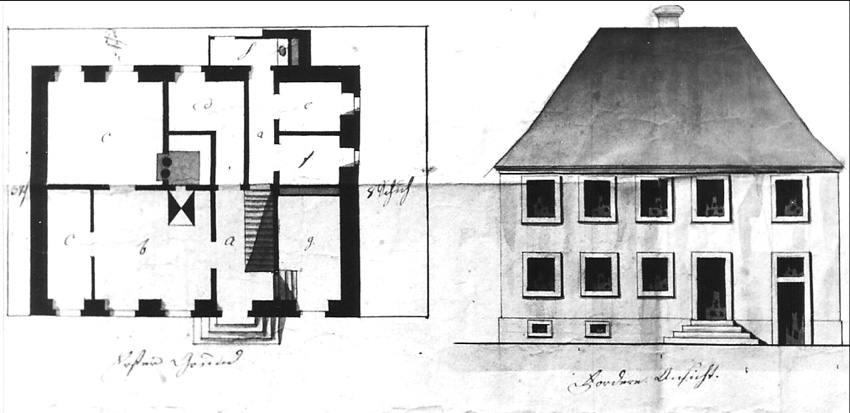
Schulhausplan
Inzwischen wurde auch eine neue Raumordnung unternommen. Unser Tal,
bisher durch Jahrhunderte an verschiedene Herrschaften gebunden, wurde
nun nach geographischen Gesichtspunkten neu geordnet und zu einer
Dorfgemeinde im modernen Sinne gestaltet. Deshalb vollzog sich überall
im Dreisamtale, für uns hier in Eschbach im Jahre 1811, wo die bisher
kagenecksche, die sicking-
sche und die prälatische Vogtei zur modernen Gesamtgemeinde Eschbach
verbunden wurde. Erster Vogt der Gesamtgemeinde wurde der bisher
sickingsche Vogt Thomas Steyert, seit 1801 Bauer auf dem Scherthomashof.
3. Der erste Schulhausbau in Eschbach.
Ob Thomas Steyert selbst es war, der die Initiative zu einem
Schulhausbau in Eschbach ergriff, oder diese vielmehr von der
grossherzoglichen Verwaltung ausging wissen wir nicht, doch war es
jeweils während der Amtszeit dieses Vogtes, dass in jener Frage etwas
unternommen wurde. Mindestens hatte Steyert, der ja schon im
jugendlichen Alter von 28 Jahren das sickingsche Vogtamt seinerzeit
übernommen hatte, ein wichtiges Wort mitzureden.
Schon zwei Jahre nach seiner Amtsübernahme, im Jahre 1813, wurde der
bereits erwähnte Plan für einen Schulhausbau vorgelegt. Die .schlimmen
Kriegsjahre 1813 auf 14, in denen 600000 Mann der verbündeten Truppen
unsere Heimat in Richtung Frankreich durchzogen, unter ihnen sehr viele
Russen, und aus den Bauern auch dieses Tales das Letzte an Hafer und
Heu herausgepresst wurde, viele Bauern zu Vorspanndiensten verpflichtet
und oft wochenlang mit ihren Zugtieren von Haus und Hof weg sein
mussten, diese schlimmen Jahre brachten andere Sorgen und liessen den
Schulhausneubau wieder in Vergessenheit geraten.
Nach Friedensschluss hatte man das Problem Schule wieder deutlicher vor
sich. Das kleine Behenhäusle, das Wohnhaus von Lehrer Winkler, konnte
einfach die grosse Schar von fast 90 Kindern nicht mehr fassen, und
Winkler selbst, inzwischen 73 Jahre alt geworden, erwartete sehnsüchtig
den Tag, an dem grössere Ruhe in sein Häusle einkehren sollte.
1820 beschwerte sich Lehrer Winkler, dass er seit zwei Jahren das ihm
als Teil seiner Vergütung zustehende Brot, von den Gemeindemitgliedern
nicht mehr erhalten habe. Das Grossherzogliche Landamt verfügte
hierauf, dass es ohnehin längst schon geboten sei, dass der Schullehrer
die 28 3/4 Laib Brot von Eschbach und die sieben Laib von Stegen
künftig aus einer Hand empfangen soll. Deswegen erhält der Vogt den
Auftrag, die Brotlaibe zu repartieren, binnen 14 Tagen, sowohl für die
verflossenen zwei Jahre als für das laufende Jahr, und dem Schulleiter
abzuliefern. All die Jahre vorher waren es dann wohl die Kinder, die
dem Schulmeister gelegentlich das ihm zustehende Stück Brot mit in die
Schule brachten.
Die Gemeinde selbst bezahlte Winkler bisher 100 fl. pro Jahr und sollte
dieses Gehalt ab 19.10.1821 auf 100 fl.rheinisch aufbessern. Als
Messmer bezog Winkler noch 4 fl. 36 Kreuzer Rauchgeld. Mit diesen
geringen Bezügen musste er auch noch seinen Sohn Matthias unterhalten,
seit 1806 sein Schulgehilf. An eine Vergütung wegen Verwendung des
eigenen Wohnhauses als Schulhaus war natürlich nicht zu denken. Keiner
also wird den Schulhausbau dringlicher erwartet haben, als gerade der
alte Winkler.
Im Juni 1821 war es so weit. Thomas Steyert war noch Vogt von Eschbach,
als am 15. Juni 1821 Lohnkutscher Schweigner aus Freiburg, an blühenden
Talmatten vorbei, den grossherzoglichcn Kreisbaumeister Arnold nach
Eschbach führte. Seine Aufgabe war es, den von der Gemeinde für einen
Schulhausbau vorgesehenen Platz zu visitieren und baldmöglichst Pläne
für einen Neubau vorzulegen. Den Platz selbst wollte die Gemeinde aus
dem Pfarrbesitz erstehen, und zwar den sogenannten "Dreispitz" westlich
des Kirchenportals, auf dem heute Schulhaus und Rathaus stehen. Die
Brücke über den Eschbach zur Kirche führte damals nach einem alten Plan
von Geometer Th. Walz vom Jahre 1785 ganz an der Spitze dieses
Grundstückes, heute Gemüsegarten von Oberlehrer Wörner. Der Weg führte
von dort weiter zum damals sogenannten Dinkelhof, wahrscheinlich eine
nachträgliche und falsche Deutung des Wortes Dinghof, heute Maierhof
genannt.
Für die Abgabe des Grundstückes aus Pfarrbesitz stellte Dekan Schmidt,
Kirchzarten (Dekan Müller liess 1818 auch in Eschbach 100 Bibeln an die
Leute verteilen) der Gemeinde am 27.12.21 folgende Alternative:
Entweder bezahle die Gemeinde hier für 150 fl., oder stelle ein gleich
grosses, gutes, in der Nähe gelegenes Stück Land zur Verfügung. "Glaubt
die Gemeinde, es sei zuviel gefordert, so schaffe sie der Pfarrei ein
anderes Feld an. Dieses Angebot war nicht schlecht, hatte die Gemeinde
doch einige Zeit zuvor beim Verkauf der St.Jakobskapelle (heute Haus
Gimbel) für jenes kleinere Grundstück 200 fl. bekommen.
Jedenfalls Kreisbaumeister Arnold scheint mit dem Gelände zufrieden
gewesen zu sein. Ein halber Tag Anwesenheit in Eschbach genügt ihm, im
August fertigt er die Pläne für das neue Schulhaus samt Ökonomiegebäude
und verlangt dafür 15 fl. 38 kr., für alle seine Bemühungen aber
insgesamt samt Plan 24 fl. 21 kr., welches Geld er nach zweimaliger
Mahnung auch endlich am 1.Dezember bezahlt bekommt.
Inzwischen war es im Juli dieses Jahres in Eschbach zu einer neuen
Gemeindewahl gekommen. Pfisterbauer Josef Saum wird neuer Vogt. Am 4.
Juli verzehren aus diesem Anlass Amtmann und Schreiber, Altvogt
Steiert, die "Vorgesetzten" und der Neugewählte beim Engelwirt Lorenz
Bank 10 fl.54 kr. und dazu 2 Mass (3 Liter)
Wein, die Mass zu 28 kr.
Vogt Saum kann in diesem Jahr in Sachen Schulhausbau nichts mehr
unternehmen, der Winter 1821/22 zieht übers Land. Der 9. April 1822
bringt endlich die Baugenehmigung.
Eine Zeitungsannonce in der Freyburger Zeitung und im Grossherzoglichen
Anzeigenblatt des Dreisamkreises verkündet bald darauf die öffentliche
Versteigerung der Arbeiten am Schulhausbau Eschbach. Für den 21. Mai
1822 vormittags 10.00 Uhr wird die Versteigerung anberaumt. Viele
Handwerksmeister sind erschienen. Den Zuschlag erhalten Maurermeister
Peter Laule und Zimmermeister Johannes Jantz, beide aus Stegen. Sofort
schliesst die Gemeinde mit ihnen einen Vertrag ab. Jantz bekommt für
Zimmerarbeiten an Haus und Ökonomie, Stiegen und Streifenböden 211 fl.
und einen Wagen voll Abholz. Das Holz muss er selbst bei den Bauern
schlagen, kann aber von den Bauern die Kost haben. Ebenso erhalt der
Maurer für alle Arbeiten samt Verputz und Mauer am Bach 610 fl. und
einen Wagen Abholz.
Am 10. Juni wird der Bauplatz unter Mithilfe von Vogt Saum ausgesteckt,
und am 23.Juni rollt der erste Wagen Kalk heran. Und dann folgt das
ganze Baumaterial, Wagen um Wagen. Die Eschbacher Bauern teilen sich
dieses Geschäft. Gehauene Bruchsteine kommen aus Mundingen, Backsteine
und Ziegel werden aus den Ziegeleien im Welchental, Merzhausen und
Nagelesee herangefahren. Für alle Fuhren durch Freiburg muss
"Pflastergeld" bezahlt werden, 12 kr. pro Wagen. 100 einfache
Backsteine kosten 58 kr., 100 doppelte einen Gulden. Inzwischen
arbeiten Laule und Jantz fleissig weiter und bringen den Bau bis Anfang
August nach oben.
Am 3. und 4. August aber wird nicht gearbeitet. Richtfest ist! Und da
wird nicht gespart. Die Gemeinde kauft sich vom Weinhändler Schwab aus
Freiburg 2 Saum (300 Liter) Wein, führt diesen selbst nach Eschbach und
beschafft sich vom "Metzgerhause" in Kirchzarten 44 Pfd. Fleisch, das
Pfund zu 6 1/2 kr. Zwei Mässle Salz werden noch gekauft bei Krämer
Josef Rombach, und jetzt kann das Fest beginnen. Brot bringt sich jeder
selbst mit. Fleisch gibt's aus dem grossen Topf und 300 l Wein müssen
getrunken sein. Nicht jeder wird nüchtern nach Hause gekommen sein an
diesem Tag.
In den folgenden Monaten wird am Innenausbau gearbeitet. 18 Pfd.
"Kälberhorr" werden geholt von dem Gerber in St.Peter. Man braucht sie
für Verputzarbeiten. Ebenso 3 Sack “Spreuel" vom Müller Bentz in
Zarten. Schmied Feser macht die Schmiedearbeiten und der Glasermeister
in “Birchen" lässt am 5. November die Fenster anführen. Für die Ofen
holt man die Steine für Fuss und Ofenbank im Steinbruch von
Pfaffenweiler, und dann ist es bald so weit. Rasch werden noch einige
mehrsitzige "Schulerbänke" gezimmert, das Stück zu 1 fl. und nun konnte
der inzwischen 76jahrige Lehrer Winkler zu Neujahr 1823 in seine
langersehnte Schule einziehen. Der Abschluss einer Brandversicherung am
19. Mai 1823 ist das Letzte, was die Gemeinde für den Neubau noch zu
tun hat.
Der Neubau wird im übrigen auch von der Gemeindeverwaltung selbst
benützt, denn ganz oben im dritten Stock hat sie hinter den zwei
Bogenfenstern ein primitives Ratszimmer eingerichtet, Registratur
genannt, wo Vögte und Ratschreiber zu arbeiten hatten. Die
Gemeindeversammlungen aber waren im Schullokal.
Was wir in diesem neuen Schulhaus aber vergebens suchen werden, sind
die Aborte. Vermutlich werden die Kinder ihre Notdurft in dem
nebenliegenden Ökonomiegebäude verrichtet haben, in welchem Lehrer
Winkler seine Landwirtschaft untergebracht hat.
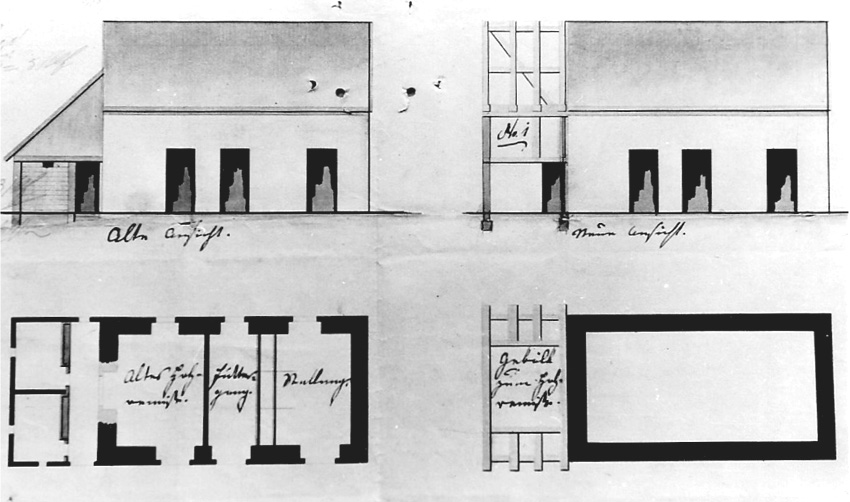
Wie aber hat die Gemeinde diesen Neubau finanziert? Durch eine
Abschlussrechnung vom 23.10.1823, gefertigt von Schullehrer Martin
Braun, St.Peter, sind wir hierüber im Klaren. Den finanziellen
Grundstock für den Neubau bildete der Erlös der Gemeinde vom Verkauf
der Jakobuskapelle (200 fl.), ein Säcklein mit drei altfranzösischen
kleinen Talern, einem Dreibätzler und 10 1/2 alte österreichische
kaiserliche Kreuzer, die Altvogt Steiert dem neuen Vogt Saum 1821
überreichte. Weiter kam dazu ein "Baukostenzuschuss" der
Grossherzoglichen Regierung, vertreten durch die Domänenverwaltung in
Freiburg, welche der Gemeinde die Hälfte des einjährigen Zehntertrages
von Eschbach erliess und so 151 fl. 45 kr. bezuschusste. Die Gemeinde
musste allerdings einen Revers unterschreiben, "dass dieser Beitrag der
Landesherrschaft nie zum Präjudiz gereichen soll." Eine Bürgerin und
der Stiftungsfond gaben noch kleinere Darlehen, doch für dies und alles
andere hatten die der Schule Eschbach zugeteilten Hof- und
Taglöhnerbesitzer zu bezahlen, mögen sie zur Vogtei Eschbach gehören
oder nicht. (Der Reckenberg als frühere kagenecksche Besitzung gehörte
ja zu Stegen.) Selbst Lehrer Winkler, mit 380 fl. Steuerkapital
veranschlagt, musste das seine entrichten. Am meisten traf es den
Schwabenbauern Peter Thoma. Er allein bezahlte 156 fl. mehr als der
Staat Zuschuss gegeben. In Abrechnung aber kam der Betrag, der als
Lastenausgleich von den Gemeinden von Hinterstrass, Rohr und Guttach an
die meistgeschädigten Eschbacher Bauern bezahlt werden musste. Die
Summe aller Baukosten betrug 2500 fl. 13 kr.
Folgen wir der Baugeschichte des ersten Eschbacher Gemeindeschulhauses
weiter, so lässt sich folgendes mitteilen: 1837 musste der Ofen im
Schulzimmer ausgebessert werden. Das Schulzimmer wird geweisselt. 1839
werden vier Scheiben ersetzt, 1840 sind Reparaturen des Daches fällig.
1858 wird von Nässe im Schulzimmer gesprochen. 1861 baut die Gemeinde
eine Holzremise für 8 Klafter Holz über der Schweinestalldecke des
Ökonomiegebäudes. Die Ratstube (Registra-
tur) befindet sich immer noch im dritten Stock des Schulhauses.
Wenigstens das Archiv soll jetzt aber feuersicher untergebracht werden.
Man schlägt den früheren Arrestraum (heute Waschküche) vor.
Interessant ist eine Heizordnung von 1868. Dort heisst es, der Anheizer
müsse täglich um 5 Uhr den Ofen heizen und den Lehrer zur Anzeige
bringen, wenn durch unnötiges Öffnen der Fenster das Schulzimmer
verkältet wird.
1874 wird die Gemeinde gezwungen, die alte Registratur im Speicher
aufzugeben und ein neues Rathaus zu bauen. Es ist dies die Zeit des
Kulturkampfes, und die Töne, die zu jener Zeit von den Behörden in das
katholische Eschbach getragen werden, sind nicht gerade freundlich
(Interessant ist in jenem Zusammenhang auch ein Brief, der von
Freiburg, statt über das für uns damals zuständige Postamt Burg, zuerst
nach Eschbach bei Heitersheim lief, und von dort wieder zurückgeschickt
wurde: Damals wie heute). Eschbach entschliesst sich zum Umbau des
Okonomiegebäudes, das seit Aufgabe der Landwirtschaft durch die Lehrer
ohnehin nicht mehr voll genutzt war. Der vordere Teil gegen die Kirche
hin wird etwas vergrössert. Die alte Registratur kommt in Benutzung des
Lehrers Friedrich. Über dieses Rathaus von 1874 schreibt Pfarrer
Gustenhofer in seiner Chronik: "Es war ein einstöckiges Häuschen,
bestehend aus einem einzigen, etwa vier Schritte langen und drei
Schritte breiten Lokal und Dach. Fremde welche die Aufschrift lasen
"Rathaus" lachten gewöhnlich.
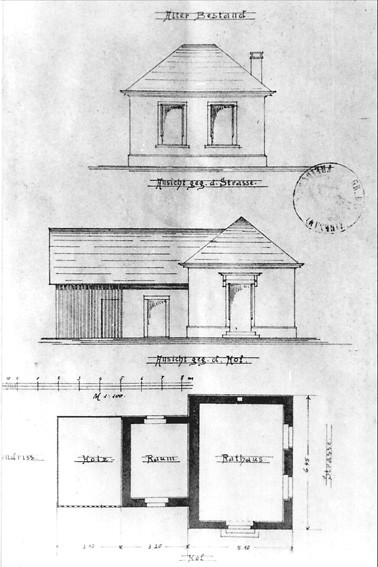 |
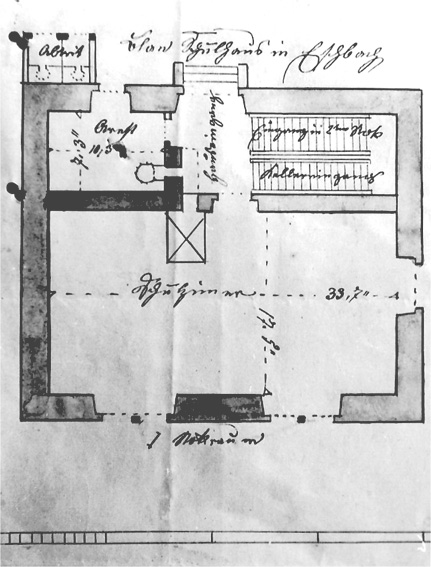 |
| Rathaus | Grundriss |
Zur selben Zeit entschloss man sich zu kleineren Umbauten am Schulhaus
und zur Anlage eines primitiven Abortes an der Nordwestecke des Hauses,
da die Okonomie ja jetzt Rathaus war.
Über den Zustand einer solchen Abortanlage in Stegen um das Jahr 1875
gibt uns ein Bericht von 1879 Aufschluss: “Dieselbe bestand aus einem
einfachen Holzbau zwischen zwei Fenstern des Schulsaals, ohne Grube
oder sonstige Vorrichtung zur Aufnahme der Exkremente. Der untere, aus
nur einem Gelass bestehende Abort war für die Schüler, der obere für
die Familie des Lehrers bestimmt."
Nach der Jahrhundertwende 1902 sollte die Gemeinde Eschbach die
primitive Abortanlage abreissen. Dies erfolgte 1903 in Zusammenhang mit
dem grossen Rathausneubau. Dabei wurde auch das Schulhaus renoviert.
Ein neuer Kamin wurde erstellt, der Verputz abgeschlagen, und Maurer K.
Schuler aus St.Märgen fertigte einen neuen, der bis 1958 hielt. Diese
Reparaturarbeiten kosteten 2103 Mark.
Also wurde 1903 das alte "Rathäusle", die umgebaute frühere Ökonomie
abgebrochen, und die Gemeinde kaufte dahinter noch 132 qm Wiese von
Maierbauer Anton Rombach à 1,80 Mark. Dieses Grundstück hatte aber die
Gemeinde schon einmal 1821 aus Pfarrbesitz angekauft. Die Nutzniessung
des Grases hinter der Ökonomie aber überliess man dem Maierbauern.
Dieser sprach dann in den folgenden Jahren das Eigentumsrecht an, so
dass man 1903 beim Neubau des Rathauses das Gelände ein zweites Mal
ankaufen musste.
In der ersten Hälfte des Jahres 1903 wurden dann die Pläne für den
Rathausneubau vorgelegt. Während der Bauzeit, Juni 1903 bis Neujahr
1904 war das Ratszimmer provisorisch im ersten Stock des
Schwesternhauses untergebracht. Beim Fundamentieren stiess man auf
Schwierigkeiten. Man fand Lehmboden und musste mit eisernen Schienen
und Zementsockeln das Fundament erst künstlich herstellen In den
unteren Stock kamen Ratszimmer, Archiv und Bürgersaal, in den zweiten
Stock ein kleineres Schullokal und zwei Zimmer für den Unterlehrer.
Ausser der Renovierung des alten Schulhauses wurde noch der Schulgarten
höher gelegt, mit Mauer und Drahthag gegen den Bach und die Wiese
geschützt, und eine neue Abortanlage aufgeführt, die erst 1957
niedergerissen wurde. Der Gesamtbau kam auf 23800 Mark, Architekt Kähny
erhielt hiervon 360 Mark. Die neue Abortanlage allein kostete 2000
Mark, für damalige Zeit ein unerhörter Luxus.
Noch im Dezember 1900 musste der Bezirksarzt anlässlich einer
Visitation die Schulverhältnisse in Eschbach heftig rügen, und meint
nebst anderem schreiben zu müssen: "In einem Raum links im Hausgange
der Schule, neben der Schultüre verwahrt die Gemeinde die
Beerdigungsgeräte, die oft sogar Leichengeruch verbreiten. Es muss dies
als ein nicht zu duldender Misstand bezeichnet werden." Doch jetzt 1904
sind die Verhältnisse in Eschbach für damalige Zeit sicher vorbildlich,
zumal 1905 noch eine Anzahl patentierter Rettigbänke von den
Vereinigten Schulmöbelfabriken angeschafft wurden.
Doch die Zeit lässt nichts bestehen. 52 Jahre danach, am 12.Mai 1936
stellt das Kreisschulamt Freiburg folgendes fest: "Das grosse
Schulzimmer hat einen morschen Boden, in der Mitte ist ein Stück
herausgebrochen... Die Einrichtung des Schulzimmers ist gänzlich
veraltet, ein Teil der Bänke ist über hundert Jahre alt. Der Keller des
Schulhauses ist seit Jahrzehnten unbenützt, er ist mit Schutt und
Schmutz angefüllt; ein Zugang zum Keller fehlt, er wurde wohl beim
Einbau des Ortsarrestes zugemauert. Auch in dem als Kohlenkeller
benützten Vorraum liegt Schutt ein halber Meter hoch. Dieser grosse
unbenutzte Keller ist ein Maus- und Rattennest für das ganze Gebäude.
Die Fensterläden am Hause fehlen teils, teils sind sie so schadhaft und
verzogen , dass sie nicht mehr geschlossen werden können. Auch fehlt
der Haustüre, den Läden und Fenstern jeder Anstrich und den Scheiben
die Verkittung... Die Holzverkleidungen sind von Mäusen und Ratten
zernagt, die meisten unteren Ecken der Türen fehlen. Von den Decken
fällt beständig Gips herab. Alle Ofen rauchen... Die Verwahrlosung des
ganzen Hauses ist ohne Beispiel."
An all dem wird bis zum Einzug von Hauptlehrer Heizmann noch manches
geändert, doch bald bricht der schreckliche Zweite Weltkrieg über ganz
Europa herein, und erst ab 1947 kommt es zu einer langsamen Besserung
der schulischen Verhältnisse hier im Tale. Sie zu beschreiben hat
Oberlehrer Wörner unternommen, der seit 1947 hier tätig ist.
4. Schulisches Leben in Eschbach
a) Schulbesuch
Schon an früherer Stelle wurde darauf hingewiesen, dass um 1800 wohl
täglich nur etwa 60 % aller Schulpflichtigen den Unterricht besuchten.
Schule ist ja eine Einrichtung der Gesellschaft. Die Gesellschaft in
Eschbach aber setzte sich damals zusammen aus Bauern und Taglöhnern.
Ihnen genügte jedenfalls ein 60% iger Schulbesuch.
Um die Jahrhundertmitte mühte sich die grossherzogliche Regierung sehr
darum, in der Frage der Schulpflicht einen Schritt weiter zu kommen.
Lehrer und Pfarrer mussten Listen der unentschuldigt Fehlenden anlegen.
Dem Bürgermeisteramt oblag es dann, die auferlegten Geldstrafen
einzuzichen. 3 bis 6 kr. Strafe wurden für jedes Fehlen ausgesprochen.
Trotz des scharfen Durchgreifens fehlten nach wie vor pro Woche im
Durchschnitt 12 Kinder von ca. 100, manche 2 bis 4 mal. In mancher
Woche musste der Lehrer sogar über 20 fehlende Kinder eintragen.
Noch am 15.9.1921 musste die Behörde feststellen: “Trotz allen
behördlichen Einschreitens kommt es in erheblicher Zahl zu unzulässigen
Versäumnissen an den Volks-«und Fortbildungsschulen." Die Eltern der
Kinder würden lieber die kleinen Geldbussen in Kauf nehmen, weil sie
selbst durch Übertragung von Arbeiten und Geschäften aus den Fehlenden
mehr herausholen, als sie bezahlen müssten.
Solches Verhalten der Eltern änderte sich nur langsam, kam gelegentlich
vielleicht auch in der Nachkriegszeit vor, ist aber heute Wohl völlig
geschwunden. Benötigen die hiesigen Bauern gelegentlich ihre Kinder
dringend, kommen sie zum Lehrer und dort wird ihrem Ansuchen in der
Regel auch stattgegeben. Missbräuche können hierbei wohl kaum
beobachtet werden.
b) Schulzeiten
Lehrer Matthias Winkler unterrichtete in den 40er Jahren des letzten
Jahrhunderts die Kinder nur im Winterhalbjahr, von der Beendigung des
Weideganges bis Ostern. Die Schule Eschbach war seit ihrer Entstehung
bis weit ins 19.Jahrhundert hinein eine reine Winterschule.
Bald danach entschied man sich für eine andere Lösung. Die Schüler
hatten demnach nur an drei Wochentagen Schulunterricht. Das 1. bis 3.
Schuljahr an drei Wochentagen, und an den drei anderen dann die übrigen
Schuljahre. Nach der Schulreform vom Jahre 1866 hatten die Zustände
dann ein Ende. Für die Schwarzwaldgebiete wurde ein Schultyp
zugelassen, der dann später den Namen "Hirtenschule" tragen sollte.
Darüber folgt ein eigener Abschnitt.
Im Jahre 1900/01 machte Pfarrer Gustenhofer den Versuch auch samstags
Unterricht einzuführen und dafür zweimal nachmittags nicht, "weil
infolge zweier leerer Tage, Samstag und Sonntag, auf den Montag
gewöhnlich nichts gelernt wird. Am Freitag werfen sie die Schultaschen
in ein Eck der Stube oder Kammer, und am Montag sucht man dieselbe,
wenn es Zeit ist in die Schule zu gehen, zu dem oft durch noch kleinere
Kinder verschleppt, findet man sie gar nicht." Doch Pfarrer Gustenhofer
predigte tauben Ohren. Die Eltern hatten kein Interesse und die Lehrer
fuhren an diesem Tage lieber nach Freiburg.
Ab 1907 wurden für die Schüler auch der Hirtenschulen mindestens 20
Stunden statt bisher 18 Wochenstunden vorgeschrieben. Der Beginn des
Nachmittagsunterrichtes sollte von bisher 12 Uhr auf 12 Uhr 50
verschoben werden und der schulfreie Samstag wegfallen. Ein Sturm der
Entrüstung erhob sieh, und die Regierung konnte mit ihren Forderungen
nur halb durchkommen.
Nach dem letzten Weltkrieg wurden die Wochenstundenzahlen der Kinder
schrittweise nach oben gesetzt. Sie betragen heute für die Schüler der
Unterklassen 22 bis 26 und für die Oberklassen 26 bis 32 Wochenstunden.
Die Stundenverteilung schaut heute für das sechs 6te Schuljahr z. B.
wie folgt aus: 6 Stunden Deutsch, 4 Stunden Geschichte,
Gemeinschaftskunde, Erdkunde, 5 Stunden Naturkunde, Naturlehre, 5
Stunden Rechnen, 2 Stunden Bildhaftes Gestalten, je 2 Stunden Singen,
Leibesübungen und Werken, je 5 Stunden Religion und Handarbeit. Hierzu
kamen in Eschbach seit Ostern 65 noch 5 Stunden Englisch. `
c) Schulgeld
Vermutlich bis zur Gründung der Gesamtgemeinde Eschbach (1811) war der
Schulhalter Winkler ganz auf die Bezahlung eines Schulgeldes
angewiesen, das er selbst mit den Eltern seiner Kinder aushandelte. Ob
vor 1806 auch ein Fixum des Klosters dazukam, wissen wir nicht. Erst
nach 1811 erhält Winkler ein festes Gehalt von der Gemeinde, das 1821
auf 100 fl. rheinisch festgelegt wurde.
Weiterhin aber bezahlen die Eltern für jedes Kind pro Winterhalbjahr 50
kr. Dieses Schulgeld wird ab 1841 nicht mehr von Winkler sondern von
der Gemeinde eingesammelt, 1845 auf 48 kr. und 1858 auf 72 kr. erhöht.
Von einem wesentlich höheren Schulgeldbetrag berichtet uns Pfarrer
Gustenhoffer für das Jahr 1886, wo das erste Kind 5,20 M. entrichten
musste, das zweite, dritte, vierte 1,60 M., das fünfte und ff. waren
völlig frei.
Ab Dezember 1894 verzichtete die Gemeinde probeweise völlig auf die
Erhebung eines Schulgeldes. Dieses wurde auf die allgemeine Umlage
verlegt. Seither mussten die Eltern der Rinder nur noch für
Schreibmaterial und Bücher der Kinder aufkommen. Nachdem aber schon in
den Zwanziger und Dreissiger Jahren d. Jhdts. in einigen sozialistisch
regierten Ländern Europas auch die Lernmittelfreiheit eingeführt worden
war, erhielt unser Land dieselbe auch Anfang der Sechziger Jahre, Doch
wird sie hier in Eschbach von den meisten Eltern nicht in Anspruch
genommen, z.T. aus einer dunklen Scheu, die Richtiges ahnen könnte.
d) Der Handarbeitsunterricht
Dieser Unterricht, der früher von sogenannten Industrielehrerinnen
erteilt wurde, beginnt in Eschbach 1858. In diesem Jahr wird auf
Drängen der Regierung zwangsweise eine Lehrerin für Strick- und
Nähunterricht angestellt. Sie erhielt für den Dienst 5 fl. Namentlich
bekannt ist Susanne Pfaff. 1855 wird Marianne Schrinerin mit 7 fl. pro
Winterhalbjahr angestellt. Sie hatte an 2 Wochentagen je 2 Stunden
Unterricht. Auf Beschluss des Gemeinderates erhielt sie pro Tag 6 kr.
"Dies reiche aus, da eine Näherin auf der Stör im Tag doch nur 12 kr.
erhalte." (hatte aber Essen frei). (6 kr. = 20Pf. von 1890) ( Um
dieselbe Zeit erhielten „Weibsleute" beim Tannensetzen im Wald 24 kr.,
Männer 36 kr.
Dieser Hungerlohn stand der Gemeinde nur schlecht zu Gesicht. In Stegen
zahlte man zur selben Zeit 10 kr. pro Tag. Das Bezirksamt drohte mit
Strafe, wenn der Lohn nicht endlich geändert würde. Einige Jahre wird
daraufhin der Unterricht von der Frau des Stegener Lehrers Genster
erteilt. 1892 erhält die Industrielehrerin Theresia Rombach 26 Mark, ab
1894 29 Mark und Anna Maier ab 1896 48 Mark, pro Wochenstunde 12 Mark
im Jahr. Unterricht wird in jener Zeit im Winter jeden Samstag von 12
bis 16 Uhr vom 3.Schuljahr an erteilt. Gelegentlich fanden auch
Visitationen statt. So musste sich 1890 die Handarbeitslehrerin mit den
Schülerinnen und den gefertigten Arbeiten am 24. April um 1/2 10 Uhr
zur Prüfung im Schulzimmer einfinden. Die Ortsschulbehörde und
interessierte Frauen sollten sich an der Prüfung beteiligen.
1894 wird die Anna Maier von Eschbach als Handarbeitslehrerin in der
Haushaltschule Kenzingen ausgebildet. Dort verblieb sie vom 15. Mai
1894 bis 3.Juli 1894 und erhielt folgende Benotungen:
| Stricken | sehr gut |
| Strumpfflicken |
gut |
| Nähen |
sehr gut |
| Flickenstopfen |
gut |
| Häkeln |
gut |
| Theorie |
gut |
Noch vor der Abreise nach Kenzingen aber
schloss die Gemeinde mit ihr einen Vertrag, nachdem dieselbe in der
Zeit vom 23.10.-23.4.
wöchentlich 3 Stunden Unterricht, am Samstag Vormittag, zu erteilen
habe. Dafür erhalte sie jährlich 36 Mark Vergütung. Ab 1906 wird ihre
jährliche Vergütung auf 80 Mark heraufgesetzt.
1910 und 1911 unternimmt das Grossherzoglichc Bezirksamt Versuche zur
Förderung des Handspinnens. Auch die Eschbacher Mädchen sollten diese
Kunst wieder erlernen. “Dabei bemerken wir, dass auch Ihre königlichen
Hoheiten, die Grossherzoginnen und Grossherzogin Luise der Pflege
dieses echt weiblichen Fleisses das lebhafteste Interesse zuwenden."
Der Haushaltungsunterricht für die schulentlassenen Mädchen wurde seit
1922 in Kirchzarten eingerichtet. Kirchzarten wurde Mittelpunkt für
Zarten, Dietenbach, Burg, Stegen Wittental und Eschbach. Dies konnte
erst nach Überwindung von Widerständen erreicht werden. Von den
Gemeinden wurden folgende Gründe dagegen angeführt:
1. Die Schülerinnen werden zur häuslichen Mitarbeit gebraucht.
2. Die Entfernung zur Schule ist zu weit im Winter bei Schnee zu anstrengend.
3. Die Zurücklegung des Weges ist für die Schülerinnen, zumal bei Dunkelheit mit sittlichen Gefahren verbunden.
4. Die Durchführung des Unterrichtes belastet die Gemeinden finanziell sehr.
1923 wird als Handarbeitslehrerin Anna Gabler genannt. Im November 1923
bekommt sie für 12 Stunden Arbeitszeit den Betrag von 5 596 520 000 000
Mark von der Gemeindekasse; ein Jahr später für ebenfalls 12 Stunden
den Betrag von 10,80 RM. Auch im Jahre 1932 wird Anna Gabler als
Handarbeitslehrerin genannt.
Nach dem Kriege waren hier tätig: Frl. Gertrud Vogel, Frau Jung, und
seit 19.. Frl. Karolina Scherer, gebürtig aus St.Peter. Sie erteilte
bisher an 2 Tagen in 3 Gruppen je 3 Stunden Handarbeit, sowie 2 Stunden
Mädchenturnen. Das Interesse der Mädchen an diesem Unterricht ist gross
und trotz des grossen Angebotes an Waren in den Geschäften werden
Handarbeiten von den Mädchen gerne gefertigt.
e) Turnunterricht
Unter einem unglücklichen Stern stand bisher in Eschbach der
Turnunterricht. Die erste Nachricht diesbezüglich stammt aus dem Jahre
1879. Das Landamt Freiburg befiehlt auf Veranlassung der
Grossherzoglichen Kreisschulvisitatur ein Klettergerüst auf dem
Kirchplatz, als dem einzig möglichen, bauen zu lassen. Über die
Benutzung dieses Klettergerüstes, welches zwischen Kirche und Bach
stand, berichtet Pfarrer Gustenhoffer folgendes: "Schreiber, der doch
seit 1880 täglich vielmals den Platz passierte, sah weder Lehrer noch
Schüler daran turnen. Als in Sommer 1886 die Zimmerleute den Kirchturm
reparierten und das Ökonomiegebäude, legten diese das abgängige Holz am
Klettergerüst nieder. Als das Holz weggeschafft war, nach Freiburg,
fehlten auch die Stangen zum Klettergerüst. Die Gemeindeangehörigen
lachten darüber und sagten: So ist es recht, zur Kirche gehört kein
Galgen." Schulvisitatur und Bezirksamt verlangten ein neues
Klettergerüst sowie einen Barren. Das Pfarramt aber legte Verwahrung
ein. Es dulde zwar Turnen auf dem Platz, aber weder Barren noch
Klettergerüst auf dem Kirchplatz.
Die Gemeinde aber machte am 12.12. d.J. die Eingabe den Turnunterricht
in Eschbach ganz aufzuheben. Im Sommer darauf entschuldigte sich die
Gemeinde, es stünde kein Platz für das Turnen zur Verfügung. Das
Pfarramt verweigere den Kirchplatz, und ein anderer Platz stehe eben
nicht zur Verfügung. Reck und Barren käme überhaupt nicht in Frage.
Das Bezirksamt bohrte erneut in der Sache, zu der Zeit, als die
Gemeinde für den Rathausbau Grund erwerben musste. Es blieb beim Ankauf
der 1821 schon einmal gekauften 132 qm. Nach Norden war der Gemeinde
eine feste Grenze gezogen. Sie berichtete: Turnplatz sei der Weg, der
zum Maierhof führe. Der Grossherzoglich badische Oberschulrat
genehmigte den Weg als Turnplatz, wollte aber ortspolizeiliche
Vorschriften, damit der Turnunterricht nicht durch Fuhrwerke gestört
würde. Die Gemeinde berichtete: "Mit den turnenden Kindern kann nach
zwei Seiten ausgewichen werden, wenn Fuhrwerke passieren", wohl
wissend, dass der Turnunterricht ohnehin nicht gehalten wird.
1907 wird von der Verwaltung bestimmt, dass Schüler mit weitem Schulweg
vom Turnen befreit sein sollen. Die Kreisschulvisitatur will wissen,
wieviele Kinder dann noch für das Turnen übrigbleiben. Die Gemeinde
meldet zurück: Wagensteig, St.
Märgen, Kirchzarten und andere haben keinen Turnunterricht, dann ist er bei uns auch entbehrlich.
Noch 1921 gibt es in dieser Frage Streit. Wer längeren Schulweg als
eine halbe Stunde hatte, war vom Turnunterricht befreit. Die Gemeinde
will auch alle Hütekinder unter die Ausnahmeregelung fallen lassen. Wer
wird dann wohl noch übrig bleiben?
Die äusseren Bedingungen für einen einigermassen geordneten
Turnunterricht waren erst gegeben, als zu Anfang der Fünfziger Jahre
Grasland und Obstgarten vor der Kirche verschwanden, und ein etwas
grösserer Platz hergerichtet wurde. Einige Versuche zur Beschaffung
eines Sportplatzes wurden seither unternommen, hatten bisher jedoch
noch keinen Erfolg. Durch den Bau der Turnhalle, die Bevorstehende
Gründung eines Turnvereins möge der Turnunterricht neue Impulse
bekommen, zum Wohle unserer Jugend, die seiner in einem
hochtechnisiertem Zeitalter immer mehr bedarf.
f) Der Schulhof
Eingeengt durch Schule, Rathaus, Schwesternhaus und Kirche blieb der
Eschbacher Schuljugend der vergangenen Jahrzehnte nur wenig Raum, um in
der Pause sich vom langen Stillsitzen und geistigem Arbeiten zu
erholen, oder im Spiele kindliche Freuden zu erfahren. Umso
unverständlicher mag es erscheinen, dass bis zu Anfang der Fünfziger
Jahre der Grossteil des Kirchplatzes landwirtschaftlich genutzt wurde.
Pfarrer Gustenhoffer schreibt um 1895: "Um das Grasfeld am Kirchplatz
vor dem Portal und beim Rathaus war ein Hag, ursprünglich wie jene am
Feld der Bauernhöfe, Pfähle kreuzweise in den Boden geschlagen, und
eine Stange darüber." 1892 wurde dann ein neues, stabiles Drahthag
durch Schlosser Buch errichtet. Auf Anraten der Grossherzoglichen
Bauinspektion holte man im Pfisterwald riesige Rauhsteine, um die
Pfosten einzulassen. Nun war aber niemand da, der die Löcher für die
Eisenpfosten in die Rauhsteine hauen konnte oder wollte. Endlich fand
sich ein Italiener, der es vermochte. Der Chronist sah diese Rauhsteine
selbst noch, als sie vor wenigen Jahren, zusammen mit den letzten
Eisenpfosten aus der Erde entfernt und von dem Gemeindeangestellten
Karl Scherer mühsam zerschlagen wurden. Pfarrer Gustenhoffer aber
kaufte 1892 von Schmied Feser noch ein altes Eisenhag von
Schmiedeeisen, nicht Gusseisen, das vom gräflich kageneckschen
Schlossgarten in Stegen stammte und vervollständigte damit ein
fehlendes Stück im Zaun, "das besondere Stärke nötig hatte."
Man sieht, wie zwischen mit Spitzen versehenen Eisenpfosten und den
Schulhäusern unsere Jugend auf engstem Raum zusammengedrängt wurde nur
damit auch jeder Quadratmeter Boden genutzt werden konnte.
Endlich nach 1950 trat hierin Besserung ein, und heute beherrscht den
Platz die von Pfarrer Gustenhoffer angekaufte und von Messmer und
zeitweiligem Bürgermeister Andreas Vogt 1884 gesetzte Linde, um deren
Stamm seit über einem Jahrzehnt eine Rundbank besteht, die im kühlenden
Schatten stehend, im Sommer gern von Lehrern und Schülern aufgesucht
wurde. Die jetzige eiserne Brücke über den Bach stammt aus dem Jahre
1889 und wurde von Schmied Feser und Maurer Laule, Kirchzarten,
gefertigt.
Der Schulhof des neuen Schulhauses ist dagegen erfreulich gross
geraten, doch musste sich die Gemeinde und die Lehrer dagegen wehren,
dass nicht in seiner Mitte eine Pflanzinsel angelegt wurde, die dem
Bewegungstrieb der Kinder nur hinderlich gewesen wäre. Hoffentlich
beeinträchtigt die reichliche gärtnerische Bepflanzung der Ränder des
neuen Platzes nicht allzusehr die Bewegungsfreiheit unserer Kinder.
g) Die Hirtenschule
Das Wort Hirtenschule ist uns heute bereits zur Formel erstarrt. Wer
heute von den Jüngeren das Wort in den Mund nimmt und über es vom
Hörensagen oder langstvergangenen, eigenen flüchtigen Erfahrungen etwas
weiss, denkt im allgemeinen höchstens noch an das äussere
Erscheinungsbild dieser Schulform, an jene zwar merkwürdigen, aber über
das Wesen nur wenig aussagenden Umstand, dass die älteren Jahrgänge
nicht am Vormittag, sondern am Nachmittag, gewöhnlich von 12 bis 16 Uhr
unterrichtet wurden. Selbst in einer Zeit, in der die Hirtenschule all
überall im Schwarzwald noch mit eigenen Augen gesehen werden konnte,
scheinen die massgebenden Stellen, die sich immer wieder um die
Aufhebung dieser Hirtenschule bemühten, meist nur dieses äussere Drum
und Dran im Auge gehabt zu haben, und ihr Sinnen und Trachten ging denn
auch immer wieder darauf aus, allein dieses zu ändern.
Dies alles aber änderte nichts an der einen, einfachen Wahrheit. Die
Schule in Eschbach war von ihren Anfängen bis in die Mitte dieses
Jahrhunderts eine Schule der Hirten. Hier gingen nicht Kinder sondern
Hirten in die Schule, junge Menschen mit einer fest umrissenen Aufgabe,
die ihnen niemand abnehmen konnte oder wollte. So ist der letzte Punkt
unseres Exkurses in die schulische Vergangenheit von Eschbach
keineswegs der unwichtigste, sondern der, der die meisten übrigen
wesentlich bestimmte. Schulbesuch, Schulzeiten, die eigentümliche
Entwicklung des Turnunterrichtes, selbst die Beschränkung der Kinder
auf dem Schul- und Kirchplatz durch das geschützte, unantastbare
Grasland, alles stand unter der einen Gegebenheit: in Eschbach gehen
Hirten zur Schule!
Diese Hirten waren meistens die Kinder der Einheimischen, doch mögen
jeden Sommer an die 10 Kinder aus Haslach und Umgebung von ihren Eltern
hierher verfrachtet und damit für einige Monate als versorgt angesehen
worden sein. Wie sehr sich die Lehrer über solche Kinder freuten,
dürfte nicht schwer zu erraten sein.
In extremen Fällen musste so ein Hirtenbub um 5 Uhr aufstehen. Der Tag
begann mit Arbeit im Stall. Mit dem schweren Schubkarren wurden die
gleichfalls schweren Mistladungen vom Stall weggefahren. Dann erfolgte
der Austrieb der Weidetiere auf die vielleicht weit oben liegenden
Weideplätze, und das Viehhüten selbst, das nicht immer ungetrübte
Romantik war. Gegen 11 Uhr wurde das Vieh in die Ställe eingetrieben,
der Hirtenbub eilte zum Essen. Nach dem Essen ging es sofort zur
Schule. Der Weg konnte Kilometer betragen, und die Mittagshitze gross
sein. Das Vieh lag zuhause in den Ställen, der Bub aber eilte zum
Unterricht, der um 12 Uhr begann. Verschwitzt und müde kam er in den
Unterricht, und in der schwülen Mittagshitze war das Unterrichtsziel
nur schwer erreichbar. Gegen 4 Uhr eilte der Bub zum Hof zurück, um
dort das Vieh erneut auszutreiben und kam abends mit dem Vieh zurück
auf den Hof, wo vielleicht noch Arbeiten auf ihn warteten. Wann aber
kam er dazu seine Hausaufgaben zu fertigen?
Was hätte es bei dieser Lage der Dinge genützt, einfach bloss die
Unterrichtszeiten zu ändern und wie überall sonst die Grossen um 8 Uhr
kommen zu lassen. Das Vieh war einfach da, es musste versorgt sein, und
besorgten es nicht die Grossen, so wäre die Arbeit einfach auf die 6
bis 10 jährigen übertragen worden.
So verbot im Jahre 1938 die Schulbehörde mit zunächst grosser
Entschiedenheit den Hirtenschulbetrieb und hoffte dabei das Los der
Hütekinder zu verbessern. Der Erfolg war grosse Verbitterung bei den
Bauern. In einem Bericht von St.Peter Sägendobel hiess es: "Die
Nachgiebigen unter ihnen schickten die Kinder zu den an den normalen
Volksschulen üblichen Unterrichtszeiten und übertrugen das Hüten den
Jüngsten, die nun die ganze Last traf. Die hartnäckigen Bauern aber
schickten die Kinder überhaupt nicht zur Schule und streikten, oder sie
schickten sie zu den gewohnten Hirtenschulzeiten... Dieser unmögliche
Zustand dauerte vier Wochen, dann wurde die Hirtenschule ohne
Widerspruch der Behörde wieder eingeführt.
In Eschbach aber erblickte man in den Auswirkungen der Änderungen von
1938 grosse Nachteile für die Landwirtschaft. Ausserdem herrsche doch
augenblicklich ein grosser Dienstbotenmangel. Die Schule trat bei
dieser Eingabe wieder einmal deutlich als das hervor; was sie
mindestens insgeheim immer war: eine störende Beschneidung der
Arbeitsleistung des Hirtenbuben, 1938 noch genauso wie 1907, als man
versuchte, die Wochenstunden für die Schüler von 18 Stunden auf 20
Stunden heraufzusetzen, und dann sofort die Klage erschallte: "Ein
Ersatz durch grössere Erwachsene ist bei dem grossen Mangel von
Dienstboten nicht möglich. St.Märgen aber klagte: "Die Kinder sind
augenblicklich sieben bis acht Stunden ihrer gedinglichen
Verpflichtungen entzogen."
So konnte das Problem der Hirtenschulen eben erst gelöst werden, als
durch die Elektrozäune der Hirte im volkschupflichtigen Alter
entbehrlich wurde, Dieser Wandel vollzog sich in den Fünfziger Jahren,
und diese brachten denn auch schrittweise die Aufhebung der
Hirtenschule.
Die Lehrer von Eschbach
a) Die Hauptlehrer
1779 bis 1832 Michael Winkler.
Von Michael Winkler wurde schon so viel gesagt, dass hier nur noch
einmal das Wichtigste zusammengefasst sei. Geboren 1747 als
Taglöhnersohn in Blasiwald wird er später Holzhauer im Höllental. 1769
Schulmeister in Falkensteig, 1771 Schulmeister in Neuhäuser, 1774
Schulmeister in Buchenbach, 1779 Schulmeister in Eschbach, kauft er das
Behenhäusle als Wohn-und Schulhaus. 1780 besucht er die Normalschule in
Freiburg, 1795 wird er von Abt Speckle wacker und tauglich genannt.
1809 bekommt er als Hilfslehrer seinen Sohn Matthias. Ab 1820 will er
die ihm zustehenden Brotlaibe nicht mehr von den Kindern, sondern von
der Gemeinde eingezogen haben. Im Januar 1823 zieht er in das neue
Schulhaus ein; bekommt als Lehrer von der Gemeinde jährlich 100 fl. und
30 kr. Schulgeld von jedem Kind. 1832 stirbt er im Alter von 85 Jahren,
bis zuletzt Lehrer gewesen, und wird auf dem Friedhof in Eschbach
beerdigt.
1832 bis 1846 Matthias Winkler.
Er wurde 1788 als Sohn des Lehrers Michael Winkler in Eschbach geboren.
Mit 17 Jahren besuchte er die Normalschule in Freiburg und legte 1806
die Prüfung ab. 1809 trat er bei seinem Vater als Hilfslehrer ein und
blieb dies bis zu dessen Tode im Jahre 1832. Erst jetzt wurde er
definitiv. Unter seinen Hilfslehrern wird 1838 Lehrer Maier genannt. Im
Jahr darauf bis 1840 ist Hilfslehrer Schumacher bei ihm "mit welchem er
in Streit geriet, so dass dieser ihm die Scheiben einschlug und die
Haustüre einrannte, weshalb er versetzt wurde." Ab 1841 ist
Eduard Schmid für einige Jahre Hilfslehrer in Eschbach. 1835 erscheint
im Regierungsblatt Nr,45 ein neues Schulgesetz, das auch die
Lehrerbesoldung einheitlich regelt. Winkler meint, dass seine alte
Besoldung als Lehrer und Messmer besser gewesen sei und verweigert
deswegen die Annahme der neuen. Bisher hatte er nämlich erhalten:
| An Früchten (vier Sester Roggen, vier Sester Hafer).... |
7 fl.27 kr. |
| Als Messmer | 43 fl.47 kr. |
| Als Lehrer von der Gemeinde | 100 fl. |
| 5 Klafter Holz à 6 fl. | 30 fl. |
| Schulgeld der Kinder ca. 80 mal 30 kr. | 40 fl. |
| Summa |
221 fl. 84 kr |
Nach dem Regierungserlass vom 15. April
1836 aber wird das Gehalt für den Lehrer-Messmer festgesetzt auf 175
fl. dazu kommt das Schulgeld der Kinder 80 mal 30 kr. mit 40 fl. Dies
machte zusammen 215 fl.
Nun ist die Differenz rein optisch betrachtet nicht sehr gross, doch
war der Preis pro Klafter Holz, früher einmal festgelegt, inzwischen
auf mindestens das 1 1/2 fache gestiegen, so dass die 5 Klafter einen
wirklichen Wert von 45 fl. hatten.
Doch ging die Rechnung Winklers nicht ganz auf. Da Besoldungsholz nach
dem neuen Schulgesetz von 1835 eben nicht mehr üblich war, strich ihm
die Gemeinde einfach das Recht hierauf. Winkler hielt sich danach
einfach am Schulholz schadlos. Die Gemeinde reagierte mit Entzug des
Heizrechtes. Der Löwenwirt war jetzt der Heizer. Damit kam Winkler gar
nicht mehr an das Holz heran. Der Streit wird bis vor das Landamt
gebracht. Winkler behauptet, das Schulzimmer würde jetzt mit Sägspänen
geheizt statt mit Holz. Das ganze Haus sei mit Rauch erfüllet, die
Augen tränten, und er müsse sogar die zerbrochene Fensterscheibe in der
Schule selbst bezahlen. Die Gemeinde hingegen spricht von Winklers
unwahren und hässlichen Reden.
Nachdem die Gemeinde dies schon Jahre zuvor versucht hatte, gelang es
ihr 1846 wirklich. Im April dieses Jahres geht Matthias Winkler aus dem
Schuldienst, erst 58 Jahre alt, nachdem er 25 Jahre Hilfslehrer bei
seinem Vater, doch glücklos nur 14 Jahre Hauptlehrer von Eschbach
gewesen. Seine Ehe schloss er erst mit 41 Jahren, wurde er doch bis zum
44. Lebensjahr von seinem Vater mitverhalten. 1852 geriet er in Gant,
sein Häuschen wurde zwangsversteigert und Winkler zog nach Freiburg, wo
er 1869 verstarb. Sein Haus aber übernahm der Schneider Josef Scherer.
1846 bis 1865 Johann Hörner.
1865 bis 1876 Konrad Mangold.
Lehrer Mangold war der letzte Lehrermessmer in Eschbach.1868 wurde
dieses Amt vom Schuldienst abgetrennt. Überliefert ist, dass er als
Witwer dem Alkohol zu sehr zugetan war. Er kam beim Überqueren des
hölzernen “Hohen Steges“ vom Fussweg ab und stürzte in die Dreisam.
(Heute Betonbrücke der Strasse Stegen-Kirchzarten, damals nur Fussweg)
Am 5. Januar 1876 wurde er in der Dreisam tot gefunden und in Eschbach
beerdigt.
1876 bis 1886 Ferdinand Friedrich.
Friedrich war gebürtig aus Kirchhofen und als Lehrer von Eschbach
tüchtig und geachtet. Sein hier geborener Sohn Gotthard wurde
Zisterzienser in Mehrerau. Nach dem ersten Weltkrieg kam er als Pater
anlässlich einer Volksmission wieder hier her ins Dorf.
1886 bis 1887 Schulverwalter Rösch.
Da dieser einen Grossteil seines Gehaltes für sich selbst verbrauchte,
musste seine Familie hart durch. Sein zwölfjähriges Töchterchen Luise
musste täglich 12 Karten (à12 Dutzend) Porzellanknöpfe für die
Knopffabrik Freiburg aufnähen und der zehnjährige Sohn 10 Karten, (also
1440 Knöpfe täglich) ; Rösch wurde als Hauptlehrer abgesetzt. Nach ihm
kam Schulverwalter Werner. Selbst Sohn eines Lehrers, hatte er, wie er
selbst sagte, wenig Freude am Schulhalten. Überliefert wurde, dass er
während der Schulzeit mit der Flinte nach Vögeln schoss, spazieren ging
und einmal während dessen die Oberklasse die ganze Tafel Einser machen
liess.
In diesem Jahr erhielt ein Lehrer an Gehalt:
| Grundgehalt | 840 Mark |
| Schulgeld von den Kindern | 157 Mark |
| Fortbildungsschule | 60 Mark |
| Turnunterricht | 20 Mark |
| Organistendienst |
123 Mark |
| Zusammen | 1200 Mark / jährlich. |
1887 bis 1909 Reinhold Hepting
Wie Matthias Rombach, Gemeinderat und stellvertretender Bürgermeister
berichtete, war Hepting als tüchtiger Lehrer bekannt. Jedoch nahm er
sich gelegentlich Schulvisitationen so zu Herzen, dass er dabei
erkrankte und ernstliche Anzeichen von Schwermut zeigte. Jedenfalls
musste der Inspektor seine Prüfungen allein halten. Wie sein Vorgänger
Friedrich versah auch er den Organistendienst im Ort. Zu seiner Zeit
betrug das Grundgehalt bei Erstanstellung 1000 Mark und im Höchstgehalt
das Doppelte. Im Vergleich hierzu |sei der damals ortsübliche Taglohn
angegeben. Man bezahlte in Eschbach 1,80 Mark, in Freiburg aber 2,30
Mark. 1909 wird Hepting nach Büsslingen versetzt.
1909 bis 1923 August Geiger
Hauptlehrer Geiger war Schmiedsohn und kam aus Karlsruhe. Er stand hier
in Eschbach in hohem Ansehen als strenger und tüchtiger Lehrer. Stets
trug er Gehrock mit Stehkragen und schnupfte mit Vorliebe seinen
Schmalzler. Während der 14 Jahre seines Hierseins hatte Geiger nicht
weniger als 12 Unterlehrer, wobei der eine von ihnen, Unterlehrer
Rudolf Hugger, fast vier Jahre hier in Eschbach war.
Als Linkshänder schlug sich Geiger einmal beim Holzspalten in die
rechte Hand, konnte deswegen nicht mehr schreiben und musste sich
einige Monate von einem Hilfslehrer vertreten lassen. Während des
ersten Weltkrieges gab er an die Bauern die Schlachtscheine aus und
musste dabei auch nicht hungern. Eine seiner beiden Töchter
verheiratete sich mit Unterlehrer Rudolf Hugger. Da derselbe 1922 wegen
sittlicher Verfehlungen an Schulkindern in Haft genommen wird, sinkt
auch das Ansehen Lehrer Geigers. Nach Kiechlinsbergen versetzt, endet
er dort sein Leben auf tragische Weise.
1923 bis 1926 Fritz Dill
Zum 1.7.1923 wird Fritz Dill zum Hauptlehrer in Eschbach bestellt. Der
tüchtige und sehr religiöse Lehrer wird nach seinem Wegzug aus Eschbach
Schulleiter in St.Peter.
1926 bis 1935 Paul Walch
Der pflichtbewusste Lehrer wird nach 9jähriger Arbeit in Eschbach nach Grafenhausen versetzt.
1935 bis 1936 Schulverwalter Walter Bräuchle
Bräuchle hatte es sich nach seiner eigenen Aussage zur Aufgabe gestellt
in Eschbach "Ordnung zu schaffen“." Als überzeugter Nationalsozialist
und SS Mann wird er jedoch im Hai 1936 vom dortigen Ortsgruppenleiter
nach St.Peter geholt.
1936 bis 1942 Linus Heizmann
Im Juni 1936 zieht Hauptlehrer Linus Heizmann in das zuvor etwas
renovierte Schulhaus und bleibt dort bis zu seiner Versetzung in das
1940 bis Kriegsende unter deutscher Verwaltung stehende Elsass.; Im
Austausch kamen mehrere Elsässer Lehrer ins Tal. Unter ihnen bleibt
Lehrer Metzger, ehemaliger Offizier der französischen Armee längere
Zeit und wird bei der Bevölkerung ziemlich beliebt. Auch Frl.
Riethmüller, Schwester eines katholischen Geistlichen, hat mit grosser
Hingabe wertvolle Arbeit geleistet.
1944 bis 1947 Max Horn
Er wohnte im Schulhaus über die Jahre des Zusammenbruches des Deutschen
Reiches. Vom Kriegsende (April 1945) bis Oktober 1945 wird hier im Dorf
wie fast überall keine Schule gehalten. Erst am 29.10.45 nahmen die
ersten vier Schuljahre mit Lehrer Horn den Unterricht wieder auf.
1947 bis heute Julius Wörner
Oberlehrer Wörner berichtet über die letzten zwanzig Jahre
Schulgeschehen hier am Ort wie folgt: " Am 3. Juni 1947 übernahm ich
als Hauptlehrer die Leitung der hiesigen Schule. Der Zustand des
Schulhauses innen und aussen war sehr schlecht. Ein Kollege, der sich
auch um die Stelle interessierte, hatte fluchtartig das Haus verlassen.
Ich teilte dem damaligen Bürgermeister Jakob Kult (1946 - 1953)
Scherlebauer, mit, dass ich nur hier bleibe, wenn die
Gemeindeverwaltung mir beim Auf- und Ausbau der Schule behilflich ist.
Es wurde mir versprochen. Und so übernahm ich am 3.Juni 1947 die
Schulleiterstelle.
Nun begann ein mühseliger Aufbau. Da nach dem zweiten Weltkrieg kaum
etwas zu bekommen war, waren die Fenster, wo das Glas fehlte, mit
Papier verklebt. Wie mir berichtet wurde, war kurz vor Kriegsende noch
der Volkssturm im Schulsaal einquartiert. Besonders schlimm sahen die
Schulbänke aus. Es waren lauter Dreisitzer, zerkratzt, wackelig, also
vollkommen unbrauchbar. Die erste wichtige Anschaffung waren neue
Zweisitzerbänke. Jedoch waren diese damals nur gegen Lieferung von
Kartoffeln noch zu bekommen. Später wurde je nach Kassenlage der
Gemeinde der Aufbau weiter fortgeführt: neuer Schulboden,
Wandbekleidung, fünf moderne elektrische Lampen, neue Fenster mit
Vorhangen, Lehrerpult (vorher war nur ein alter Tisch da), zwei neue
Lehrmittelschränke usw.
Ebenso wurde mit der Anschaffung der Lehrmittel begonnen, da kaum noch
etwas vorhanden war. Es sei noch bemerkt, dass wir damals noch
französische Besatzungszone waren und von Zeit zu Zeit ein sogenannter
französischer Schuloffizier kam, welcher nachprüfte, ob keine Bücher
und Landkarten aus der Hitlerzeit in der Schule noch verwendet würden.
Es blieb deshalb nichts anderes übrig, als die noch vorhandenen
Gegenstände zu vernichten. Auch mit dem Aufbau einer Schülerbibliothek
wurde angefangen, und heute besitzt die Schule 220 Bücher, welche sehr
gerne von den Schülern benützt sehr gerne von den Schülern benützt
werden.
Auch unter Bürgermeister Wilhelm Läufer (1953 - 1956) Peterbauer, und
Bürgermeister Max Spitz (1957 bis heute) hatte ich eine grosse Hilfe.
Es wurde nun mit der Renovierung des ganzen Hauses begonnen: neues
Ziegeldach, da bei Regenwetter das Wasser durch die brüchigen Ziegel
hereinfloss und von mir immer Eimer untergestellt werden mussten, Haus
frisch verputzt, die ganze Wohnung renoviert, die alten Kachelöfen
abgerissen und moderne kleine Öfen aufgestellt, neue Fenster und
Fensterläden, neue Türen, zwei neue Fussböden und alles frisch
tapeziert.
Besonders schlimm waren die alten Schüleraborte, die noch zugleich von
der Öffentlichkeit mitbenützt wurden, Da sie keine Spülung hatten,
sahen sie demnach auch aus! Unter Bürgermeister Spitz wurden nun ganz
moderne Abortanlagen geschaffen. Auch der zweite Schulsaal im Rathaus
erhielt neue Bänke und Lampen. Ein dritter Ausweichschulsaal im Rathaus
wurde aus der sogenannten Unterlehrerwohnung (Zwei Zimmer), worin 1947
eine Posthilfsstelle untergebracht war, hergerichtet. Er wurde von der
Fortbildungsschule, welche damals noch im Dorf war, benützt. Heute
werden darin Volksschüler unterrichtet.
Der Schulhof, der zwischen Kirche und Schulhaus liegt, war auch noch
ein Sorgenkind. Mitten im Hof befand sich eine kleine Grasmatte (10 mal
10 Meter) mit alten Obstbäumen eingefasst war sie mit einem alten,
geflickten eisernen Zaun mit gefährlichen spitzen Stäben. Daran hatten
sich manche Schulkinder beim Spiel verletzt. Da der Schulplatz
teilweise Eigentum der Kirche war, sprach ich mit dem damaligen
Ortspfarrer Karl Gärtner, wegen der Entfernung dieser Grasmatte. Er
stimmte sofort zu, und die Gemeinde liess den Platz herrichten, so wie
er jetzt noch ist.
Da die Gemeindeverwaltung mir beim Aufbau der Schule so grosszügig
geholfen hatte, und dafür sage ich nochmals herzlichen Dank, entschloss
ich mich bis zu meiner Pensionierung hierzubleiben. Am 1.12.1966 wurde
ich in den Ruhestand versetzt. Da jedoch zur Zeit ein grosser
Lehrermangel herrscht, entschloss ich mich, bis August 1967 (Ende des
zweiten Kurzschuljahres) im Dienst zu bleiben. Und so erlebe ich noch
die Einweihung des neuen Schulhauses am 6.1.1967 und kann darin noch
einige Monate unterrichten. Und somit wirkte ich 20 Jahre an der
Volksschule Eschbach bei Freiburg.
b) Die Unterlehrer
Wie ein Überblick über die grosse Anzahl der Namen zeigt, konnte man
sich über mangelnde Abwechslung in dieser Hinsicht nicht beklagen.
Unter den vielen waren es nur wenige, die in Gedächtnis der Bevölkerung
unseres Dorfes haften blieben. Unter ihnen ist bs. Hermann Handloser,
hier zum erstenmal 1923 und dann wieder als Unterlehrer vom September
1924 bis Mai 1931. Handloser kommt danach zunächst nach Grisshein und
wird nach den Kriege Rektor in Bad Krozingen. Als beliebter Lehrer
wurde er stets gern und immer wieder hier im Dorfe gesehen und wird
1967 vom Bürgermeisteramt auch zur Einweihung der neuen Schule
eingeladen.
Hier die Namen der übrigen, soweit sie noch bekannt sind:
| 1904/05 | Oskar Sehweiss | 1923 | Hermann Handloser |
| 1905/07 | Anton Engel | 1924 | Maria Roth |
| 1907 |
Fanny Molitor | 1924/31 | Hermann Handloser |
| 1907 |
Georg Mösinger |
1931/32 | Karl Dorn |
| 1907/08 |
Anna Pamsperger | 1932/33 | Josephine Wild |
| 1908 |
Else Meyer |
1933/36 | Paula Schweizer |
| 1908/09 | Matthäus Gutmann | 1935 | Emil Hoffmann |
| 1909/10 | Eduard Denninger | 1936 | Maria Luise Tillesen |
| 1910/12 | Emil Wunsch | 1937 | Irmgard Klesper |
| 1912 |
Amelie Huber | 1941/44 | Riethmüller |
| 1912 |
Franz Kuri gefallen bei La Basseo 17.12.1914 |
1943/45 | Metzger |
| 1914 |
Stefan Köbele gefallen bei Verdun 27.3.1916 | 1945/49 | Marta Wölfle |
| 1914 |
Hoferer | 1947 | Cäcilie Reis |
| 1914/15 | Laura Ernst | 1949/53 | Franz Metzger |
| 1916 |
Frieda Schneider |
1953/56 | Gerhard Kaiser |
| 1919/22 | Rudolf Hugger |
1956/.. |
Norbert Graf (der Chronist) |
| 1922 | Fritz Dill |
1965/1.12.66 |
Dr. Marianne Graf |
| 1922 |
Josef Schlageter |
6. Schule heute und morgen
Bis 1770 lag Schule in Raum des Privaten. Sie wurde getragen von Kirche
Stadt, Stand, Zunft, Familie. Die Lehrer waren deren Angestellte. Jeder
Vater konnte entscheiden, ob, wo, bei wem, wie lange, wie oft sein Kind
zur Schule ging. Dass dabei die Interessen der Kinder oft zu kurz
kamen, haben wir gesehen.
Nach 1770 griff der Staat in stets stärker werdenden Masse nach der
Schule, nach Schüler und Lehrer. Die alten gesellschaftliche Kräfte
traten immer mehr in den Hintergrund. Der Chronist stammt aus einer
Familie, in der mehrere Generationen eine Vielzahl von Lehrern
hervorgebracht haben. Er bewundert die Naivität, mit der seine Väter
die Freiheit von kirchlicher Schulaufsicht gefeiert haben, nicht
ahnend, dass sie völlig in die Abhängigkeit von Staate gerieten, der
nicht mehr wie bisher die Kirche seine Gesetze nach feststehenden, nur
wenig wandelbaren, von jeden einsehbaren Normen verfasste, sondern, der
diese heute nach den wirklichen oder vermeintlichen Bedürfnissen des
Tages festlegt. Doch bekam mein Vater als Lehrer, der Chronist als
Schüler den Terror des Staates noch zu spüren, der während der 12 Jahre
des Dritten Reiches nach allem griff und auch das Elternrecht nicht
unangetaste liess, wobei der Staat die Berechtigung für sein Handeln
aus einem Prinzip entnahm, dessen Gefährlichkeit nur wenigen
Zeitgenossen bewusst wurde, und das lautete: “Gut ist, was dem Volke
nützt“. Dazu kam, dass gerade in dieser Zeit die Formen und Methoden
zur Manipulierung der Massen in für die Zukunft vorbildliche Weise
demonstriert wurden. Das Ende des Systems brachte eine Rückbesinnung
auf das Recht. In Bereich der Schule die Rückbesinnung auf das Recht
der Eltern. In dieser Zeit konnte zwar kein Vater mehr entscheiden, ob,
wielange, wie oft sein Kind zur Schule ging, und vielleicht war dies
gut so; doch kannte er die Grenzen des Staates.
Die Bedürfnisse des Tages, welche in Wahrheit die wechselnden
Bedürfnisse des Menschen sind, forderten in den letzten Jahren, in
stetig steigendem Masse, höhere Leistungen der Schule. Jahrelang wurde
dies unter Beibehaltung des bisherigen Schulsystems mit Hilfe der
"inneren Schulreform“ versucht. Unterrichtsmetıoden wurden verbessert,
verfeinert, Film, Funk und Ton fanden Eingang in der Schule. Die
Lehrerausbildung wurde verbessert und verlängert, neue Schulhäuser
allerorts gebaut. Genau in das Ende dieser Zeit, die zugleich das Ende
der noch durch die Gemeinden getragenen Schulen zu sein scheint, fällt
der Bau des neuen Schulhauses in Eschbach.
Provoziert wurde der Bau durch die ständig steigenden Schülerzahlen,
die in Verbindung mit den schon seit Jahren geplanten 9.Schuljahr einen
weiteren Verbleib in den zwei alten Schulsälen unmöglich machte. Der
aus einem Wettbewerb der Architekten Ruch, Brandhorst und Eckert
ausgewählte Plan Ruch, zeigte noch eine wesentlich grössere Ausdehnung
als das jetzt ausgeführte Projekt.
Wie kam es dazu? Seit über 15 Jahren versucht man im kommunistisch
regierten Teil Deutschlands im Sinne der Marxschen Lehre in Verbindung
mit der Wissenschaft, die "Fehlkonstruktion Mensch" anzugehen. Durch
einen enormen Ausbau des Schulwesens wird dies vor allen bei der Jugend
versucht. Zur Ermöglichung weitgehender Differenzierung der Schüler
nach Begabung und Interesse mussten möglichst viele Kinder
zusammengebracht werden. Auch lassen sie sich an wenigen grossen
Schulen besser im Sinne der Bedürfnisse der Mächtigen beeinflussen, als
in vielen kleinen, nicht immer kontrollierbaren. Schon um 1960
übernahmen dieses System auch die sozialistisch regierten Länder der
Bundesrepublik. Das von der CDU regierte Land Baden-Württemberg zögerte
noch. Erst in April 1964 glaubten sich auch die Christdemokraten den
allgemeinen Tendenzen nicht entziehen zu können. Dies war die Zeit, als
in Eschbach der erste Plan für das neue Schulhaus schon vorlag. Einige
Monate darauf war der Plan um zwei Schulzimmer verkleinert, und nur dem
Verhandlungsgeschick des tüchtigen Architekten Ruch ist es zu
verdanken, dass es hierbei noch zu einer alle Seiten befriedigenden
Lösung kam. In Juni 1965 begannen die Bauarbeiten, an 11.3.1966 wurde
das Richtfest gefeiert und Silvester 1966 stand der Bau fertig da.
Doch inzwischen hatte auch der Staat seine Bemühungen, die in
“Nachbarschaftsschulen" unbenannten Zentralschulen baldmöglichst
einzurichten, verstärkt. Da der bisher übliche Verhandlungsweg den
Verwaltungen zu mühsam erschien, wurde durch ministeriellen Erlass vom
Oktober 1966 zum 1.Dezember die zwangsweise Verschickung der Schüler
des 8. und 9. Schuljahres nach den vom staatlichen Schulamt
ausgesuchten Zentralschulorten, allerdings mit dem Zusatz, dass
dieselbe kein Praejudiz für die künftige Nachbarschaftsschule ergäbe,
angeordnet. Doch wer hätte den Mut, daran zu glauben? Die
Gemeindeverwaltung, der Schulbeirat, die Lehrer und die Eltern
Eschbachs reagierten auf diese Verfügung so gut es die knappe Frist
zuliess. Sie bat die Behörden um Aufschub der Verwirklichung einer
Verschickung des 8.und 9. Schuljahres, damit in ruhigen Verhandlungen
das Beste für die Kinder dieses Ortes ausgesucht, und eine
Verschlechterung des Schulunterrichtes aller Schuljahre verhindert
würde. Als Gründe führte sie unter anderem folgendes aus: "Durch den
geplanten Abzug des 8. und 9. Schuljahres sinkt nach Schuleintritt von
15 Schulanfängern die Schülerzahl in Eschbach auf 95. Obwohl diese
Schülerzahl noch um die Messzahl liegt, wurde die Versetzung einer der
hiesigen drei Lehrkräfte bereits eingeleitet. Hiermit entsteht eine
starke Belastung der verbleibenden zwei Lehrkräfte, von denen der eine
nach seiner Pensionierung zum 1.12. 66 im 67 Lebensjahr stehend, aber
andere Schulverhältnisse erwartend, für das kommende Kurzschuljahr sich
als Klassenlehrer zur Verfügung gestellt hat.... Die Schüler des
bisherigen 6. und 7. Schuljahres werden seit zwei Jahren an der
hiesigen Schule mit 5 Wochenstunden in Englisch unterrichtet. Bei der
geplanten Einrichtung des 8. Schuljahres in Stegen wird die Fortführung
dieses Unterrichtes für genanntes Schuljahr, wie auch für die in
Eschbach verbleibenden Schuljahre unmöglich...Die Gemeinde Eschbach
liegt zwischen zwei Hauptschulen mit verschiedenartigster
Bevölkerungsstruktur. Erwächst die eine jetzt schon und künftighin
eindeutig aus einen Vorstadtmilieu, wird die andere weitgehend von
ihrer Lage im Schwarzwald geprägt. Die Gemeinde Eschbach erbittet sich
für eine Entscheidung von solch weitgehenden Folgen für die kommenden
Schülergenerationen eine angemessene Bedenkzeit aus... Die auch im
Provisorium indirekt vorhandene Festsetzung des Schulbezirks, mit dem
Zwang eine bestimmte Schule zu besuchen, bedeutet einen erheblichen
Eingriff in das elterliche Erziehungsrecht. Verhandlungen schaffen
besser als Verfügungen Rechtsnormen, um dieses Recht beschneiden zu
können."
Die Antwort der Behörde war die Versetzung einer Lehrkraft dieser
Schule. Damit waren allen hier die Hände gebunden, dem Elternrecht der
entscheidende Schlag versetzt. Zwar blieben am Ort noch die 96 Kinder
der ersten sieben Schuljahre, und diese hatten laut Messzahl auch eine
dritte Lehrkraft zu beanspruchen gehabt, doch waren es jetzt nur noch
zwei, und diesen wäre es auf die Dauer unmöglich gewesen auch das 8.
Und 9. Schuljahr zu unterrichten. Der Chronist riet in einer
Elternversammlung am 8. 12., ein Tag vor Schuljahrsbeginn sich in das
Unvermeidliche zu ergeben und die Kinder nach Stegen abholen zu lassen.
Die Antwort war ein einstimmiges "Nein“ der erschienenen Eltern. Ein
wertvolles Nein, ein nicht provoziertes Nein, ein Nein, das vielleicht
keinen Augenblickserfolg haben wird, aber ein Nein, das Hoffen lässt,
dass einen gefährlich heraufziehenden neuen Prinzip Widerstand
geleistet wird, einem Prinzip, das da lautet: “Gut ist, was der
Gesellschaft nützt." Dieses Wohlbekannte, ähnlich schon einmal
Vernomnene, das zwar Wahrheit in sich birgt, das aber des Widerstandes
bedarf, damit es nicht alles Recht, auch das der Eltern vernichte.
Seither schicken die Eltern das 8. und 9. Schuljahr nicht nach Stegen,
sondern weiterhin nach Eschbach, dies mit umso grösseren Recht, als die
Architekten des noch im Bau befindlichen Stegener Schulhauses in der
Weihnachtsausgabe der Badischen Zeitung in aller Öffentlichkeit
feststellten; "Die Schule (von Stegen) ist nicht nur "nicht fertig
eingerichtet", sondern die Bauarbeiten sind überhaupt noch nicht
abgeschlossen, d.h. es ist noch eine reguläre Baustelle.“ Nun sind hier
116 Kinder! Dafür fährt die dritte Lehrkraft der Schule nach
Buchenbach. Dort sind drei Lehrer für 85 Kinder, in St. Peter 6 Lehrer
für 198 Kinder, in Stegen 4 Lehrer für ca. 100 Kinder. Wie gut
verteilt. Und die öffentliche Meinung? Der liberalen Badischen Zeitung
wurde Material über die Lage in Eschbach übergeben. Sie schweigt. Wie
sollte sie auch den Mut haben sich für so etwas Unmodernes wie das
Elternrecht einzusetzen.
Die Bedürfnisse der Zeit, die die Bedürfnisse der Menschen sind,
fordern vom Staat, die Fehlkonstruktion Mensch umzuformen. “Ziehet an
den neuen Menschen, der nach uns geschaffen ist.“ "Der Mensch hier auf
Erden ist untauglich und muss für die künftigen Aufgaben umkonstruiert
werden. "Worte unserer Zeit, Professor Karl Rahner, S.J., der
bedeutende Theologe unserer Zeit sagt: “Die Zukunft der
Selbstmanipulation des Menschen hat schon begonnen."
Sie hat begonnen! In der Schule, bald wohl auch in der Biologie. Ob man
ihn bald mehr Hirn verschafft, die Dummen und Mittelmässigen von der
Zeugung ausschliesst, die Gene hochbegabter Zuchtpaare beeinflusst?
"Die Zukunft der Selbstmanipulation des Menschen hat begonnen.“ Doch
wohin gedenkt man die notorische Bosheit der Menschen zu manipulieren?
Hier erwächst die grosse künftige Aufgabe der Eltern auch dieser
Gemeinde. Es gilt der alles erfassenden These des modernen Bewusstseins
"Gut ist, was der Gesellschaft nützt“ , in zäher Beharrlichkeit ein
Regulativ entgegenzustellen, dem künftigen, allein dem Gesetz der
Nützlichkeit entstammenden Manipulationen des Staates, die aus dem
Gesetz der Liebe geborene Elternverantwertung als notwendige Schranke
dagegenzusetzen.
Das blosse Vertrauen auf den Namen Demokratie hilft uns nichts, schon
gar nicht, wenn die Politiker, oft selbst guten Willens, den Terror der
Verwaltungen und Fachleute gar nicht erkennen. Vision der Zukunft, wenn
Kommissionen von Fachleuten unsere Grundschulen durchziehen und die
Kinder in Gruppen teilen, von denen die einen nach Freiburg ins
Gymnasium die zweite nach Kirchzarten in die Mittelschule, die dritte
in die Hauptschule nach Stegen, die vierte, letzte und
erbarmungswürdigste aber in die Sonderschule nach Zarten verfrachtet
werden soll. Vision oder bald Wirklichkeit?
Mensch der Zukunft, der du diese, in Schlusstein verwahrte Chronik
liest, du weisst mehr als der Chronist heute, und doch nicht mehr, weil
auch er schon weiss, dass der Mensch nur von Gott her gedacht werden
kann. Und er ist schon längst gedacht. Er lebte mitten unter uns. Als
er in der Krippe lag zu Bethlehem, gab Herodes den Befehl zum
Kindermord. So lautete die Antwort des Menschen. An diesem Tage, an dem
der Chronist dies bedenkt, stimmt er ein in den Seufzer Davids, der von
Gott gefragt, für welche von drei Sühnemöglichkeiten für seinen Frevel
er sich entscheide, ausstiess: "und will nicht in Menschenhände fallen."
Doch ist der Chronist auch guten Mutes. Die Zeichen für diesen Ort
stehen nicht schlecht. Christliche Männer in der Gemeindeverwaltung
haben dieses Haus gewünscht und geplant.
Dank hierob dem Bürgermeister Max Spitz, dem Ratschreiber Heinrich
Schwär, dem Rechner Strecker und allen Mitgliedern des Gemeinderates.
Ein christlicher Architekt hat dieses Haus geplant und seinen Bau
geleitet und überwacht. Dank dem Architekten Ruch für seine gute und
ehrliche Arbeit, und für die Kreuze, sein Geschenk an dieses Haus. Das
Siegeszeichen des Kreuzes möge nie von diesen Wänden verschwinden
müssen. Christliche Eltern haben es vermocht, einstimmig den
staatlichen Manipulationen als Regulativ entgegenzutreten. Dank den
Eltern. Mögen aber diesem Hause stets auch christliche Lehrer
beschieden sein.
An der Stirnwand der Schule aber stehet:
ST. JAKOBUS, PATRON VON ESCHBACH
der Chronist ergänzt :
BESCHÜTZE UNS UND UNSERE KINDER
VII. Entwicklung von Landwirtschaft Gewerbe und Handel:
a) Land-und Forstwirtschaft.
Die Entwicklung der landwirtschaftlichen Betriebe verlief in letzter Zeit wie folgt:
| Landw. Betriebe Landw. Besitzfläche |
1930 | 1949 | 1960 |
| unter 2 ha |
23 | 9 | 10 |
| 2 - unter 5 ha | 19 | 12 | 10 |
| 5 - unter 10 ha | 13 | 9 | |
| 10 - unter 20 ha | 17 | 20 |
15 |
| 20 ha und mehr | 2 | 17 | 12 |
| 74 |
58 | 56 |
Zu dieser Fläche kommt noch der Waldbesitz,
der die Sparkasse des Bauern bedeutet und bei Erbauseinandersetzungen,
Brand- und Unglücksfällen einen wichtigen Rückhalt bildet. Die Gemeinde
gehört zum Zuchtgebiet der Schwarzwälder Pferde. Als Milchvieh wird die
Vorderwälderrasse gehalten. Die früheren Wässerwiesen sind heute fast
gänzlich aufgegeben. Das Flurbild ist augenblicklich durch die Zunahme
der Grünlandwirtschaft in Umwandlung begriffen. Von Eschbach aus werden
0,75 ha in Stegen, 1,08 ha in Zarten und 1,75 ha in St.Peter
bewirtschaftet, auf Gemarkung Eschbach 13,13 ha von Besitzern aus
Stegen und 2,07 ha aus St.Peter. In Eschbach besteht eine
landwirtschaftliche Genossenschaft.
Über die Viehhaltung geben folgende Zahlen Aufschluß:
| 1880 | 1913 | 1930 | 1950 | 1960 | 1966 | |
| Pferde |
73 | 73 | 57 | 44 |
40 | 29 |
| Rinder |
490 | 472 | 416 | 400 | 442 | 520 |
| Schweine |
346 | 534 | 502 | 319 | 466 | 459 |
| Schafe |
278 | 199 | 145 | ... |
27 | 25 |
| Ziegen |
72 | 103 | 48 |
... | 17 | 11 |
| dazu Bienenstöcke | 79 | 278 | 196 | ... |
176 | 204 |
Der heutige Wald besteht zu 78% aus
Nadelwald. Die 648,7 ha setzen sich aus 166,0 ha Staatswald, 42,8 ha
Gemeinde- und Körperschaftswald und 459,9 ha Kleinprivatwald zusammen.
Letztere sind in 91 Parzellen geteilt, die 51 Besitzern gehören. So
kommen im Durchschnitt auf 1 Besitzer 8,60 ha Wald, auf 1 Parzelle 4,80
ha.
Ausgestockt wurde von 1945 -1965 1,0 ha Privatwald für Zwecke der
Landwirtschaft, aufgeforstet im gleichen Zeitraum 6,0 ha Körperschafts-
und Gemeindewald; sowie 25,0 ha Privatwald. Im Staatswald gibt es noch
1,0 ha umzuwandelnden Niederwald, im Kleinprivatwald 15,0 ha.
Es bestehen zwei gemeinschaftliche Jagdbezirke; die durch die Straße
nach St.Peter getrennt werden; der eine Bezirk ist an Einheimische
verpachtet, der andere an Pächter aus verschiedenen Orten. Das
Fischwasser ist an einen Gastwirt aus Kappel verpachtet.
b) Gewerbe, Handel und Verkehr.
In Eschbach gab es eine sanktpetersche Bannmühle. Graf Konrad von
Freiburg erließ 1542 ein verschärftes Verbot für die Untertanen des
Klosters, in einer anderen Mühle mahlen zu lassen. 1608 wurde die
Errichtung einer Mahlmühle auf dem Schwörerhof im Obertal genehmigt.
Der Mahlzwang fiel erst nach Aufhebung des Klosters (1806). Bis zur
Mitte des 19.Jh. entstand eine große Zahl von Hofmühlen in Eschbach.
Auch vom Fräslehof in Burg wurde eine solche auf einen Hof in Eschbach
transferiert.
Die Handwerker - es gab z.B. Weber in Eschbach - waren in der Kirchzartener Lade verzunftet.
Das Wirtshaus "zum Löwen" wurde 1748 erbaut. Die Konzession mußte für
jedes Jahr neu erteilt werden. Die Wirtschaft des sickingischen
Gemeindeteils war der "Engel“. Auf dem Hummelhof befand sich eine
bereits um 1500 erwähnte Säge, ebenso ein Schmiede, die vor 1700 vom
Hofe getrennt wurde.
Die Straße durch das Eschbachtal hatte vor allem wegen der Verbindung
von Freiburg nach St.Peter und weiter über den Schwarzwald einige
Bedeutung. Nach der Schlacht von Freiburg (August 1644) nahm die Armee
General Mercys diesen Weg, um nicht durch die Franzosen vom Glottertal
her bei St.Peter abgeschnitten zu werden. Vor allem durch französische
Durchzüge hatte das Tal im späteren 18.Jh. zu leiden.
Industriebetriebe sind auch heute am Ort nicht vorhanden. Es gibt 1
Baugeschäft und je 1 Zimmereigeschäft, Wagnerei und Schmiede.
Zwei Gasthöfe ("Engel und Löwen") und verschiedene Privatunterkünfte
verfügen zusammen über 36 Betten. Im Ort sind 5 Haltestellen der seit
1912 verkehrenden Kraftpostlinie Freiburg - St.Peter - St.Märgen. Durch
Eschbach führt die Landesstraße 127 von Freiburg nach St.Peter.